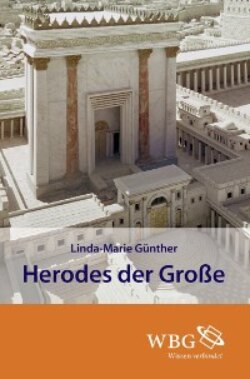Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 13
1. Hyrkanus und Antipater – eine Schicksalsgemeinschaft2
ОглавлениеDen Königstitel hatte zusätzlich zur traditionellen Würde des Hohepriesters als erster Herrscher des judäischen Gemeinwesens der Hasmonäer Alexander Jannai (103 – 76) angenommen. Unter ihm erreichte der judäische Staat seine größte territoriale Ausdehnung, nachdem schon sein Vater Hyrkanus I. (134 – 104) neben Samaria und einigen ostjordanischen Gebieten vor allem Idumäa erobert und zum jüdischen Glauben gebracht hatte. Diese Landschaft südlich von Judäa erstreckte sich von der Küste bei Askalon und Gaza bis zum Toten Meer; südlich und südöstlich reichte sie bis an das Gebiet der halbnomadischen Nabatäer, in deren Hand die so genannte Weihrauchstraße war, die aus dem Jemen kommend über Petra und Beersheba nach Gaza führte. Aus dieser Region stammte der von Alexander Jannai dort eingesetzte Militärgouverneur (strategos) Antipas, Vater des Antipater und Großvater des Herodes. Er war seinem König äußerst nützlich aufgrund seiner guten persönlichen Kontakte zu der nabatäischen Führungselite sowie seines diplomatischen Geschicks, das er insbesondere bei den Friedensverhandlungen um 80 bewiesen hatte: Durch seine Vermittlung wurde nach mehreren transjordanischen Feldzügen Alexanders Herrschaftsgebiet um die Städte Pella, Dion, Gerasa, Gaulana und Gamala erweitert.
Abb. 4: Modell der Palastfestung Antonia in Jerusalem.
Als der König 76 – während eines neuerlichen Feldzuges im Gebiet von Gerasa – starb, ging die Herrschaft auf seine Witwe Salome-Alexandra über, die einem Mann vorbehaltene Hohepriesterwürde auf seinen ältesten Sohn Hyrkanus. Um diese Zeit war Antipater seinem verdienstvollen Vater im Amt des Strategen von Idumäa gefolgt. Mit dem Tod der Salome-Alexandra im Jahr 67 brachen wieder Thronstreitigkeiten aus, und Hyrkanus zog sich zunächst unter Verzicht auf sein Hohepriesteramt vor seinem jüngeren Bruder Aristobulus, der sogleich den Königstitel angenommen hatte, ins Privatleben zurück. Doch dann war es Antipater, der ihm riet, um die Wiedererlangung seiner rechtmäßigen Herrschaft zu kämpfen. Dabei sollte ihm der Nabatäerkönig Aretas III. (87 – 62) helfen, und zwar um den Preis der Rückgabe einiger Städte, die einst Alexander Jannai vom früheren König Obedas erobert hatte. Antipater brachte als Unterpfand für die vereinbarte Militärhilfe seine eigene Familie aus dem idumäischen Marisa nach Petra; seine Gattin Kypros, die ihm die Söhne Phasaël, Herodes, Joseph und Pheroras geboren hatte, war nämlich eine vornehme Nabatäerin, offenbar sogar eine Verwandte des Königs. Nach ersten schnellen militärischen Erfolgen belagerten Aretas und Hyrkanus im Jahre 65 gemeinsam den Aristobulus in Jerusalem.
Indessen traf in Syrien das römische Heer ein, das unter Pompeius’ Oberbefehl soeben Tigranes von Armenien besiegt hatte; nunmehr sollte das Land auch von arabischen und jüdischen Raubzügen ‘befreit’ werden. Kaum war Damaskus, das seit einiger Zeit unter der Kontrolle des Aretas stand, eingenommen, plädierte der Quästor Aemilius Scaurus für ein weiteres Vorrücken nach Judäa, wo ja der Araberfürst Aretas Jerusalem belagerte. In dieser Situation – und in deren richtiger Einschätzung, dass keiner von ihnen ohne römische Zustimmung herrschen könnte – wurden sowohl Aristobulus als auch Hyrkanus bei Scaurus vorstellig, um eine Entscheidung zu erbitten beziehungsweise mehr oder weniger ungeniert zu erkaufen.3 Zunächst obsiegte Aristobulus, da er dem Scaurus als ein geeigneter Partner im aktuellen Feldzug gegen den Nabatäerkönig erschien, doch blieb die letzte Entscheidung über die Thronfolge in Judäa Pompeius selbst vorbehalten. Als bei der entscheidenden Besprechung in Damaskus im Frühjahr 63 auch Antipater erschien und möglicherweise mit den guten Beziehungen zu Aretas für Hyrkanus als König warb, neigte der ‘Generalissimus’ zwar – wie zuvor sein Quästor – dazu, den Aristobulus in seiner Position anzuerkennen. Aber als dann beim weiteren Zug des römischen Heeres durch das Jordantal gegen die Nabatäer Aristobulus eine ärgerliche Unbotmäßigkeit zeigte und ihn schließlich Pompeius in der Nähe Jerusalems gefangen nahm, wendete sich das Blatt zugunsten von Hyrkanus und Antipater. Es folgten die Belagerung der Stadt, die von Anhängern des früheren Hohepriesters den Römern geöffnet wurde, und die Niederwerfung der Anhänger des Aristobulus auf dem Tempelberg. Schließlich machte Pompeius Jerusalem und Judäa tributpflichtig und setzte den Hyrkanus wieder ein: als Hohepriester ohne Königstitel. Dass dieser fortan zu seinen wichtigsten Vertrauten den Antipater zählte, kann nicht zweifelhaft sein, verdankte er ihm doch die Rückkehr in die vom Vater ererbte Machtposition. Das Territorium freilich, über das er jetzt gebot, war kleiner als Alexander Jannais Judäa: Pompeius hatte es dadurch verkleinert, dass er die zahlreichen griechischen Städte der Küstenzone und in Transjordanien, die seit einigen Jahrzehnten Zug um Zug einverleibt worden waren, jetzt der Jurisdiktion des Statthalters der neuen Provinz Syrien unterstellte.
Während anschließend Pompeius nach Kilikien zog, setzte sein Quästor Scaurus seinen nabatäischen Feldzug unverdrossen fort. Er belagerte im Frühjahr 62 die Felsenstadt und Königsresidenz Petra, die er freilich, wie er schließlich einsehen musste, nicht erobern konnte. Dabei hat er sich und seine Truppen durch die Verheerung des umliegenden Ackerlandes zudem in größte Versorgungsnot gebracht, so dass als Lösung nur ein Verhandlungsfrieden mit Aretas blieb. Diesen erreichte er durch Vermittlung Antipaters, der im Namen von Hyrkanus bereits der römischen Armee Lebensmittel geliefert hatte. Als Gastfreund des Nabatäerkönigs war er ein geeigneter Unterhändler und leistete sogar noch Bürgschaft über 300 Talente für die ganze oder teilweise Geldzahlung, welche die Römer für ihren – als Verzicht auf weitere Plünderungen deklarierten – Abzug erhielten. Dieses Geld war von Antipater zweifellos gut investiert, denn fortan wusste ein Mann wie Aemilius Scaurus die Befriedungskompetenzen und die Diskretion des Hyrkanus und seiner Freunde zu schätzen.
Abb. 5: Das edomitische Bergland bei Petra.
Dass die Beinahe-Blamage des römischen Befehlshabers vor Petra in Rom als beachtlicher Erfolg ausgegeben wurde, dokumentieren die Denar-Emissionen des Jahres 58, in dem der gleichnamige Sohn des Quästors, Aemilius Scaurus, einer der beiden Münzmeister war und sich, wie es seit rund einer Generation üblich geworden war, seinen Mitbürgern mit einer optischen Erinnerung an eine historische Leistung seiner Familie empfahl. Auf der Vorderseite kniet ein Araber, durch die Legende unter der Standlinie als REX ARETAS – König Aretas – zu identifizieren, neben einem Kamel und mit einem Palmzweig in seiner bittflehend erhobenen Hand; auf der Rückseite symbolisiert eine galoppierende Quadriga den römischen Sieg.
Einer der beiden Konsuln eben dieses Jahres, nämlich Aulus Gabinius, erhielt im folgenden Jahr als Statthalter die Provinz Syrien, wo er schon zu Beginn seiner schließlich vierjährigen Amtszeit massiv im benachbarten Vasallenstaat Judäa eingreifen musste. Dort schwelte ein Bürgerkrieg, der nicht nur den Hohepriester Hyrkanus, sondern damit zugleich das Ansehen Roms, der Garantiemacht der neuen Ordnung, bedrohte. Anführer einer zunehmend auch militärisch erstarkenden Bewegung war Alexander, der aus der römischen Haft entflohene und in die Heimat zurückgekehrte Sohn des kriegsgefangenen Aristobulus. Er beanspruchte anstelle seines Vaters die hasmonäische Königswürde, zog mit seinen Anhängern raubend durchs Land und hatte sich bereits in den Festungen Alexandreion, Hyrkania und Machärus festgesetzt. Gegen diesen Prätendenten richtete sich nun also der Feldzug des syrischen Statthalters; zur Unterstützung seiner Truppen, in deren Vorhut sich der junge Marcus Antonius hervortat, trug auch wieder Antipater mit Hilfstruppen bei.
Nach Alexanders Kapitulation bestätigte Gabinius wiederum Hyrkanus als Hohepriester in Jerusalem, zudem ließ er die geräumten Festungen umgehend schleifen und die zum Teil seit mehreren Jahren zerstörten griechischen Städte schnellstmöglich wiederaufbauen. Schließlich verfügte er Maßnahmen, die über die Friedensordnung des Pompeius noch hinausgingen: „(Er) bestellte fünf Gerichtshöfe für ebenso viele Bezirke, und zwar zu Jerusalem, Gadara, Amathus, Jericho und zu Sepphoris in Galiläa. So waren also die Juden ihres Königtums verlustig und hatten nun eine aristokratische Regierungsform“ (AJ 14,5,4 / 91).
Diese Verwaltungsreform des Gabinius ist in der modernen Forschung mit Blick auf die Absichten Roms und die Folgen für Judäa oft diskutiert worden4: Sollte das Land „nach altem römischen Rezept dadurch noch unschädlicher gemacht (werden), dass man es in fünf … Republiken zerschlug“, die als „wenig lebensfähige Gebilde“ vor allem die Tributgelder für Rom einzuziehen hatten? Wurde dem Hyrkanus unter Belassung nur noch der „geistlichen Würde“ tatsächlich seine „Fürstenstellung“ entzogen, und bedeutete dies als Trennung von der politischen Verwaltung den Beginn eines folgenschweren Entmachtungsprozesses des Hohepriestertums? Wollte Gabinius Judäa also schwächen oder vielmehr stabilisieren, nämlich indem er künftigen Versuchen, die hasmonäische Monarchie zu restaurieren, einen Riegel vorschob? Diese zweite Interpretation ist den Intentionen und Strategien römischer Politik sehr viel angemessener, insofern die Maßnahmen darauf abzielten, mit den evidenten machtpolitischen Interessen der Römer diejenigen jüdischen zu koordinieren, die schon dem Pompeius von Seiten der Priesteraristokratie vorgetragen worden waren.
Es war nämlich, als im Frühjahr 63 Aristobulus und Hyrkanus mit ihren ‘Lobbies’ um die Gunst des Feldherrn und um sein Machtwort zur Inthronisierung eines von ihnen warben, in Damaskus noch eine dritte Gesandtschaft vorstellig geworden: „Das Volk, das überhaupt von der Königsherrschaft nichts wissen wollte, ließ vorbringen, bei ihnen sei es alte Sitte, dass sie nur den Priestern des von ihnen verehrten Gottes zu gehorchen brauchten; diese beiden Nachkommen von Priestern aber (Hyrkanus und Aristobulus) suchten dem Volke eine andere Regierungsform aufzudrängen, um es in Sklaverei zu bringen“ (AJ 14,3,2 / 41). Damit wurde von einer politisch und religiös sehr konservativen Gruppe an das römische Traditions- und Rechtsverständnis appelliert; die Freiheit des Volkes erschien also in unauflöslicher Verbindung mit der Respektierung der „väterlichen Gesetze“, nach denen die politische Exekutive bei Hohepriestern, nicht bei Königen lag. Die Befürworter einer theokratischen Verfassung, die sich zugleich als antihasmonäische Opposition präsentierten, waren die Pharisäer.
Tatsächlich hatte Pompeius damals den Hyrkanus nur als Hohepriester eingesetzt und die Kompetenzen des Sanhedrin gestärkt, der verfassungsmäßigen Ratsversammlung des judäischen Gemeinwesens, des ethnos der Juden, dessen „Anführer“ mit dem Titel Ethnarches der Hohepriester herkömmlicherweise gewesen war. Unzweifelhaft war auch Hyrkanus als Hohepriester zugleich Ethnarch – sowohl 63 als auch 57.
Auf diesem Hintergrund überrascht es weder, dass der Rebell Alexander, der Sohn des Pharisäer-Feindes Aristobulus, das hasmonäische Königtum wiederherstellen wollte, noch dass Gabinius als Gefolgsmann des Pompeius gerade diejenigen Maßnahmen aus dem Jahr 63 verschärfte, die solches verhindern sollten: Die Leitungsfunktionen des Ethnarchen wurden durch die Einrichtung fünf regionaler Ratsversammlungen (Synhedrien) unterhalb des Sanhedrin dezentralisiert, die nichtjüdischen Städte durch Wiederbesiedlung und Wiederaufbau gefördert.
Zunächst bewährten sich die Maßnahmen des Gabinius. Wenn es auch in den nächsten Jahren noch zwei hasmonäische Rebellionen gegen das von Rom gestützte Regime des Hyrkanus gab, so scheiterten sie doch rasch: Sowohl der aus Rom geflohene Aristobulus mit seinem jüngeren Sohn Antigonus (56) als auch erneut Alexander (55) blieben ohne größeren Zulauf der Bevölkerung und auf wenige Festungen beschränkt. Gabinius, der wieder militärisch eingriff, wurde wie schon bisher aufs Zuverlässigste unterstützt von Antipater. Daher wird verständlich, dass der römische Statthalter abschließend die Situation in Judäa nach dessen Empfehlungen regelte, war doch der Idumäer der faktische Machthaber an der Seite des Hohepriesters und Ethnarchen. Während indessen der aufständische Aristobulus erneut als Kriegsgefangener nach Rom gebracht wurde, konnten seine Söhne im Lande bleiben. Es kam sogar ein Ausgleich mit Hyrkanus zustande, der keinen Sohn hatte und nun seine einzige Tochter Alexandra mit ihrem Cousin Alexander verheiratete.
Bevor Aulus Gabinius im Jahr 54 die Provinz Syrien seinem Nachfolger übergab und nach Rom zurückkehrte, hatte er mit zwei weiteren militärischen Unternehmungen zu tun gehabt, die einige Jahre später besondere Auswirkungen auf das Geschick Judäas zeitigten. Die eine Aktion führte Gabinius erfolgreich durch, nämlich die Wiedereinsetzung des Jahre zuvor gestürzten Königs Ptolemaios XII., des Vaters der ‘großen’ Kleopatra VII., auf seinen Thron in Alexandria. Auch hierbei hatte wieder Antipater wertvolle Hilfestellung geleistet, sowohl logistischer Art mit Waffen, Geld und Lebensmitteln als auch diplomatischer Art bei den ägyptischen Juden im Grenzgebiet von Pelusium. Die andere Unternehmung, einen großen Feldzug gegen die Parther, hatte Gabinius bereits im Beginn abgebrochen. Gegen einen entsprechenden Kriegsplan, wie er dem Pompeius und seinen Gefolgsleuten vorschwebte, gab es in Rom Bedenken und Einwände, nicht zuletzt weil man dort niemandem den einzigartigen Ruhm eines Sieges über Asien gönnen mochte. Den ehrgeizigen Feldzug gegen den jungen Partherkönig Orodes realisierte freilich 54 / 53 der Nachfolger des Gabinius in Syrien, Licinius Crassus, der dritte Mann im geheimen Bund zwischen Pompeius und Julius Caesar. Zum Entsetzen der Juden – und sicher auch des in einer solchen Situation hilflosen Hyrkanus – plünderte er zunächst den Jerusalemer Tempel, um den Partherkrieg finanziell abzusichern, und führte dann seine sieben Legionen nebst 4000 Reitern und zahlreichen Hilfstruppen in die Katastrophe bei Carrhae, wo er selbst in einem Hinterhalt das Leben verlor.
Als infolgedessen die Parther ihrerseits nach Syrien vorzudringen suchten, war es der tüchtige Quästor Cassius Longinus, der aus dem Desaster hatte fliehen können und die römische Provinz verteidigte. Er musste zudem gegen neu sich regenden Widerstand in Judäa einschreiten, wo die Widersacher des Hyrkanus die Römer als von Gott bestrafte Tempelfrevler betrachteten und das Marionettenregime abschütteln wollten. Bei Cassius stand der zuverlässige Antipater in hohem Ansehen, auf dessen Anraten ein gewisser Peitholaus hingerichtet wurde. Dieser, früher ein verbündeter jüdischer Söldnerführer und dann militärischer Befehlshaber in Jerusalem, war im Jahr 56 zu Aristobulus übergelaufen und hatte mit jenem offenbar auch weiterhin konspirativen Kontakt unterhalten.
Die römischen Autoritäten, die für die innere und äußere Sicherheit der Provinz Syrien einschließlich Judäas zu sorgen hatten, verließen sich auf die pragmatische Kooperation mit dem Idumäer Antipater, dem starken Mann des Hyrkanus-Regimes; beide Seiten waren in gewisser Weise aufeinander angewiesen. Nicht zufällig zählten Männer wie Scaurus, Gabinius und Cassius, der spätere Caesarmörder, zu den Gefolgsleuten des Pompeius, dem der hellenistische Osten seine Neuordnung und speziell Syrien die direkte römische Herrschaft zu danken hatte.
Falls es innerhalb der römischen Führungselite zu einem erneuten Machtkampf – etwa nach dem Beispiel des Bürgerkriegs unter Sulla – kommen sollte, dann verfügte Pompeius dank seines Netzwerkes im östlichen Mittelmeerraum über reichliche Ressourcen. Wer nämlich in sein politisches Monopol bei den dortigen Vasallenfürsten eindringen wollte, musste zunächst ein eigenes Loyalitätsgeflecht aufbauen, also gegen die etablierten Freunde des Pompeius in den Klientelstaaten jeweils personelle Alternativen unterstützen.
In der Tat brach ein solcher Bürgerkrieg zwischen Pompeius und Caesar im Frühjahr 50 aus und bot sogleich dem Hasmonäer Aristobulus mit seinen Söhnen eine Chance, die von Pompeius errichtete Friedensordnung in Judäa zu stürzen und die eigene Monarchie zu restaurieren. Mit Caesars Hilfe und mit zwei Legionen sollte er jetzt in die Heimat zurückkehren – doch Pompeius, selbst bereits nach Griechenland geflohen, sorgte durch Mittelsmänner für seine Ermordung. Indem Caesar die Einbalsamierung des Toten veranlasste, signalisierte er immerhin den Gegnern des Hyrkanus seine Sympathie, denn selbst der Leichnam des Ex-Königs stellte ein symbolträchtiges Argument für die künftige Legitimation eines von ihm lancierten Prätendenten dar. Dass dabei Caesar an Alexander, den Schwiegersohn des Hyrkanus, denken würde, lag auf der Hand, doch auch hier kam ihm Pompeius zuvor: Er wies den damaligen Statthalter Syriens Metellus Scipio – seinen Schwiegervater – an, den hasmonäischen Prinzen vor ein römisches Gericht zu stellen. Da es offenbar hinreichendes belastendes Material gab, wurde Alexander – zweifellos wegen Hochverrats – zum Tode verurteilt und umgehend in Antiocheia hingerichtet.
Indessen verlagerte sich der Bürgerkrieg auf Schauplätze im östlichen Mittelmeerraum. So hoffte Pompeius nach seiner Niederlage bei Pharsalos in Griechenland auf Unterstützung durch Ptolemaios XIII., dessen Vater Ptolemaios XII. erst wenige Jahre zuvor durch seine Gunst den Thron wiedererlangt hatte. Dann kam er nach Ägypten, wo er bei seiner Ankunft hinterhältig ermordet wurde. Auch sein Verfolger Caesar traf kurze Zeit später in Alexandria ein.
Hier tobte auch ein Bürgerkrieg, und zwar zwischen Ptolemaios XIII. und seiner Schwester Kleopatra VII. Aus dem Versuch Caesars, die Geschwister mit diplomatischem Zwang zu versöhnen, entstand in kürzester Zeit der Alexandrinische Krieg. Dabei geriet er in eine militärische Notlage, aus der ihn nur sein Verbündeter Mithridates von Pergamon erlöste, dessen Truppen freilich aus Kleinasien nur deshalb mit der erforderlichen Geschwindigkeit an der levantinischen Küste nach Süden vorrücken konnten, weil Antipater sie tatkräftig unterstützte. So war es einmal mehr der Idumäer, der aufgrund seines Verdienstes um einen römischen Feldherrn erwarten durfte, in seiner Machtstellung bestätigt zu werden.
Die moderne Geschichtsschreibung betont gern, dass sich Antipater ungeachtet der Dankbarkeit, die er dem Pompeius schuldete, der Gegenseite angedient habe.5 Eine derartige holzschnittartige Betrachtung verkennt, dass der Idumäer seine Entscheidungen in erster Linie an regionalen Risiken orientierte. Bedrohlicher und geographisch näher als der römische Bürgerkrieg waren in jenen Jahren die ptolemäischen Thronwirren. Unmittelbare Auswirkungen auf die machtstrategischen Konstellationen in Judäa waren insofern zu gewärtigen, als seit rund 100 Jahren die judäisch-hasmonäische Politik gelernt hatte, die innerptolemäischen und -seleukidischen sowie auch die ptolemäisch-seleukidischen Spannungen für die Erweiterung der eigenen Spielräume zu nutzen.
Eine kleine Vorstellung von den Schwierigkeiten, mit denen Antipater im Zusammenhang mit der Militärhilfe für Mithridates von Pergamon und damit für Caesar in Alexandria konfrontiert war, gibt der Bericht des Flavius Josephus: „Als aber nun (nachdem das belagerte Pelusium gefallen war) Antipater und Mithridates sich zu Caesar begeben wollten, hinderten die ägyptischen Juden, welche in dem nach Onias benannten Landstrich wohnten, sie daran. Antipater indessen beredete sie, ihre Landsleute nachzuahmen, indem er ihnen einen Brief des Hohepriesters Hyrkanus vorzeigte, worin dieser sie ermahnte, gegen Caesar sich freundlich zu benehmen und das Heer mit allem Notwendigen zu versehen. (Sie) gehorchten und veranlassten dadurch auch die Bewohner von Memphis, den Mithridates einzuladen, der dann auch alsbald dorthin zog und deren Unterwerfung annahm“ (AJ 14,8,1 / 131f.).
Es spielen also bei den hasmonäisch-ptolemäischen Beziehungen auch religiöse Gruppierungen eine Rolle, die ihre spezielle Protektion durch eine der rivalisierenden Parteien am Hof zu Alexandria respektive in Jerusalem erwarteten. Als schon bald nach dem Tode Ptolemaios’ XII. der ägyptische Bürgerkrieg begann, in den Caesar nicht zuletzt durch die Ermordung des Pompeius involviert wurde, favorisierten die ägyptischen Juden offenbar eine Alleinherrschaft von Ptolemaios XIII., wie sie zuletzt noch Pompeius akzeptiert hatte. Sie lehnten also die von Caesar gewünschte Wiederaufnahme der Kleopatra VII. in eine gemeinschaftliche Regierung der beiden Geschwister ab. Daher musste eine solche Herrschaft von vornherein auf römische Unterstützung angewiesen sein und Kleopatra selbst als Marionette der Römer gelten. Da die Juden in der Region von Heliopolis zu den romfeindlichen Kreisen im Ptolemäerreich zählten, sympathisierten sie mit denjenigen Kräften, die in Judäa auf den Sturz des Vasallenregimes und die Restauration des hasmonäischen Königtums hofften. Eine römische Niederlage konnte daher Antipater nicht wünschen; vielmehr musste er sein Arrangement mit demjenigen Feldherrn suchen, der die Oberhand im hellenistischen Osten und daher absolutes Interesse an dortiger Stabilität und Kontinuität hatte: also mit Julius Caesar.
„Als Caesar einige Zeit darauf den Krieg beendigte und nach Syrien hinüberschiffte, bewies er seinen Dank dadurch, dass er den Hyrkanus in der Hohepriesterwürde bestätigte, dem Antipater aber das römische Bürgerrecht verlieh und ihn von allen Abgaben befreite … Um dieselbe Zeit kam des Aristobulus Sohn Antigonus zu Caesar, beklagte das Schicksal seines Vaters, der um Caesars willen durch Gift habe umkommen müssen, und seines Bruders Alexander … und bat ihn, er möge sich doch seiner, da er aus dem Reich seines Vaters verbannt sei, erbarmen. Hyrkanus und Antipater, klagte er, führten eine gewalttätige Regierung und hätten ihm selbst Unrecht getan. Antipater aber, der gerade anwesend war, verteidigte sich gegen die Anklage. (Da) bestätigte Caesar den Hyrkanus als Hohepriester, gab dem Antipater jede gewünschte Machtbefugnis und ernannte ihn zum Landpfleger (Epitropos) von ganz Judäa“ (AJ 14,8,3 – 5 / 137 – 143).
Die Verteidigung Antipaters in Antiocheia gegen die Beschwerden des Antigonus schildert Flavius Josephus in seiner Geschichte des Jüdischen Krieges ganz dramatisch: „Da riss Antipater sein Gewand auf, zeigte seine zahlreichen Narben und erklärte, es bedürfe doch wohl keiner Worte, um seine gute Gesinnung gegen Caesar darzutun; denn wenn er auch schweige, so lege doch sein Leib lautes Zeugnis ab. Wundern aber müsse er sich über die Anmaßung des Antigonus, der als Sohn eines den Römern entlaufenen und denselben feindlich gesinnten Mannes an Neuerungssucht und Empörungsgeist nur das echte Ebenbild seines Vaters sei, und der sich jetzt unterfange, bei dem römischen Machthaber andere zu verklagen, während er doch froh sein könne, dass er überhaupt noch lebe. Denn nicht etwa aus Dürftigkeit wolle er jetzt teil an den Staatsgeschäften haben, sondern nur, um die Juden zum Aufruhr zu verleiten und seine Macht zum Schaden derer, die sie ihm verliehen, zu missbrauchen“ (BJ 1,10,2 / 197f.).
In dieser – vom Autor sehr frei gestalteten – Szene vor Caesar ist die gewählte Verteidigungsstrategie Antipaters in zweifacher Hinsicht aufschlussreich: Zum einen wird Antipater in eine illustre Reihe königlicher Freunde Roms gestellt, die schon im 2. Jahrhundert durch das Vorweisen der für Rom erduldeten Leiden die eigene Treue hervorgehoben hatten. Zum anderen wird ein bemerkenswertes Bild von Antigonus entworfen: Hatte der hasmonäische Prinz vorgebracht, dass Antipater und Hyrkanus ihn höchst widerrechtlich aus der Heimat vertrieben und „in frechem Übermut ihr Volk drangsaliert“ hätten (BJ 1 / 196), so charakterisierte Antipater ihn als den Sohn eines Umstürzlers und Romfeindes, der selbst nur darauf wartete, die Juden erneut zum Aufruhr zu treiben.
Damit ist das für die Entscheidung Caesars Wesentliche gesagt: Ein Vasallenfürst mag mit seinem Volk und seinen persönlichen Feinden umgehen, wie er will, so lange er die römische Friedensordnung nicht verletzt und der Tatsache eingedenk bleibt, dass er seine Macht von den Römern erhalten hat. Wer dagegen auf ein ererbtes Recht pocht und dabei erwarten lässt, dass er namens der Freiheit seines Volkes auch gegen die Vormacht agiert, der erfährt keinerlei Unterstützung durch Rom, auch nicht von einem Julius Caesar. Denn Rom akzeptierte keine Rechtsansprüche eines Prätendenten, die den eigenen Interessen entgegenliefen.