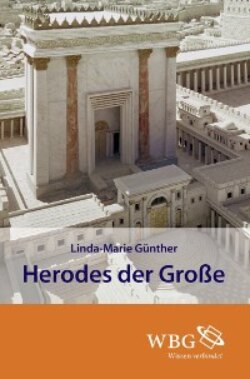Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 15
3. Hyrkanus und Antigonus – der Sturz der Romfreunde
ОглавлениеIm Jahre 53 hatte der römische Kriegszug gegen die Parther unter Licinius Crassus, dem ehrgeizigen dritten Mann neben Pompeius und Caesar, zur schweren militärischen Niederlage und zum blamablen Verlust der Feldzeichen bei Carrhae geführt. Seither plante jeder Feldherr, der die Ressourcen Asiens in seine Verfügungsgewalt bringen wollte oder zum Teil schon gebracht hatte, einen Revanchekrieg – so auch Marcus Antonius.8 Für seine Rüstungen trieb er von der provinzialen Bevölkerung sowie von den römischen Vasallenfürsten hohe Geldsummen ein – ähnlich wie es erst wenige Jahre zuvor (43 / 42) sein Gegner Cassius für den Kampf gegen die Caesarmörder gemacht und dadurch den Hass gegen sich und die Römer generell noch gesteigert hatte. Der einstige Verteidiger Syriens gegen die Parther hatte im Bürgerkrieg schließlich sogar auf militärische Hilfe des Partherkönigs Orodes gehofft und für entsprechende Verhandlungen seinen Legaten Labienus nach Ktesiphon geschickt. Wenn auch nach der Niederlage der Caesarmörder bei Philippi und dem Tod des Brutus und Cassius der Bürgerkrieg zugunsten von Marcus Antonius und Octavian entschieden war, so gaben doch gerade die „republikanischen Fanatiker“ nicht auf. Viele von ihnen hatten Zuflucht bei Orodes gefunden und unterstützen am Partherhof vehement die Idee eines Angriffs auf das römische Syrien. Im Herbst 41 war es so weit – die Invasion begann.
Die Unbeliebtheit der römischen Herrschaft in der Levante, also in Kleinasien, Syrien und insbesondere Judäa, und der ewig süße Klang, welchen die Freiheitsparolen in den Städten des hellenistischen Ostens hatten, bewirkten die nahezu widerstandslosen Erfolge der parthischen Truppen, die unter der Führung des Prinzen Pakoros und des Labienus Syrien eroberten. Während sich der letztgenannte sogleich nach Kleinasien wandte, rückte Pakoros an der Küste entlang nach Süden vor, wo nur Tyros, die eigensinnige Stadt, die einst Alexander dem Großen sieben Monate lang getrotzt hatte, dem Antonius und damit den Römern treu blieb.
Das Ziel dieser Truppen war der Sturz des romfreundlichen Hyrkanus-Regimes in Judäa. Bei Pakoros hatte sich nämlich der Hasmonäerprinz Antigonus eingefunden, der jetzt zusätzlich zu seinem griechischen Namen auch seinen jüdischen trug: Er nannte sich Mattathias, wie der Ahnherr der Makkabäerdynastie, auf welchen sich die Hasmonäer zurückführten.
Nach Flavius Josephus soll Antigonus den Parthern große Versprechungen dafür gemacht haben, dass sie ihn an Stelle seines Onkels Hyrkanus auf den Thron in Jerusalem brächten und seinen Erzgegner Herodes samt seiner Sippe töteten: 1000 Talente (26 Tonnen Silber) und 500 Frauen (natürlich solchen aus den Familien seiner Gegner). Zweifellos hatten Orodes und sein Sohn Pakoros mit Antigonus als ihrer Marionette längst gerechnet, um in ihrem künftigen Reichsteil westlich des Euphrat das eminente prorömische Bollwerk auszuschalten. Über die Notwendigkeit eines lokalen Herrschers in einem zumindest oberflächlich autonomen Judäa wussten die Parther sehr genau Bescheid, denn in ihrem Reich, insbesondere in Babylon, lebten seit nahezu einem halben Jahrtausend Juden und waren ihrerseits durch den Kultus mit dem Tempel zu Jerusalem und dem dortigen Hohepriester verbunden. Der Einfluss dieser babylonischen Juden auf die parthische Westpolitik lässt sich freilich nicht näher bestimmen.
Von Akko/Ptolemaïs aus schickte Pakoros eine Vorhut gegen Jerusalem, während vom Binnenlande her – also durch das Gebiet der mit Antigonus verschwägerten Herrscher von Chalkis, durch die Gegend um Damaskus und durch Galiläa – ein Heereszug unter dem Kommando eines gewissen Barzapharnes vorrückte, des Gouverneurs der parthischen Provinz westlich des Euphrat.
In Jerusalem hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Proteste gegen Herodes gegeben, die Bevölkerung stand auf Seiten der Parther und des Thronprätendenten, und wegen eines religiösen Festes strömten außerdem tausende Gläubige herbei, die dieselbe politische Ansicht hatten. Hyrkanus, Phasaël und Herodes waren auf den Königspalast beschränkt, wo sie zwar über starke Truppenverbände verfügten, einer Belagerung durch Pakoros und Barzapharnes aber unmöglich standhalten konnten. Von den Römern ist in dieser Situation nichts zu hören – wenn sich Herodes tatsächlich mit einem Hilferuf an Marcus Antonius gewandt haben sollte, erhielt er jedenfalls keine Antwort. Der Herr über den Osten hielt sich damals im Winter und Frühjahr 41 auf 40 in Alexandria auf und „interessierte sich mehr für Kleopatra als für den Kampf mit den Parthern“.9
Flavius Josephus berichtet über den folgenden Akt des Dramas vom Ende des Hyrkanus-Regimes detailliert, wie die Parther und Antigonus einen schlauen Plan entwickelten, um unter dem Vorwand von Verhandlungen ihrer Gegner persönlich habhaft zu werden, sie also aus dem befestigten Palast herauszulocken. Dazu sollten sich Hyrkanus, Phasaël und Herodes zu Barzapharnes nach Galiläa begeben – Herodes jedoch blieb misstrauisch und warnte seinen Bruder, jener Einladung zu folgen. Offenbar sah Phasaël aber keinen anderen Ausweg, als einen diplomatischen Versuch zu wagen – vielleicht ahnte er auch das Komplott und wollte durch den eigenen Opfergang dem dynamischeren Bruder eine Chance zur Flucht ermöglichen. Unser Autor weiß darüber freilich nichts, sondern stellt ihn als bis zum bitteren Ende loyal gegenüber dem alten Hohepriester dar. Während in Galiläa die beiden Männer zunächst höflich behandelt, dann aber doch verhaftet wurden, war Herodes in Jerusalem geblieben, ungeduldig Nachrichten von Phasaël erwartend. Als dessen Boten mit Warnungen über das Komplott abgefangen wurden, erkannte der Tetrarch, dass ihn nur die Flucht retten konnte, und wurde in dieser Einschätzung bestärkt durch die Tochter des Hyrkanus, seine künftige Schwiegermutter Alexandra.
Noch in derselben Nacht verließ er heimlich mit einem großen Tross – kaum weniger als 1000, möglicherweise sogar mehrere Tausend Personen – die Stadt, nämlich mit seinen Soldaten, Freunden und einer großen Anzahl zumal weiblicher Familienangehöriger und deren Dienerschaft.
Man kann nun zwar glauben, dass es die Unachtsamkeit seiner Gegner war, die das unbehelligte Entkommen ermöglichte, doch wird man bei nüchterner Überlegung annehmen dürfen, dass Herodes seine Flucht von längerer Hand vorbereitet hatte.
Damit fällt ein etwas anderes Licht auf die Gesandtschaftsreise von Hyrkanus und Phasaël ausgerechnet nach Galiläa. Möglicherweise hat Herodes hier ein diplomatisches Doppelspiel betrieben, sein eigenes Kommen zugesagt und dann den Bruder geschickt. Dass er selbst indessen die Verantwortung nicht nur für seine eigene Mutter, Schwester, Schwägerin, Neffen, sondern auch für die Hasmonäerfrauen Alexandra, Mariamne sowie deren Bruder Aristobul, den letzten männlichen Nachkommen dieser Familienlinie trug, lässt darauf schließen, dass Hyrkanus in den Fluchtplan als Notmaßnahme eingeweiht war.
Das Schicksal der beiden Männer, die nun von den Parthern dem Antigonus in Jerusalem vorgeführt wurden, schildert Flavius Josephus mit ausgesuchter Dramatik: Phasaël soll sich durch selbst zugefügte schwerste Kopfverletzungen getötet haben – unter Mithilfe des Arztes, der ihm noch geschickt wurde. Hyrkanus dagegen wurde an den Ohren verstümmelt, damit er nie wieder die Funktion des Hohepriesters ausüben konnte, für die körperliche Unversehrtheit kultische Vorschrift war.
Zu diesem Zeitpunkt war Antigonus bereits von seinen parthischen Freunden als Hohepriester und König inthronisiert worden und hatte sein Ziel erreicht. Den Hyrkanus schickte er dann an König Orodes nach Ktesiphon – aus den Augen, aus dem Sinn. Die Parther erhielten die Erlaubnis, Jerusalem und die Teile des Palastes, die von der Antipater-Familie bewohnt worden waren, zu plündern; allerdings fand sich dort nicht mehr der Familienschatz, denn auch in dieser Hinsicht hatten die Flüchtlinge bestens vorgesorgt!
Indessen war Herodes mit seinen Leuten unterwegs nach Idumäa, wo er in Thresa mit seinem jüngeren Bruder Joseph und weiteren Angehörigen zusammentraf. Jetzt wurde der größte Teil der Söldner – nach Flavius Josephus mehr als 9000 – entlassen, nur die tüchtigsten blieben im Dienst. Gemeinsam zog der Flüchtlingstross, noch immer rund 800 Personen, zur wehrhaften Bergfestung Masada, die für einen längeren Aufenthalt vorbereitet worden war. Herodes ließ seine Leute unter dem Schutz Josephs zurück und zog weiter, um militärische Hilfe gegen Antigonus zu organisieren.
Zwei Episoden der ersten Flucht-Etappe, von denen Flavius Josephus berichtet, sollen im Detail betrachtet werden, da sie Auskunft geben können über den Charakter des Herodes.
„Herodes … entfloh in der Nacht, ohne dass dies die Feinde gewahr wurden, mit seinen nächsten Angehörigen auf Idumaea zu. Kaum hatten die Parther dies erfahren, setzten sie ihm nach. Herodes ließ nun seine Mutter … (und die anderen Angehörigen) voraus ziehen, während er selbst mit seinen Kriegern zum Schutze seiner Verwandten die Barbaren aufhielt und bei jedem Angriff eine Menge von ihnen niedermachte. So erreichte er endlich wohlbehalten die Festung Masada. Mehr noch als die Parther machten ihm übrigens auf seiner Flucht die Juden zu schaffen, die ihn beständig bedrängten und ihm, als er 60 Stadien (10 Kilometer) von der Stadt entfernt war, sogar ein regelrechtes Treffen von ziemlich langer Dauer lieferten. Herodes aber schlug sie und richtete ein großes Gemetzel unter ihnen an. Später gründete er an dieser Stelle zum Andenken an den Sieg eine Ortschaft, die er mit den prächtigsten Palästen schmückte, durch eine sehr starke Burg befestigte und nach seinem Namen Herodium nannte“ (BJ 1,13,7 – 8 / 263 – 265).
Die Überreste der herodianischen Festung Herodeion, rund 10 Kilometer südlich von Jerusalem an der zu allen Zeiten strategisch wichtigen Straße nach Jericho, waren bis ins 19. und 20. Jahrhundert sichtbar. Archäologische Ausgrabungen seit 1962 haben auf dem Djebel Fureidis eine grandiose Palastfestung auf dem Berg sowie einen Palastkomplex an dessen Fuß ans Licht gebracht (siehe unten S. 192 f.). Da sich in Herodeion auch die Grabstätte des Herodes befand, gibt es keinen Zweifel an der außerordentlichen Bedeutung dieses Platzes. Dass sich für Herodes der Ort stets mit Erinnerungen an den Sieg über seine jüdischen Feinde verband, können wir gern glauben.
Schwieriger ist dagegen eine Geschichte einzuordnen, die von Flavius Josephus im selben Kontext der Ereignisse zu Beginn der Flucht erzählt wird und die vom Unfall der Mutter des Herodes handelt: Deren Wagen war umgestürzt, sie selbst schien schwer verletzt oder gar tot zu sein; durch den erzwungenen Aufenthalt verringerte sich der Vorsprung, den man vor den Verfolgern hatte – und in dieser Situation soll Herodes der totalen Verzweiflung nahe gewesen sein. Aber Kypros erholte sich dann doch recht schnell, so dass die Flucht fortgesetzt werden konnte. Bald darauf ereignete sich der Kampf mit den jüdischen Feinden.
Mit der kritischen Situation nach dem Unfall der Kypros soll nach Flavius Josephus noch etwas anderes verbunden gewesen sein, nämlich ein Selbstmordversuch des Herodes. War es ein „Anflug von Panik“ oder kann man den „plötzlichen Selbstmordversuch“ als „typisch für sein ganzes Wesen“ verstehen? Überlegungen, die hier über Herodes’ Depressivität und Aggressionspotential angestellt wurden,10 führen schon deswegen überhaupt nicht weiter, weil Erkenntnisse über das Psychogramm einer historischen Figur unmöglich sind. Interessanter ist die Frage, was der Autor mit der Szene zum Ausdruck bringen will.
Das damals bekannteste Beispiel für die nicht allzu seltene historische Situation, in der ein Machthaber in kritischer Lage mit Durchhalteparolen motiviert wurde, erzählt der Historiograph Diodor vom syrakusanischen Tyrannen Dionysios. Als dessen Herrschaft im Jahre 404 von einem Volksaufstand bedroht war, hinderte ihn ein Freund an einer schnellen Flucht, indem er ihn gemahnte, bis zum notfalls bitteren Ende Widerstand zu leisten.11 Der Bericht Diodors, eines Universalhistorikers der Zeit Caesars, ging auf Philistos zurück, der einst Hofgeschichtsschreiber des Dionysios gewesen war, so ähnlich wie bei König Herodes dann später Nikolaos von Damaskus. In seinem Werk hat offenbar Flavius Josephus die Szene nach dem älteren Beispiel gestaltet, dabei aber in freier Variation dem Unfall der Mutter des Helden eine besondere Rolle in der Inszenierung zugewiesen. Offenbar kam jenem Scharmützel später ein hoher Symbolwert zu – zu fragen bleibt, ob dies so ist, weil oder obgleich hier der Sieg nachdrücklich als einer über die jüdischen Gegner bezeichnet wird. Zunächst war ja die Flucht vor dem parthischen Feind eine gemeinsame Aktion mit der Hasmonäerfamilie, insbesondere soll die Initiative von Alexandra ausgegangen sein. Damit hätte der Ruhm, sich nicht passiv dem Schicksal ergeben, sondern durch beherzte Handlung letztlich doch die Herrschaft errungen zu haben, der Hasmonäerin gebührt, also Herodes’ Schwiegermutter. Wollte aber Herodes als derjenige in die Geschichte eingehen, der die Macht allein wieder gewonnen hatte, musste er in einer bedeutenderen, dramatischeren Situation das Entscheidende geleistet haben. Dazu bot es sich an, den militärischen Sieg ins Philosophische zu überhöhen und zugleich zu betonen, dass nicht die Parther, vor denen man hatte fliehen müssen, die größte Gefahr darstellten, sondern die Juden, die ihre mit Rom verbündeten Unterdrücker vertrieben.
Kurz: Die Episode, wie Herodes von seinen Freunden nur mühsam daran gehindert wurde, sich verzweifelt ins Schwert zu stürzen, ist nicht authentisch. Ein Unfall seiner Mutter mag sich zugetragen haben, ist aber kaum in einen direkten Zusammenhang zu bringen mit der demonstrativen Gründung von Herodeion am Ort der siegreichen Schlacht über die jüdischen Verfolger der Flüchtlinge.
Nachdem Herodes seine Familie und die seiner Braut Mariamne unter den Schutz einer Söldnertruppe und der Verantwortung seines Bruders Joseph auf der Bergfestung Masada in Sicherheit gebracht hatte, wandte er sich selbst zunächst an den nabatäischen König Malichus. Der schickte ihm recht bald eine Gesandtschaft mit der Botschaft, er möge auf der Stelle umkehren, denn die Parther hätten es den Nabatäern verboten, ihn bei sich aufzunehmen. „Herodes antwortete darauf, er sei nicht gekommen, um ihnen in irgendeiner Hinsicht lästig zu fallen, sondern nur, um sich mit dem König über einige dringende Angelegenheiten zu besprechen. Trotzdem schien es ihm geraten, umzukehren“ (AJ 14,14,1 / 373f.). Flavius Josephus lässt keinen Zweifel daran, dass Herodes von Malichus Geld erhofft hatte, und zwar an die 300 Talente Silber, und dass er diese Summe in den Freikauf seines Bruders Phasaël aus der Gewalt der Parther investieren wollte, da er von dessen Tod noch keine Nachricht gehabt habe. Malichus und einige arabische Scheichs in seinem Beraterstab hätten aber gerade wegen der erwarteten Geldforderung von einem Besuch des Flüchtlings nichts wissen wollen und die Parther nur als Vorwand gebraucht. Herodes habe nämlich berechtigte Ansprüche auf die Rückzahlung eines früheren, möglicherweise noch auf seinen Vater zurückgehenden Kredits gehabt, doch hätten die Araber „das ihnen anvertraute Gut unterschlagen“ (ebd.) wollen.
In der neueren Literatur wird die große Enttäuschung des Herodes über diese Abweisung herausgestellt,12 aber nicht hinterfragt, ob es dem Antipater-Sohn wirklich nur um ein Lösegeld für seinen Bruder gegangen ist, von dessen Tod er überhaupt erst ein oder zwei Tage nach der Absage des Malichus erfahren haben soll. Sehr viel plausibler ist es dagegen, dass Herodes von vornherein bei den Nabatäern, seinen bisher politisch stets kooperationsbereiten Nachbarn, militärische Unterstützung gegen den parthische Marionettenkönig auf dem Jerusalemer Thron suchte. Demnach gedachte er, bei ihnen größere Söldnerkontingente anzuwerben, nötigenfalls auch auf Kredit. Malichus und seine Scheichs wollten aber in der damaligen Situation allem Anschein nach das Risiko eines politischen Selbstmordkommandos gerade nicht eingehen: Zu überwältigend war die Dominanz der Parther bei gleichzeitiger auffällig reduzierter Präsenz der Römer im gesamten Gebiet westlich des Euphrats.
Die Nabatäer schoben also nicht etwa die Parther vor, um ungestört vom Guthaben der Antipater-Familie zu profitieren, sondern es war Herodes, der die Situation zu seinen Gunsten verschleierte, nämlich indem er den ungetreuen Nabatäern unlautere materielle Interessen, geradezu Unterschlagung, unterstellte, um damit seine späteren Rachegelüste zu kaschieren.
Nach der Abweisung durch die Nabatäer reiste Herodes nach Ägypten, wo er offenbar hoffte, Marcus Antonius anzutreffen. Als er an die Küste gelangte, wurde er im ägyptischen Grenzort Pelusium aufgehalten, wo sich wider Erwarten die im Hafen liegenden Schiffe weigerten, ihn nach Alexandria zu bringen. Herodes wandte sich daher an die Vorsteher der Stadt, „die aus Achtung vor dem berühmten und hochstehenden Mann ihn nach Alexandria geleiten ließen“ (AJ 14,14,2 / 375). Die konkrete Situation bleibt aus dem knappen Bericht bei Flavius Josephus unklar, doch ging es allem Anschein nach um den offiziellen Status des Reisenden, des einst von Antonius bevollmächtigten Tetrarchen in Judäa, den die Parther vertrieben hatten. Als indirekter römischer Funktionsträger verlangte Caius Julius Herodes in Pelusium, im Herrschaftsbereich der mit Rom verbündeten Königin Kleopatra VII., eine entsprechende Anerkennung seiner Würden: In Ägypten war er nicht nur vor Verfolgung durch Parther und Judäer sicher, hier durfte er vielmehr uneingeschränkte Unterstützung zur Befreiung seines Landes von den ‘Barbaren’ erwarten. Man darf annehmen, dass Herodes sich nach wie vor als Tetrarch Judäas verstand, nicht als bittstellender Flüchtling.
Von Königin Kleopatra VII. wurde Herodes jedenfalls „glänzend empfangen“, doch ließ er sich von ihr nicht „bereden, länger zu bleiben, weil er nach Rom eilen wollte“ (AJ 14,14,2 / 376); ohne Rücksicht auf den anbrechenden Winter mit seinen die Seefahrt beeinträchtigenden Stürmen reiste er sehr bald weiter. Flavius Josephus belässt es bei dem ungenauen Hinweis, Kleopatra habe Herodes „glänzend empfangen, weil sie an ihm einen Feldherrn für den Krieg, zu dem sie gerade rüstete, zu gewinnen hoffte. Herodes indes wies die Anträge der Königin zurück und schiffte sich … nach Rom ein“ (BJ 1,14,2 / 279).
Da die Herrschaft im Ptolemäerreich damals nicht in der Hand irgendeines Königs lag, sondern in derjenigen Kleopatras VII. und ihres Sohnes und Mitregenten Ptolemaios’ XV. Kaisar, ist die Phantasie der Historiker angesichts der Begegnung des Herodes mit der oft verleumdeten Herrscherin ins Kraut geschossen.13 Für eine nüchterne Bewertung der politischen Situation als dem Rahmen für das Zusammentreffen des Herodes mit Kleopatra im Spätherbst des Jahres 40, ist auf drei essentielle Punkte zu verweisen: Marcus Antonius plante bereits einen Partherfeldzug; die ptolemäische Königin gedachte diesen Krieg nach Kräften zu unterstützen und hoffte dabei, ihr Reich durch territoriale Zugeständnisse der Römer vergrößern zu können; Herodes suchte den direkten Kontakt mit Marcus Antonius, um mit römischer Hilfe die Parther – sowie zugleich deren Marionette Antigonus – aus Judäa zu vertreiben und dort selbst wieder als römischer Vasall die Macht zu übernehmen.
Was mag hinter dem von Flavius Josephus bezeugten Anerbieten Kleopatras VII. gestanden haben, den judäischen Exil-Tetrarchen mit einem militärischen Kommando – höchstwahrscheinlich gegen die Äthiopier – in ptolemäische Dienste zu nehmen? Wohl kaum mehr als die Absicht, von der Präsenz des Herodes, eines fähigen Feldherrn, für eigene militärische Ambitionen im Süden Ägyptens zu profitieren. Das Angebot eines längeren Aufenthaltes in Alexandria entsprach hellenistischer Gastfreundschaft – man stelle sich dagegen etwa vor, Kleopatra hätte ihren Staatsgast trotz des Winterbeginns schnellstens nach Rom weitergeschickt! Die kluge Herrscherin wird keinen Zweifel und auch keinen Widerspruch gehegt haben, dass Marcus Antonius den Idumäer für die Rückgewinnung Judäas von den Parthern benötigen würde, zumal es ihr nicht unbekannt geblieben sein konnte, dass die restliche hasmonäische Familie sich im Gewahrsam zu Masada, also in der Hand des Herodes und seines Bruders Joseph befand. Es konnte hinsichtlich der näheren politischen Zukunft Syriens und insbesondere Judäas zu jenem Zeitpunkt keine Interessenkollision zwischen dem Exil-Tetrarchen und Kleopatra geben.
Für Herodes kam indes ein militärischer Auftrag in Ägypten nicht in Frage: nicht nur wegen seines Wunsches, nach Rom weiterzureisen, sondern wegen seines hierarchischen Selbstverständnisses als römischer Funktionsträger in Judäa.
Die Interpretation des ersten Zusammentreffens von Herodes und Kleopatra VII. steht freilich ex eventu im Schatten des späteren Konfliktes beider Herrscherpersönlichkeiten, der unter ganz anderen politischen Rahmenbedingungen entstand, als sie im Jahre 40 existierten. Dennoch wird gelegentlich die spätere Feindseligkeit zwischen Ägypten und Judäa, die ihrerseits alte historische Wurzeln hatte, mit dem damaligen Aufenthalt des Herodes in Alexandria in Verbindung gebracht: Er habe es nämlich verstanden, „seine Absicht, sich um den Thron von Judäa in Rom zu bemühen, vor der Königin hinterlistig zu verbergen“; daher habe Kleopatra ihn mit „solch einer ausgesuchten Höflichkeit behandelt“, anstatt ihn – wenn sie seine Ambition gekannt hätte – „zweifellos ohne Zögern aus der Welt zu schaffen“.14
Davon abgesehen, dass Kleopatra sich ohnehin ihre eigenen Gedanken über Zweck und Ergebnis der bevorstehenden Begegnung des romtreuen judäischen Vasallen mit Antonius gemacht haben dürfte, ist doch die Prämisse der zitierten Vorstellung spekulativ, nämlich dass der Flüchtling mit der dezidierten Absicht nach Rom gereist wäre, sich zum König von Judäa bestallen zu lassen.