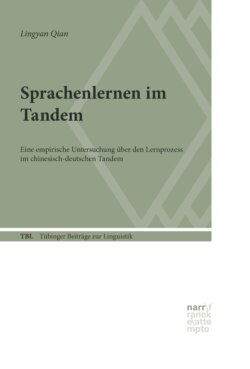Читать книгу Sprachenlernen im Tandem - Lingyan Qian - Страница 25
2.1.2 Konversationsanalyse in der Linguistik
ОглавлениеDie linguistische Forschungslage mit konversationsanalytischer Methode gestaltet sich heterogen. Es existieren mittlerweile zahlreiche Arbeiten, die sich mit Interaktionen und Gesprächen beschäftigen. Dazu gehören zuerst die gemeinsamen Veröffentlichungen von Sacks, Schegloff und Jefferson. Ihre bekannten Untersuchungen zur Sprecherwechselsystematik (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974), zu Präferenzstrukturen bei Reparaturen (Schegloff/Jefferson/Sacks 1977) und zur Organisation der Beendigungssequenzen (Schegloff/Sacks 1973) werden als „Klassiker“ der Konversationsanalyse betrachtet. Während die ersten Vertreter dieser Forschungsrichtung vor allem die Alltagsgespräche als Untersuchungsgegenstände heranziehen, rücken in der Weiterentwicklung des konversationsanalytischen Ansatzes auch Daten aus institutionellen Kontexten (z.B. Arzt-Patient-Gespräche, Unterrichtsinteraktionen, Eltern-Lehrer-Gespräche, Bewerbungsgespräche) in das Forschungsinteresse. Mit dieser Entwicklung beschränken sich die Untersuchungen nicht mehr nur auf allgemein gültige Eigenschaften der Gesprächspraktiken (wie Reparaturen, Korrekturen, Sprecherwechsel), sondern richten sich auf kontextspezifische Interaktionsaufgaben.
Um einen Überblick über die Rezeption der Konversationsanalyse in der Linguistik zu geben, werde ich im Folgenden ihre Anwendung in der sprachwissenschaftlichen Forschung nachzeichnen. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf den deutsch- und englischsprachigen Raum.
Konversationsanalytische Untersuchungen in der Linguistik finden sich nach Deppermann (2008) vorwiegend in folgenden Forschungsbereichen:
(1) Untersuchung der Gesprächspraktiken
Dazu zählen zahlreiche Auseinandersetzungen mit z.B. Sprecherwechsel (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974), Korrekturen (Schegloff/Jefferson/Sacks 1977), Prosodie (Couper-Kuhlen/Selting 1996), Eröffnungssequenzen (Schegloff 1972) usw.
(2) Erforschung der kommunikativen Gattungen
In Anbindung an das ethnographische Kontextwissen befasst man sich hierbei mit viel größeren Kommunikationseinheiten als Gesprächspraktiken. Dabei wird neben der Struktur eine Menge von relevanten Komponenten (wie lexiko-semantisch, stilistisch, prosodisch) untersucht. Zu diesem Bereich gehören z.B. Forschungen über Klatschgespräche (Bergmann 1987), Vorwurfsaktivitäten (Günthner 2000c), Bewerbungsgespräche (Birkner 2001).
(3) Untersuchung der Bewältigung von Interaktionsproblemen und -aufgaben
Dieser Forschungsbereich zeichnet sich durch seine funktionale Analyse aus. Das heißt, im Gegensatz zu den beiden obengenannten Gebieten geht man hier nicht von den Gesprächssequenzen aus. Vielmehr liegt das Ziel darin, die grundlegenden Interaktionsaufgaben anhand der Daten zu rekonstruieren und anschließend Ressourcen für die Bewältigung der kommunikativen Aufgaben oder Probleme zu finden, z.B. Verhandlung von Glaubwürdigkeit in Streitgesprächen (Deppermann 1997).
(4) Kommunikationsportraits sozialer Gruppen und Milieus
Die Konversationsanalyse kann ein Ausgangspunkt für die Forschung der Handlungstypen bestimmter sozialer Gruppen und Milieus sein. Mit der Rekonstruktion der Kommunikationsstile und -regeln sowie der Gesprächsthemen wird ein Grundstein für eine umfassende und zuweilen langjährige Kulturanalyse eines Handlungsfeldes gelegt. Die Studien von Keim (1995) und Schwitalla (1995) über kommunikative Stilistik jugendlicher Migrantengruppen in Mannheim lassen sich beispielsweise dieser Forschungsrichtung zuordnen.
(5) Institutionelle Kommunikation
Im Laufe der Jahre hat sich das konversationsanalytische Interesse an Interaktionen im institutionellen Kontext verstärkt. Während in Alltagsgesprächen hauptsächlich generelle Prinzipien der Interaktion (wie Sprecherwechsel, Themenorganisationen, Reparaturen) als Untersuchungsgegenstände im Vordergrund stehen, werden in institutioneller Kommunikation typische Gesprächspraktiken, die für die kontextspezifischen Aufgaben konstitutiv sind, erforscht. In dem von Drew und Heritage (1992) herausgegebenen Sammelwerk zum Thema „Talk at work“ handelt es sich z.B. speziell um die institutionelle Dimension und ihren Zusammenhang mit den Details der Interaktionsorganisation. Weitere Studien von z.B. Drew/Sorjonen (1997), Heritage (1997) zählen gleichwohl zu diesem Forschungsgebiet.