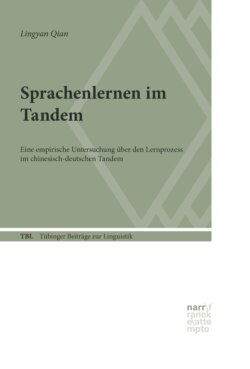Читать книгу Sprachenlernen im Tandem - Lingyan Qian - Страница 38
3.3 Unterrichtsinteraktion
ОглавлениеAnders als alltägliche Gespräche ist die Unterrichtsinteraktion der institutionellen Gattung zuzuordnen. Jedoch wurde Unterrichtsinteraktion lange Zeit von Forschern im Bereich des Spracherwerbs als „excessively complex, heterogenous and a particularly messy source of data“ (Seedhouse 2009: 12) betrachtet. Bevor Long (u.a. Chaudron, Doherty, Pica, Young) in den 80er Jahren die Interaktions-Hypothese in der Zweitspracherwerbsforschung entwickelte, richtete sich die Untersuchung des Sprachenlernens im Unterricht hauptsächlich auf das einseitige sprachliche Verhalten, entweder vonseiten des Lehrers oder des Lerners. Aufgrund der Interaktions-Hypothse führt Henrici (1995) eine Studie über den Spracherwerb durch Interaktion durch. Diskursanalytisch untersucht er die Interaktion zwischen dem Lehrer und dem Lerner beim institutionellen Spracherwerb. Die Fragestellung seiner Untersuchung besteht aber darin, welche Rolle die Interaktion beim Spracherwerb spielt. Die sprachliche Organisation im Unterricht wird nicht systematisch erfasst.
Eine der wichtigsten Studien über die systematische Organisation des Fremdsprachenunterrichts stellt die sprachwissenschaftlich orientierte Forschung von Seedhouse (2004) dar. In seiner Forschung wird der Frage nachgegangen, wie die Interaktion im Zweitsprachenunterricht organisiert wird. Anhand transkribierter empirischer Daten im Unterricht untersucht er den Forschungsgegenstand konversationsanalytisch.
Da Seedhouse davon ausgeht, dass in der Konversationsanalyse die Organisation der institutionellen Interaktion „rationally“ (Seedhouse 2009: 1) von dem Hauptziel abgeleitet wird, stellt er in seiner Forschung zuerst fest, dass „the teacher will teach the learners the L2“ (Seedhouse 2009: 1) das Kernziel des Fremdsprachenunterrichts darstellt. Aufgrund dieses Ziels weist er zusammenfassend auf drei allgemeine Charakteristika der Interaktion im Fremdsprachenunterricht hin. Erstens gilt die Sprache hier sowohl als das Mittel wie auch als das Objekt des Unterrichts. Darüber hinaus zeichnet sich solche Unterrichtsinteraktion durch eine Interdependenz zwischen Pädagogik und Interaktion aus. Diese Beziehung kann man an den sprachlichen Verhaltensweisen der Interagierenden beobachten. Schließlich sind die sprachlichen Formen und Interaktionen, die die Lerner produzieren, potenziell häufig der Evaluation des Lehrers unterworfen.
In diesem Zusammenhang sieht Seedhouse (2004) drei zentrale Elemente bei der Organisation der Interaktion im Fremdsprachenunterricht. Seiner Meinung nach sollte zuerst ein sogenannter „pedagogical focus“ (Seedhouse 2004) vorgestellt werden. In seinen empirischen Daten wird das vorwiegend von der Lehrperson beim Unterrichtseinstieg eingeführt. Die Einleitung des pädagogischen Fokus durch Vorschläge der Schüler ist aber nicht auszuschließen. Die daraufhin folgende Interaktion zwischen mindestens zwei Interagierenden orientiert sich dann an diesem pädagogischen Fokus. Schließlich spielt die Beziehung zwischen dem pädagogischen Fokus und der Interaktion bei der Durchführung der Unterrichtspraxis eine bedeutende Rolle. Seedhouse (2004) weist darauf hin, dass die Interagierenden nach der Wahrnehmung des pädagogischen Fokusses ihre sprachlichen Verhaltensweisen so gestalten, dass sie das Ziel des Unterrichts erreichen können. Die anderen Lerner, die im Klassenzimmer sind und nicht an der sprachlichen Interaktion teilnehmen, interpretieren das pädagogische Ziel und produzieren ihre Redebeiträge in Orientierung daran, wenn sie sich an der Interaktion beteiligen.
Ausgendend von diesen zentralen Organisationskomponenten der Unterrichtsinteraktion differenziert Seedhouse (2004) anhand seiner transkribierten Daten folgende Kontexte im Fremdsprachenunterricht:
Kontext 1: Form und Exaktheit
Kontext 2: Bedeutung und Fluss
Kontext 3: aufgabenorientiert
Kontext 4: prozedural
Die Diffenrenzierung der verschiedenen Kontexte im Fremdsprachenunterricht verdeutlicht zugleich, dass es hier um unterschiedliche pädagogische Fokusse geht. In Kontext 1 handelt es sich z.B. um die sprachliche Form, während Kontext 2 sich auf die Bedeutung konzentriert. Der Schwerpunkt des dritten Kontextes besteht darin, dass sich die sprachlichen Handlungen der Interagierenden an den vorgegebenen Aufgaben orientieren. Der letzte Kontext richtet sich auf den prozeduralen Verlauf.
Seedhouse (2004) analysiert danach die sprachlichen Verhaltensweisen der Lerner und des Lehrers im Hinblick auf die Organisation der Interaktion in den jeweiligen oben genannten Kontexten. Bezogen auf die Lehr-Lern-Sequenzen in Unterrichtsinteraktionen wird in seinen Befunden hauptsächlich die Beziehung zwischen dem pädagogischen Fokus und der Organisation der Interaktion dargestellt. Aus seiner Untersuchung zieht er die Schlussfolgerung, dass die Organisation der Interaktion im Rahmen des pädagogischen Fokusses realisiert wird. Wenn der pädagogische Fokus verändert wird, wird sich die Interaktionsgestaltung im Unterricht ändern.
Im Kontext von Form und Exaktheit ist z.B. strenge Kontrolle des Lehrers zu beobachten. Die Interaktion besteht häufig aus „Paarsequenzen“ (adjacency pairs, Schegloff/Sacks 1973) der Aufforderung des Lehrers und der Produktion des Schülers. Im Anschluss daran kommt es zur Evaluation und den darauf folgenden Aktivitäten.
Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Organisation der Interaktion im zweiten Kontext, in dem die Bedeutung auf dem pädagogischen Fokus liegt, eher auf die Formulierung des Inhalts. Probleme auf der Ebene der sprachlichen Form werden deutlich weniger korrigiert. Das Ziel des Lehrers liegt darin, dass das Thema eines Lerners von allen anderen verstanden wird. Der Fluss des Sprechens wird daher beachtet.
Im aufgabenorientierten Kontext steht die Erledigung der Aufgabe im Mittelpunkt. Die Interagierenden setzen dafür unterschiedliche Kommunikationsstrategien ein. Hier spielen die sprachliche Form im Kontext 1 und das Thema im Kontext 2 keine wichtige Rolle. Der Fokus liegt auf der Aufgabe.
Im Unterricht ist in der Regel der prozedurale Kontext obligatorisch. Der Lehrer vermittelt prozedurale Informationen in Bezug auf Unterrichtsaktivitäten an die Lerner. Bei Seedhouses (2004) Daten läuft das meistens monologisch. Sprecherwechsel sind dabei kaum zu beobachten. Diese Organisation der Unterrichtsinteraktion steht eben in Zusammenhang mit dem entsprechenden pädagogischen Fokus.
Neben der Analyse des Sprecherwechsels in einer Unterrichtsinteraktion mit unterschiedlichen pädagogischen Fokussen untersucht Seedhouse (2004) die Reparatur, eine Problemlösungsaktivität (Schegloff/Jefferson/Sacks 1977), durch die sich die Unterrichtsinteraktion auszeichnet. Seedhouse kommt zu folgenden Ergebnissen:
Im Kontext mit dem pädagogischen Fokus von Form und Exaktheit wird eine genaue linguistische Form angestrebt. Sprachliche Äußerungen des Lerners, die der Erwartung des Lehrers nicht entsprechen, können von dem Lehrer als reparaturbedürftig betrachtet werden. Das heißt, auch wenn die Äußerungen des Lerners grammatisch richtig sind, können sie repariert werden.
Dagegen werden problematische Formulierungen auf der linguistischen Ebene im Kontext von Bedeutung und Fluss häufig unkommentiert gelassen. Anstelle der sprachlichen Form steht hier die Bedeutungsaushandlung im Mittelpunkt. In der Regel wird eine Reparatur eingesetzt, wenn die Kommunikation gestört wird. Problematische sprachliche Formen stellen nicht unbedingt die Hindernisse beim Sprechen dar. Zuweilen ist in diesem Kontext auch eine Mischung von verschiedenen Reparaturtypen zu beobachten (Seedhouse 2004: 158).
Im aufgabenorientierten Kontext werden Stellen, die die Erledigung der vorgegebenen Aufgabe behindern, als reparaturbedürftig definiert. Seedhouse (2004) findet in seinen Daten keinen einzigen Beleg, in dem die Interagierenden die problematische sprachliche Form korrigieren. Ihre Sprechhandlungen orientieren sich an der Erledigung der Aufgaben.
Seedhouse (2004) stellt aufgrund der empirischen Untersuchung die Organisation der Interaktion im Fremdsprachenunterricht dar. Dabei zeigt er auf, dass die reflexive Beziehung zwischen dem pädagogischen Fokus und der Unterrichtsinteraktion die Grundlage für die Interaktionsgestaltung ist.