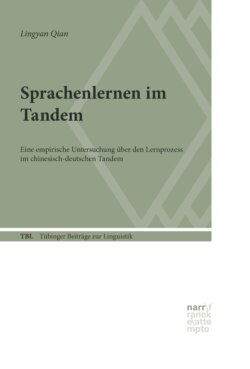Читать книгу Sprachenlernen im Tandem - Lingyan Qian - Страница 28
2.1.3.2 Besonderheiten der MS-NMS-Kommunikation
ОглавлениеWas die Kennzeichen der Kommunikation zwischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern angeht, beziehen sie sich in der sprachwissenschaftlichen Forschung mit konversationsanalytischer Methode vor allem auf die muttersprachliche angepasste Sprechweise gegenüber nicht kompetenten Ausländern und die spezifischen Sequenzen, die in der MS-NMS-Kommunikation oft zur Beseitigung sprachlicher Probleme oder Missverständnisse eingesetzt werden.
Die angepasste Sprechweise zeichnet sich durch simplifizierte Syntax, langsame Aussprache, Wiederholungen und reduzierte Modalität aus. Hinnenkamp (1982) untersucht z.B. dieses besondere Register anhand von 54 Aufnahmen von Konversationen zwischen 51 unterschiedlichen deutschen und elf türkischen Gesprächspartnern. Unter Gesichtspunkten von Lexikon, Morphologie, Syntax, Paralinguistik arbeitet er im interaktionalen Kontext zahlreiche Merkmale von dem sogenannten „foreigner talk“ (Ferguson 1975) heraus.
In Fortführung an Hinnenkamp nimmt Roche (1989) mit seinem Datenkorpus eine weitgehende Studie zur muttersprachlichen Sprechweise in Interaktion mit nichtmuttersprachlichen Gesprächspartnern vor. Sein Korpus umfasst insgesamt ca. 720 Minuten Tonbandaufnahmen von 86 Interaktionen zwischen insgesamt 66 deutschen und dreizehn ausländischen Gesprächspartnern aus vier verschiedenen Aufnahmesituationen. Konkrekt analysiert er Äußerungsstruktur, personale Referenz, Ausdruck der Temporalität, lokale Referenz, Skopusstrukturierungen und lexikalisch-semantische Simplifizierungen des Gegenstandes. Nach Roche (1989) verfolgen die Muttersprachler in diesem Kontext eine „themenbezogene und adressatengerichtete Veränderungsstrategie“ (Roche 1989: 178). Das heißt, sie modifizieren ihre Sprechweise nach der inhaltlichen Relevanz des Mitteilungsgehalts und dem Sprachniveau der Nichtmuttersprachler. Je höher die inhaltliche Relevanz, desto stärker ist die Modifikation.
Bezogen auf den Lerneffekt vom „foreigner talk“ für den Zweitspracherwerb sind sich Hinnenkamp (1982) und Roche (1989) jedoch nicht einig. Während Hinnenkamp (1982) das Schwanken zwischen verschiedenen Grammatiken und mitunter Sprachtypen als „eine nicht zu unterschätzende zusätzliche Erschwernis“ (Hinnenkamp 1982: 188) für das Sprachenlernen betrachtet, liefert Roche (1989) in seiner Studie dagegen Ansatzpunkte, dass durch den „foreigner talk“ der Lerner einer Zweitsprache größere Fortschritte erzielen kann.
Kotthoff (1991) analysiert die spezifische Sprechweise der Muttersprachler aus gesprächsstilistischer Perspektive. Ihre Daten basieren auf jeweils acht deutschen und acht anglo-amerikanischen Dialogen und auf 16 interkulturellen deutsch-englischen Gesprächen zwischen Studierenden und Lehrenden an einer deutschen Universität. In den aufgezeichneten Daten geht es darum, dass die Studierenden zu den Dozenten in die Sprechstunde gehen und sie um ihre Unterschrift unter eine fiktive, hochschulpolitische Petition bitten. Konkret beschäftigt sich die Forscherin in ihrer Konversationsanalyse mit Zugeständnissen und Dissens. Mit ihren Daten ist es möglich, die beiden Untersuchungsschwerpunkte jeweils in deutschen, anglo-amerikanischen und MS-NMS-Gesprächen zu erforschen und miteinander zu vergleichen.
In ihrer Untersuchung zeigt sich, dass die muttersprachlichen Sprecher gesprächsstilistische Anpassungen an die Lernerpragmatik einsetzen. Diese lassen sich hauptsächlich unter drei Aspekten darstellen. Erstens verwenden sie Paraphrasen, um die Bedeutung des Gesagten den nichtmuttersprachlichen Studierenden zu erklären. Die muttersprachlichen Dozenten verbringen viel Zeit, ihre Positionen gegenüber der Petition darzulegen. In den transkribierten Daten sind häufig mehrere Paraphrasensequenzen zu sehen. Zweitens geht es um die Gesprächsbeendigung. Im Vergleich zu den rein muttersprachlichen Konversationen in dem Korpus, wo in der Gesprächsbeendigungsphase oft Unterstützungen oder Erfolgswünsche produziert werden, sind in der Kommunikation mit nicht kompetenten Sprechern wenige solcher Beziehungsaktivitäten zu beobachten. Das Gespräch wird häufig abrupt abgeschlossen. Besonders auffallend ist, dass die amerikanischen Sprachlerner gegenüber den muttersprachlichen Dozenten kaum ausgedehnte Beziehungsaktivitäten (z.B. mehrmals Danksagungen) produzieren, wie sie in rein amerikanischen Gesprächen häufig vorkommen. Nach Kotthoff (1991) handelt es sich hier um die Anpassung seitens der nichtmuttersprachlichen Lerner. Sie weist darauf hin, dass die Lerner und die Muttersprachler gemeinsam eine „reduzierte Pragmatik“ (Kotthoff 1991: 391) produzieren. Während die Muttersprachler ihre Sprechweise nach dem Stil der Lernenden modifizieren, passen sich die Lernenden wiederum an die Muttersprachler an. Drittens weist Kotthoff (1991) darauf hin, dass sich die muttersprachliche Anpassung stärker im Bereich der Unschärfeindikation als der Schärfeindikation zeigt. Mit Unschärfeindikation sind Redemittel wie z.B. Modalpartikel, die die Vagheit mindern können, gemeint. Unter Schärfeindikation versteht man verstärkende Redemittel wie „überhaupt“, „wirklich“ und „durchaus“. Kotthoff (1991) zufolge geht die muttersprachliche Anpassung eher in Richtung der Unschärfeindikation, während die verstärkenden Redemittel vermutlich wegen ihrer klarheitsfördernden Funktion gegenüber den ausländischen Studierenden kaum reduziert werden.
Das von Elisabeth Gülich und Ulrich Dausendschön-Gay geleitete Projekt „Kontaktsituationen“ der Universität Bielefeld in den 1980er Jahren behandelt die spezifischen Sequenzen zur Beseitigung sprachlicher Probleme oder Missverständnisse. Ihre Daten bestehen aus Aufnahmen von natürlichen, authentischen Kommunikationssituationen. Ausgehend davon, dass „Gesprächspartner verschiedener Muttersprachen in natürlichen Interaktionssituationen über bestimmte Verfahren oder Strategien verfügen, mit deren Hilfe sie eine Verständigung auch bei reduzierter Kompetenz eines Partners in der Kommunikationssprache erreichen“, (Dausendschön-Gay 1987: 61) entstehen in diesem Forschungsprojekt mehrere ethnomethodologische konversationsanalytische Untersuchungen über z.B. Reparaturhandlungen, Erklärungsprozesse, Missverständnisse, metadiskursive Handlungen und Redebewertungen. Mit der Konversationsanalyse verdeutlicht man, wie und in welchem Ausmaß solche besonderen Strategien in erschwerten Situationen in MS-NMS-Kommunikation eingesetzt werden. Obwohl Aussagen über den Lerneffekt durch diese Strategien wegen der Struktur des Datenmaterials nicht erwartbar sind, weist Dausendschön-Gay (1987) doch darauf hin, dass der Einsatz solcher Aktivitäten der Gesprächsteilnehmer (wie Wortsuchprozesse) als „wichtige Teile eines systematisch ablaufenden Erwerbsprozesses“ (Dausendschön-Gay 1987: 77) zu interpretieren ist.