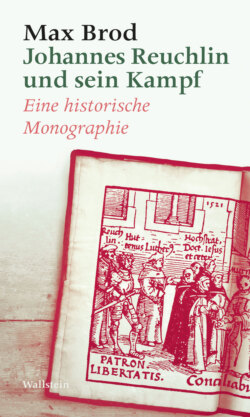Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 11
5
ОглавлениеRabelaishaft also ging es zu, als die Renaissance ihren Höhepunkt erreicht hatte und schon drauf und dran war, in Manierismus und Barock umzuschlagen. Der maßvolle Humanismus hatte sich für eine knapp bemessene Weile durchgesetzt, jetzt räumte er wieder der ›rabies theologorum‹ das Feld, dem Wüten von Reformation und Gegenreformation mit ihren neuerdings sich verengenden Himmelsgewölben, unter denen Europa sein kostbarstes Blut in Bächen zu vergießen begann. Erasmus von Rotterdam hatte diese Katastrophe vorausgesehen – doch aus der Art, wie er sie abzuwenden suchte, aus den völlig unzulänglichen Gegenmaßnahmen, die er vorschlug (vgl. Friedrich Heers Einleitung zu seiner Anthologie ›Erasmus‹, über den Fürstenspiegel für den jungen Kaiser Karl V. et passim) scheint mir mehr des Erasmus ängstliche Vorsicht hervorzugehen, sein »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß«, als echte Menschenliebe. Sein Bestreben war, die dominierende Stellung als Autorität in allen Kulturfragen beizubehalten und gleichzeitig der persönlichen Gefahr auszuweichen, – aus diesem Grund, nicht aus Milde und wirklicher Friedensfreundschaft wollte er neutral dastehen. Denn wo er über einen Wehrlosen, Abgetakelten herfallen konnte (wie über den armen Hutten), tat er es gar nicht mild, sondern mit zerfleischendem Haß, rücksichtslos. Aber klug war er, sehr klug. Und es bleibt ihm der Ruhm, das Unheil vorhergesagt und, sei es auch mit dünner Stimme, unermüdlich gewarnt zu haben.
Mit der Höchstschätzung eines natürlichen Lebens hatte der italienische Humanismus begonnen, hatte stillen Einspruch gegen das Zwangsgefüge der allmächtigen Kirche erhoben. Laurentius Valla stellte das Recht der Natur über alles. Das ist nicht das »secundum naturam vivere« (»der Natur gemäß leben«), das die Stoiker verkündeten. Es ist mehr. »Idem est enim natura quod deus«, sagt Valla, ein seltsames Vorspiel zu der viel späteren Lehre Spinozas, aber offenbar weniger radikal gemeint, denn vorsichtig setzt der als politischer antipäpstlicher Revolutionär verschriene Valla hinzu »aut fere idem«. (»Denn dasselbe ist die Natur wie Gott – oder beinahe dasselbe«.) Und Valla lehnt zwar die bei den Christen von alters her beliebte Tugend- und Pflichtenlehre der Stoa ab, denn des Menschen sinnliche Natur verlange nach Lust und Glück. Aber er mündet dennoch in eine quasi-christliche Doktrin: Aller Epikureismus, den er gegen die Stoa ausspielt, genüge nicht, uns Glückseligkeit, unser höchstes Gut, zu verschaffen. Die wahre Lust ist im irdischen Leben nicht zu erreichen, sondern nur in der ewigen Seligkeit, im Glauben. – So verläßt auch dieser am weitesten Vorprellende, der Klarsichtigste unter den Zeitgenossen, der Übersetzer der Ilias und des Thukydides, der Polemiker gegen die Echtheit der ›Konstantinischen Schenkung‹, dessen bahnbrechende Schrift für Hutten so entscheidende Bedeutung gewann, verläßt durchaus nicht das religiöse Fundament. Nur Machiavelli wurde wirklich zum Helden, mit all den fürchterlichen Konsequenzen, die aus der Sprengung sämtlicher sittlichen Bindungen (vom exzessiven und zum Absolutum erklärten Patriotismus abgesehen) mit mechanischer Grausamkeit hervorgehen mußten.
Bei allen andern trieben christliche und heidnische Bestandstücke des Denkens mit einer uns heute seltsam berührenden Unbefangenheit bunt durcheinander herum. Allerdings ist diese Vermischung, oberflächlich gesehen, nur eine Modesache des literarischen Stils, – doch »der Stil ist der Mensch«, ohne tiefe innere Erschütterungen wäre es nie zu diesen gelegentlich konventionell anmutenden Manierismen des Ausdrucks gekommen, der die Gegenpole mischte. Wenn Boccaccio darlegen will, daß er seine verehrte Maria Fiametta zum erstenmal in der San-Lorenzo-Kirche in Neapel gesehen hat, so nimmt sein Bericht die folgende Gestalt an: »Es geschah an einem Tage, dessen erste Stunde Saturn beherrschte, an dem Phoebus mit seinen Rossen den sechzehnten Grad des himmlischen Widders erreichte, als ich in Neapel einen Tempel betrat, nach jenem benannt, der sich auf dem Rost verbrennen ließ, um unter die Götter versetzt zu werden.« – Und Enea Piccolomini schreibt einmal über den »fromm-heiligen« Papst Nikolaus, daß dieser gewiß im Paradies »mit Christus und dem alleinigen Gott Nektar schlürfe«. – Es geschah daher nur im Übermaß polemischen Eifers, daß der ehrliche Reuchlin einem Gegner, der ihn allerdings bis aufs Blut gereizt hatte, den verketzernden Vorwurf machte, dieser Gegner habe von der Jungfrau Maria als von »Jovis alma parens« (»Jupiters, d. h. Gottes erhabene Gebärerin«) geschrieben, – eine Metapher, die durchaus im Stile der Zeit lag und nur dann etwas Anstößiges gehabt hätte, wenn man diesem Stil abschwor (was Reuchlin gewiß nicht wünschte und was er auch persönlich nicht praktiziert hat).
Daß die genauere Bekanntschaft mit der griechisch-römischen und hebräischen Denkart (Kabbala) die ernste Folge gehabt hat, das Joch der uniformen kirchlichen Oberherrschaft zu lockern: darin lag die entscheidende Wendung des humanistischen Abschnitts innerhalb der Renaissancebewegung. Nur durch die Erleichterung, die die Herzen und Sinne infolge dieser Lockerung spürten, ist das ungeheure Lachen zu erklären, das von dem zentralen literarischen Ereignis in jener Zeit ausgelöst wurde, von den ›Dunkelmännerbriefen‹. Denn der Witz in diesen, zugegebenermaßen recht geschickt gemachten ›Briefen‹ ist so dürftig, daß er allein das gewaltige Lachen und die Befreiung, die von ihm ausging, nicht zu rechtfertigen vermag. Man lachte nicht über die primitiven Witze, sondern darüber, daß es plötzlich »eine Lust war, zu leben«. Es war ein politisches Lachen, eine Art Kriegs- oder Trotzlachen, ein quasi-programmatisches Lachen aus endlich befriedigtem Haßgefühl. Ich gestehe offen, daß ich nicht mitlachen kann, daß mich die Lektüre dieser berühmten ›Briefe‹ ihrer Witzlosigkeit wegen immer nur melancholisch gestimmt hat, sooft ich zu ihnen griff. Und dabei lache ich gern und gut. Ich wüßte nicht, daß ich dem noch so hanebüchenen Humor bei Chaucer, bei Rabelais, im Don Quixote, in den besseren Geschichten des Boccaccio irgend etwas an Dienstwilligkeit schuldig geblieben wäre. Bei den ›epistolae obscurorum virorum‹ aber versage ich, obwohl ich durch so gute Autoren wie D. F. Strauß, Ludwig Geiger, Walther Brecht Unterweisung über die spezifische Art der Komik dieser ›Briefe‹ empfangen habe. Das Ergebnis: ich lache nicht, – aber ich weiß doch oder glaube zumindest zu wissen, warum die andern, die Zeitgenossen der Umwälzung, gelacht haben. – Das ist wohl auch etwas wert.