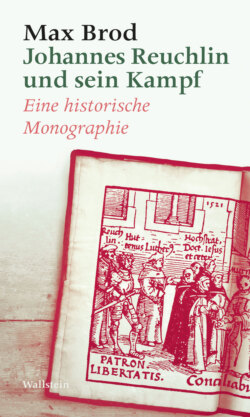Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 20
3
ОглавлениеMan hat in letzter Zeit versucht, den Einfluß, den Pico auf Reuchlin gehabt hat, als geringer, dafür den Einfluß des Nikolaus von Cues (Cusanus), der ja allerdings der philosophisch weitaus wichtigste von den dreien ist, als entscheidender hinzustellen. Zu der Sprachphilosophie Picos, die bei Reuchlin wiederkehrt, d. h. zur Beziehung zwischen Namen und Gegenstand, gibt es allerdings Parallelstellen beim Cusaner z. B. in der Schrift ›Idiota de mente‹ (›Der Laie über den Geist‹) Kap. III: »Gott ist eines jeden Dinges Genauigkeit. Wenn man daher von einem einzigen Gegenstand ein genaues Wissen besäße, hätte man notwendig ein Wissen von allen Dingen. Wüßte man den genauen Namen eines einzigen Dinges, so wüßte man auch aller Dinge Namen; Genauigkeit gibt es nur in Gott. Wer also einmal eine einzige Genauigkeit erreichte, der würde Gott erreichen, der die Wirklichkeit alles Wißbaren ist.« (Vgl. die lichtvoll schöne Einführung zu diesem Buch von Hildegund Menzel-Rogner, Hamburg 1949). Doch die reine Sicht Platons, aus der der Cusaner den Sachverhalt sieht, ist wohl dem Pico wie dem Reuchlin nicht zugänglich. Was als Verbindungsgut zwischen Pico und Nikolaus von Cues übrig bleibt, gehört der allgemeinen Zeitanschauung an. – Soweit ich sehen kann, wird der Cusaner und seine Hauptlehre, die coincidentia oppositorum (das Zusammenfallen der Gegensätze), von Reuchlin nur ein einziges Mal zitiert, und zwar in ›De arte cabalistica‹, XXI a (Hagenau 1517), wo von ihm als »Germanorum philosophissimus archiflamen dialis« die Rede ist. Der Kardinal und Bischof von Brixen als ›Oberpriester Jupiters‹, eine echt humanistische Floskel! (Den Hinweis auf dieses Zitat verdanke ich dem überragenden Buch von Gershom Scholem ›Ursprung und Anfänge der Kabbala‹.) Über ein zweites Zitat (ohne Namensnennung) später, im Heidelberger Kapitel.
Daß die Form des Dreigesprächs, die Reuchlin in seinen Hauptwerken verwendet, einen Beweis für seine Abhängigkeit von dem Cusaner abgeben soll, der diese Form gleichfalls liebte, scheint mir unrichtig. Ein Dreigespräch ist schon die christliche, von äußerster Urbanität durchwehte Streitschrift des römischen Advokaten Minutius Felix aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Und schon in einigen der platonischen Dialoge findet sich die Konstellation von drei Unterrednern (z. B. im ›Timaios‹, im ›Hippias minor‹). –
Auch beim ironischen Abwehren banausischer Feinde folgt Reuchlin fast wörtlich dem Grafen. In der schönsten Abhandlung, die Pico geschrieben hat, im Buch ›Über die Würde des Menschen‹ lesen wir: »Schon beim Hören des Wortes Kabbala schien meine Gegner ein Entsetzen zu überschleichen. Unter der Kabbala stellten sie sich nicht Menschen, sondern Zaubertiere, Kentauren oder irgendwelche Wunderwesen vor. Eine amüsante Episode. Einer der Gegner wurde gefragt, wer denn eigentlich Kabbala sei. Er antwortete: ›Das war ein abtrünniger Wicht und ein dämonischer Gesell, der Verfasser vieler Schriften gegen Christen‹. Kann irgend jemand, der diese Auskunft hört, das Lachen unterdrücken?« – Dazu Reuchlin im ›Augenspiegel‹, XII b: »Cabala / dar wider aber die maister der hailigen schrift vil redten und schriben / wie wol sie grüntlich nit wißten was doch Cabala für ain tiere were.« Der Scherz scheint Reuchlin besonders gut gefallen zu haben, denn in der ›Kabbalistischen Kunst‹ kommt er nochmals, und zwar fast wörtlich, auf das Bonmot Picos zurück: »Falso asseruerunt, Cabalam fuisse hominem diabolicum et haereticum, unde Cabalistas haereticos esse omnes. Abstinete obsecro si potestis a risu.« (»Fälschlich behaupten sie, Kabbala sei ein teuflischer und ketzerischer Mensch gewesen, daher seien alle Kabbalisten Ketzer. Bitte haltet euch, wenn ihr könnt, vom Lachen zurück.«)
Radierung von Jacov van der Heyden nach einem Gemälde von Hans Baldung Grien.
Von Pico (und Lorenzo Valla) hat Reuchlin auch die Methode übernommen, durch Vergleich mit dem hebräischen Urtext Irrtümer in der Vulgata, in der durch den kirchlichen Brauch autorisierten lateinischen Übersetzung des Hieronymus zu rügen, wozu eine bedeutende Portion wissenschaftlichen Mutes gehörte. Pico fand 600 Fehler in einer Übersetzung der Psalmen, bestätigte aber die Korrektheit der Vulgata, Reuchlin nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er kritisiert die Übersetzungen des Hieronymus, selbst die des Augustinus, des Nikolaus von Lyra, der doch etwas später sogar für Luther maßgebend war. (»Si Lyra non lyrasset – Luther non saltasset« – »Hätte Lyra nicht die Leier gespielt – hätte Luther nicht getanzt«, spottete ein Zeitgenosse.) Reuchlin aber schrieb eindeutig: »Unser Text liest so, die hebräische Wahrheit aber enthält anderes« – »Ich weiß nicht, durch welchen Traum bewogen, Augustinus übersetzt hat« – oder noch einfacher, über eine andere Autorität: »Nescio quid blacterat« (»Ich weiß nicht, was er zusammenschwatzt.«) – Zusammengefaßt hat Reuchlin sein Programm in den oft zitierten Worten, vielleicht seinen bekanntesten:
»Wiewohl ich nämlich den heiligen Hieronymus wie einen Engel verehre und Lyra wie einen Meister achte, bete ich dennoch die Wahrheit als Gott an.«
Im Original der »Rudimenta« klingt das besonders eindrucksvoll:
»Quamquam enim Hieronymum sanctum veneror ut angelum, et Lyram colo ut magistrum, tamen adoro veritatem ut deum.«
Ein würdiges Gegenstück zu dem klassischen: »Amicus Plato, magis amica veritas«. (Plato ist mir ein Freund, mehr Freund ist mir die Wahrheit.) – Es tut wohl, sich an solche Sätze der Absolutheit in einem Zeitalter zu erinnern, das von vielen Seiten her die Wahrheit annagen möchte, Tendenz und sogenanntes ›Engagement‹ kaltsinnig über die Wahrheit stellt und sich damit ein klares Verdammungsurteil spricht. –
Pico della Mirandola. 1463-1494.
Bei Pico finde ich auch die seltsame, später von Reuchlin nachgeahmte Sprachspielerei, das hebräische Wort für Himmel, hashamájim, sei aus esch (Feuer) und majim (Wasser) zusammengesetzt. Bei Pico liest man dieses Kunststück im ›Heptaplus‹, bei Reuchlin in ›De verbo mirifico‹.
Im Heptaplus setzt Pico auseinander, daß es drei Welten gebe: die überhimmlische Welt (das Empyreum, die Welt der Engel, mundus intellectualis) – den Himmel – die sublunarische Welt. Für das Empyreum ist der feurige Äther charakteristisch, für unsere sublunarische Welt das unbeständige ruhelose Element des Wassers, der Himmel muß sich eben mit einer Mischung von Feuer und Wasser zufriedengeben. Die Stiftshütte habe alle drei Welten dargestellt. Der Mensch sei die Mitte zwischen allem Geschaffenen. Als Verbindungsglied der kreatürlichen Natur mit der überirdischen Welt, der er innerlich verwandt ist. – Das starke Selbstgefühl des erwachenden Renaissancemenschen spricht aus diesen Zeilen, die ebenso wie die andern hier angeführten Gedankengänge bei Reuchlin wiederkehren. Vernünftigerweise ist Reuchlin dem Pico nicht bei dessen halsbrecherischem Versuch gefolgt, den Plato und Aristoteles in Konkordanz zu bringen. Aber den starken Einfluß des Neupythagoräismus, den Kult der Zahl hat er von ihm, vom Cusaner (Idiota de mente, 6. Kapitel) und von dem Kabbalisten Abulafia übernommen. Er vereint in sich den Abglanz all dieser Erleuchtungen.
In einem schönen Essay ›Ecce homo humanus‹ hat Josef Mühlberger die Analyse des großartigen Jünglings Pico auf zwei seiner Briefworte aufgebaut, die sehr cusanisch (de concordantia catholica) und sogar über den Cusaner hinausgreifend klingen: »Wir wollen den gewünschten Frieden genießen, den heiligen Frieden, die untrennbare Verbindung, die einmütige Freundschaft, durch welche alle Seelen in einem Geiste, der über allen Geistern ist, nicht nur übereinstimmen, sondern sogar im Grunde völlig eins werden. – Auch Gott muß Dich als Menschen verachten, wenn Du vorher den Menschen als Menschen verachtet hast.«