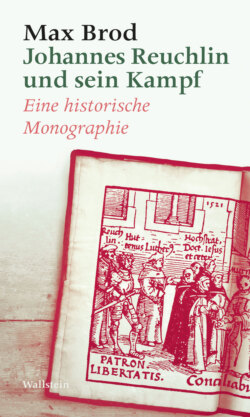Читать книгу Johannes Reuchlin und sein Kampf - Max Brod - Страница 21
4
ОглавлениеAus Italien zurückgekehrt, widmet sich Reuchlin zunächst wieder der Juristerei. Er gehört dem Hofgericht in Stuttgart an. Dann finden wir ihn, mit wichtigen politischen Aufgaben betraut, mitten in der molestia curialis, den Mühen des Hoflebens, wie einer seiner Korrespondenten schreibt, – nämlich als Gesandten seines Herrn, des Grafen Eberhard, bei Kaiser Friedrich III., der damals in Linz Hof hielt. Eine dauernde Residenz hatte Friedrich ja nicht. Er wurde in vielen Kriegen geschlagen, träumte aber unverbrüchlich von der Weltmacht des Hauses Habsburg. Auf seinen Büchern, Gefäßen, Palastportalen ließ er die Formel A. E. I. O. U. anbringen, ein Anagramm, das als Anfangsbuchstabenreihe entweder mit »Alles Erdreich ist Oesterreich untertan« oder »Austriae Est Imperare Orbi Universo« entziffert wurde. Durch Verheiratung seines Sohnes Maximilian mit Maria von Burgund näherte er sich seinem Ziele um ein Beträchtliches. Doch sogar Wien ging ihm für eine Zahl von Jahren verloren, auch Böhmen und Ungarn; für immer die Schweiz. In Armut und bei unstetem Reisen durch das zerrüttete Reich befaßte er sich mit Alchimie und Astrologie, mit den Linien in den Innenflächen der Hände, mit geheimen Künsten wie sein Nachfahr Kaiser Rudolf II. in Prag, der passive Held in Grillparzers erschütterndem Drama vom ›Bruderzwist‹. Zu den Lieblingsneigungen dieses eigenartig besinnlichen und schicksalverfolgten Mannes Friedrich, der über fünfzig Jahre lang ruhmlos die Krone des Römischen Reiches Deutscher Nation trug, gehörte die stille Wissenschaft der Botanik. Den Juden gegenüber benahm er sich wohlwollender als die meisten herrschenden Männer seines Zeitalters, Stadträte miteingeschlossen. Wohlwollender jedenfalls als Graf Eberhard, der von seinen Zeitgenossen als Meister eines weisen Regenten hochgepriesen wurde, jedoch Sorge dafür trug, daß dem Herkommen gemäß in Württemberg kein Jude (außer einzelnen herumziehenden Handelsleuten) geduldet wurde, und der auch noch seinen Erben auftrug, bei dieser strengen Praxis zu beharren. – Wie weit bei dem milderen Verfahren Kaiser Friedrichs III. und seines Sohnes Maximilian die dauernden Geldnöte dieser Souveräne mitgewirkt haben, wage ich nicht zu entscheiden. Doch war es damals eine Tradition, daß die zentrale Gewalt des Reiches (die Habsburger) die Juden eher schützte, als die lokalen Gewalten und Stände es taten; was auch in der besonderen Rechtsauffassung der ›jüdischen Kammerknechtschaft‹ seinen Grund hatte. Darüber später Genaueres. – Hier nur noch die Anmerkung, daß erst viel später die grausame Verfolgerin der Juden, Kaiserin Maria Theresia, die eben beschriebene wahrhaft herrscherlich-milde Tradition gebrochen hat.
Die judenfeindliche Gesetzgebung Württembergs hatte unter anderem die Folge, daß Reuchlin zunächst große Schwierigkeiten hatte, im Lande seines ständigen Wirkens Lehrer der hebräischen Sprache oder auch nur hebräische Bücher zu finden. Erst die Reisen nach Italien brachten ihm wesentliche Hilfe. – Reuchlins Bemühungen um Erlernung der hebräischen Sprache reichen weit in seine jungen Jahre zurück. Geiger neigt zur Ansicht, daß Reuchlin durch autodidaktisches Studium und »eisernen Fleiß« die Grundlage zu den ausgebreiteten Kenntnissen des Hebräischen gelegt hat, die schon 1483 Agricola in einem Brief an ihn preist. 1499 heißt es in einem Briefe des Jodocus Gallus aus Ruffach an Reuchlin: »Tu hebraeis interea fruere teque, uti eis gaudes, totum devoveas«. (»Du genieße inzwischen deine hebräischen Studien und ergib dich ihnen ganz, wie es dir Freude macht.«) Zwischen beiden Briefen liegt allerdings das Zusammentreffen mit Pico, von dem Anregungen zu weiterer Arbeit auf diesem Gebiet ausgegangen waren. Überhaupt lagen ja an der päpstlichen Kurie (damals in Avignon) die Dinge anders als in Deutschland; an der Kurie, von wo aus schon Papst Johannes XXII. (1316–1334) den (teilweise allerdings Papier gebliebenen) Befehl zur Errichtung von Lehrstühlen für Hebräisch an den Universitäten von Paris, Oxford, Salamanca und Bologna gegeben hatte und wo Papst Clemens VI. (1342–1352) ausdrücklich gegen Judenverfolgungen in Frankreich und Deutschland aufgetreten war, wo ferner (nun wieder in Italien) Papst Sixtus IV. drei wichtige kabbalistische Bücher, unter ihnen Schaare Ora (Portae Lucis, Die Pforten des Lichts) von Gikatilla, ein von Reuchlin ausgiebig benütztes Werk, durch den Konvertiten Paulus Riccius aus dem Hebräischen ins Lateinische übertragen ließ. Hier herrschte eine freiere Atmosphäre für solche Studien als in deutschen und spanischen Landen, wo die Juden mit tausend wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und fürchten mußten, daß die Erwerbung von Hebräischkenntnissen vor allem als Waffe gegen jüdische Existenz und jüdisches Schrifttum dienen sollte. So ist wohl auch der Brief aufzufassen, den der Rabbi von Regensburg, Jacob Margolith, an Reuchlin geschrieben hat, als dieser bat, ihm kabbalistische Bücher zu leihen oder käuflich zu beschaffen. Der Inhalt des Briefes von Reuchlin kann nur aus der Antwort des Rabbi erschlossen werden; nur diese Antwort ist erhalten. Der Briefwechsel muß aber recht umfangreich gewesen sein, denn in den ›Rudimenta‹ schreibt Reuchlin, er besitze von diesem Rabbi »die süßesten (suavissimas) Briefe, in eleganter hebräischer Sprache an mich gesandt«. – Besagte Antwort nun enthält unter den Anfangsworten die höfliche Ansprache: »Adoni hameulé bechochmót doktor Jochan – Schtukarton« (»Mein Herr, hocherhoben in den Wissenschaften, Doctor Johannes – Stuttgart«) und warnt vor der Kabbala: es könnte geschehen, daß für den, der sich mit ihr befaßt, »tarbé lo hahefsséd jéter al hatoélet« (»der Schaden größer sei als der Nutzen«). So wie dem, der in die strahlende Sonne schaut, die Augen sich verdunkeln. »Und wisse, mein Herr, daß diese Bücher, die mein Herr verlangt, hier nicht zum Verkauf vorgefunden werden. Jedoch so weit es mir möglich ist, meinem Herrn zu dienen, bin ich als Diener dazu bereit. So spricht der Demütige, der genannt ist Jacob Margolith.« Vorher heißt es noch: »Bediwré hakabalá aschér hi chochmá tmimá neelmá merów anshé dorénu«. (»In Worten der Kabbala, die die unversehrte Weisheit ist und verborgen vor der Mehrheit der Menschen unseres Zeitalters«.) In der lateinischen Übersetzung, die Reuchlin diesem Brief beigibt, heißen die letzten Worte nach »Mehrheit«: »der Männer unserer Nation«, was offenbar ein wenig schief ist. In der Umgangssprache unseres Landes bedeutet ›anshé dorénu‹ einfach ›Zeitgenossen‹ – und das hat es wohl auch früher immer bedeutet.
Daß Rabbi Margolith nicht ganz Unrecht mit seiner Vorsicht hatte, auch wenn sie diesmal sich gegen den Unrichtigen kehrte und wehrte: das beweist der tragische Vorfall in seiner Familie. Sein Sohn (nach Selma Stern »Enkel des Talmudgelehrten Jacob Margolis aus Nürnberg, Sohn des Regensburger Rabbiners Samuel« – laut Geiger ›Briefwechsel‹ liegt die Gefahr vor, den Nürnberger mit dem Regensburger zu verwechseln. Ich kenne mich, offen gesagt, in diesen Familienverhältnissen nicht aus) sein Sohn oder Enkel also konvertierte. Hier ist der Ort, zwischen zwei Arten von Apostaten scharf zu unterscheiden: den nicht-aggressiven (wie den oben erwähnten Paulus Riccius), die nichts Besonderes tun, als daß sie einen mehrere tausend Jahre alten Geschichtszusammenhang verraten, und den Hetz-Apostaten, die gewissermaßen nach dem unausgesprochenen Grundsatz handeln: »Bin ich abtrünnig geworden, so sollen auch alle andern Juden von Volk oder Glauben oder von beiden abfallen.« Ganz ähnliche Figuren habe ich unter den Assimilanten aller Abarten kennengelernt, mit denen ich mein Leben lang im Kampfe gelegen habe. Es gibt auch da die harmlosen und jene, denen gleichsam das ungeschriebene Schlagwort vorschwebt: »Habe ich mich assimiliert, – zumindest glaube ich, daß das geschehen ist – so sollt und müßt auch ihr alle euch assimilieren, alle, alle. Jeder an sein Wirtsvolk. Keiner darf zurückbleiben. Früher werde ich mich nicht zufriedengeben.« (Ich werde später auf diese clownesk-traurige Menschenart noch zu sprechen kommen.) – Der Enkel also des berühmten Gelehrten nannte sich nach seiner Taufe Antonius Margaritha (was dasselbe bedeutet wie das hebräische Margalith, nämlich Perle), wurde Lektor der hebräischen Sprache und veröffentlichte ein von Verleumdungen strotzendes, dabei boshaft-geschicktes, mit manchen jüdischen Kenntnissen aus seiner frommen Jugend wahrheitsverdrehend auftrumpfendes Angriffsbuch. Trotz offenbarer Fehler machte es Eindruck, namentlich auf Kaiser Karl V., der zunächst die Beschuldigungen glaubte und in Zorn geriet, da er knapp zuvor in Innsbruck »Josels Verteidigungsrede zugunsten seines Volkes angehört, um nun von einem gelehrten Täufling die Beweise zu erhalten, daß sie (die Juden) in ihrer Synagoge Christus und den Kaiser selbst verfluchten und die Christen dem Judentum zu gewinnen versuchten«. Im Jahre 1530, also acht Jahre nach Reuchlins Tod, schien der Erzfeind Pfefferkorn wiederauferstanden. »Für die Juden war der Lektor der hebräischen Sprache ein gefährlicherer Feind als der ungebildete Metzger Pfefferkorn«, heißt es in dem Buch, das die lebendigste und wissensreichste Schilderung des Judenelends jener Jahre, zur Zeit Reuchlins und bald nachher, bringt, in ›Josel von Rosheim‹ von Selma Stern. Und weiter, ebenda: »Margaritha hatte sich der Mühe unterzogen, die sämtlichen jüdischen Gebete in die deutsche Sprache zu übersetzen, um aus ihnen zu beweisen, daß die Juden an jedem Tag des Jahres, am Morgen, am Nachmittag und am Abend, besonders aber an ihrem Versöhnungstag Gott anflehten, er möge das römische Kaisertum auswurzeln, alle christlichen Obrigkeiten und alle Königreiche vernichten und der ›Christen Blut an die Wand spritzen‹. ›O christlicher Leser, du mußt das merken, daß, wo die Juden um Rache bitten und fluchen über Edomiter, Esau, Seir, meinen sie allemal alle Obrigkeit samt den Untertanen des römischen Reichs … Sie haben Gebete, besonders das Alenugebet, in dem sie wagen, Christus selbst zu verfluchen. Wenn sie beten, sie (die Christen) knien und bücken sich vor einer Torheit und anbeten einen Gott, der nicht helfen kann, so beten sie hier klärlich wider Christus und die Christen. Denn unter Torheit und Eitelkeit verstehen sie Jesus, weil diese Worte dem Zahlenwert seines Namens entsprechen.‹ Am Schluß seiner Abhandlung bittet Margaritha die Regierungen, den Juden, die er des Diebstahls, des Wuchers, der Münzvergehen und anderer Laster bezichtigt, die Geldleihe zu verbieten und ihnen weder Schutz noch Rechtsbeistand zu gewähren.«
Die dramatisch erregte Darstellung der vor dem Kaiser abgehaltenen Disputation zwischen Margaritha und dem ›Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation‹ (das war eine Zeitlang der Titel, den Josel von Rosheim führte) sowie des Rosheimschen Sieges gehört zu den aufwühlendsten Partien historischer Prosa, die ich je gelesen habe.
Wir sind nicht allzu weit von unserem Thema abgekommen. Denn der Mann, bei dem Reuchlin endlich seine Sehnsucht nach guter systematischer Unterweisung im Hebräischen stillen konnte, der Leibarzt des Kaisers Friedrich III., Jakob ben Jechiel Loans, aus Mantua oder Ferrara, wie Reuchlin selbst berichtet, war vermutlich ein Verwandter jenes Josel (oder besser: Jossel oder Josef) von Rosheim, der in dunkelsten Tagen wiederholt auf mannhafte und kluge Art den Schutz seiner Stammesgenossen durchsetzte. Dieser »erste Sozialkritiker und Sozialreformer der deutschen Juden«, wie S. Stern ihn nennt, stammte aus einer Familie, die, einer alten Tradition zufolge, aus Frankreich in Deutschland eingewandert war – und zwar, wie ich dem oben genannten Buch dieser Autorin entnehme, aus dem Orte Louhans. (Louhans findet sich als Arondissementshauptstadt des französischen Departements Saône-et-Loire an der Lyoner Bahn.) »Er selbst unterzeichnete sich einmal auf einer Versammlung jüdischer Delegierter, in einer hebräischen Unterschrift, als Joseph ben Gerschom aus der Familie Louans«. – »Es lag daher nahe«, fährt Selma Stern fort, »Josele in verwandtschaftliche Beziehung zu Jakob Jechiel Loans zu bringen, nicht nur des gemeinsamen Namens wegen, sondern auch wegen mancher gemeinsamer Charakterzüge und der hervorragenden und privilegierten Stellung, durch die beide ihre Glaubensgenossen weit überragten.«
Wiewohl nun zweifellos Reuchlin der Bahnbrecher für das Studium der hebräischen Sprache und der Kabbala in Deutschland wurde, muß doch hervorgehoben werden, daß Reuchlin selbst und Loans bei Reuchlin Vorgänger hatten. Reuchlins Vorgänger in den deutschen Bemühungen um die ›heilige Sprache‹ sind die schon genannten Tübinger Theologen, dann der Humanist Agricola, ferner Conrad Pellikan, der Freund Zwinglis, dem die Priorität gebührt, eine kleine hebräische Grammatik nebst einem Wörterbuch zum eigenen Privatgebrauch (allerdings sehr mangelhaft, wie Geiger ausführt) zusammengestellt zu haben. Dieses Werk Pellikans zirkulierte in vielen Abschriften bei seinen Freunden. Dies alles gehört zum Charakterbild der Renaissance. – Das nach der scholastischen Erstarrung neu erwachte wissenschaftliche Interesse für die Ursprache des ›Alten Testaments‹ gab es da und dort, – unter dem Einfluß der ›modernen‹ humanistischen Tendenzen, die den Ruf ›ad fontes‹ (›zu den Quellen‹), wenn auch zunächst nur theoretisch, erhoben; so etwa besaß der Bischof von Worms, Johann von Dalburg, in seiner reich ausgestatteten Bibliothek, die Reuchlin rühmt, auch viele ›hebraica volumina‹, hebräische Bände. – Reuchlin aber war der erste, der dieses ad fontes, was das Hebräische anlangt, ganz ernst nahm, – indes der gefeierte Erasmus sich auf das Griechische (das Neue Testament) begrenzte. »Die Kabbala und der Talmud, was immer das sein möge, haben mir nie zugelächelt«, erklärte Erasmus dezidiert in einem Brief an Albrecht v. Brandenburg. (»Cabala et Talmud quicquid hoc est meo animo nunquam arrisit.«) Es gibt noch andere Sätze des Erasmus, in denen er sich geradezu rühmt, nicht mehr als die Anfangsgründe des Hebräischen zu verstehen.
Reuchlins autodidaktische Bemühungen um Erlernung der hebräischen Sprache sind oben erwähnt. Seit der Zeit, da Geiger seine Reuchlin-Forschungen veröffentlicht hat, ist (wie ich dem gelehrten Essay von Prof. Hans Rupprich in F. 2 entnehme) eine in München befindliche Handschrift zum Vorschein gekommen, die beweist, daß Reuchlin 1486 einen Juden namens Calman zum Lehrer im Hebräischen hatte, der ihm gegen Entlohnung das Wörterbuch des Menachem ben Saruk (aus Tortosa) abschrieb.
Die Begegnung mit Jakob Jechiel Loans aber war der Wendepunkt. In dem kaiserlichen Leibarzt lernte er einen angesehenen Mann von umfassender allgemeiner und jüdischer Bildung kennen, wie er ihm bisher unter den verarmten, durch Sondergesetze bedrückten, äußerlich gedemütigten, wenn auch innerlich ungebrochenen Juden der deutschsprachigen Länder nicht begegnet war. Die Ungebrochenheit dieser Volksschicht bestand aber wirklich nur pro foro interno, machte sich vor allem darin geltend, daß die Juden in ihren Gemeinden, unter ihren geistigen Führern eine eigene, sehr deutliche, von keinem äußern Einfluß berührte Wertskala der geistigen Rangordnungen anerkannten und in Anwendung brachten. Diese Ungebrochenheit war nicht jenes von Nietzsche, dem schlechten Psychologen, weidlich überschätzte »spernere se sperni« (»verachten, daß man verachtet wird«), das sich vielmehr ressentimentgeladen und äußerst ungesund auswirkte. – Loans war, wie es den Anschein hat, der erste psychisch intakte, gesunde deutsche Jude, der Reuchlin gegenübertrat. Die beiden fanden leicht eine gemeinsame Sprache: die einer hohen selbstlosen Geistigkeit. – Dabei muß die populäre Vorstellung richtiggestellt werden, als sei Reuchlin ein spezieller Judenfreund gewesen. Das war er durchaus nicht. Er teilte die Vorurteile seiner Zeit (und vieler vorangegangener Jahrhunderte) gegen die Juden, die, außerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft stehend, zumindest als etwas Fremdes, Schwer-Einordenbares, ja Unheimliches empfunden wurden, das der Umgebung Rätsel aufgibt. Ganz ähnlich, wie die Christen die Anhänger Mohammeds als fremd und fatal ablehnten, fürchteten, bekämpften. Und Reuchlin war und blieb, wie noch darzustellen sein wird, ein frommer Katholik, der seinen Glauben außerordentlich intensiv fühlte und mit nichts, was diesem Glauben entgegenlief (daher später auch mit Luther nicht) irgendwelche Gemeinschaft einzugehen gesonnen war. Wie ja auch sein Vorbild Pico von Mirandola bei all seiner philosophischen Freigeisterei auf die Palme der Rechtgläubigkeit nie verzichten zu wollen erklärte. – Nur daß bei Reuchlin die Front gegen die Juden von Anfang an weniger scharf hervortrat als bei seinen Zeitgenossen, z. B. bei der Rechtsautorität, dem berühmten Professor der Universität Freiburg im Breisgau, Huldrichus Zasius, der die Juden schlicht als »truculentae bestiae« (»grimmige Tiere«) bezeichnete, die von den Fürsten ›eliminiert‹ werden sollten. »Man muß jenen ekelhaften Auswurf in kimmerische Finsternis versinken lassen«. So sprach Zasius. Zu vergleichen das reich dokumentierte Buch von Guido Kisch ›Zasius und Reuchlin‹ (1961). – Diese Differenz ist auf die besondere Milde und Rechtlichkeit des Reuchlinschen Charakters, nicht auf prinzipielle Andersartigkeit der Grundeinstellung zu den Juden zurückzuführen. – Und nun trat ihm die ›große Ausnahme‹ entgegen: ein Jude, mit dem er sich verständigen, mit dem er über gelehrte Angelegenheiten reden, ja von dem er lernen konnte, den er verehren mußte. Viele ansprechende Details über Reuchlin im Verkehr mit Loans finden sich in dem wissensreichen Büchlein ›Johannes Reuchlin in Linz‹ von Konrad Schiffmann (Linz 1929).
Man stellt zweierlei fest: Erstens, daß Reuchlin trotzdem seine im Grunde negative, weil mild-missionarische Einstellung den Juden gegenüber nicht geändert hat (wiewohl er nie zu aktivem Missionieren überging) – zweitens: daß Reuchlin diese ›Ausnahme‹ Loans gründlich ausgekostet, ihr eine allerbreiteste Wirkung auf sein Denken und Schaffen eingeräumt hat. Also alles andere war als jene allgemein bekannte Spielart des Antisemiten, der einen ganz vorzüglichen Juden kennt (es können auch zwei sein) und der beteuert: »Ja, wenn alle Juden so wären wie Sie, dann gäbe es keinen Antisemitismus«, der sich aber im übrigen in seiner Judenfeindschaft nicht beirren läßt. – Auf dieses triviale Niveau ist Reuchlin nie hinuntergesunken. Sein Fall ist wesentlich komplizierter und bedarf im Zickzack seiner Manifestationen der zartesten Untersuchung (die wir hier, in diesem Stadium der Begebenheiten noch gar nicht in Angriff nehmen können).
Genug, dieses jüdische Volk, das er wohl aus uralten oder in der Ferne, in Spanien und in der Provence geschriebenen Büchern, nie in seiner lebendigen Wirklichkeit richtig gekannt, immer nur um der kümmerlichen Art willen verachtet hatte, in der es seinen Lebensunterhalt suchte und oft mit nicht zulässigen Mitteln zu suchen gezwungen war, da man ihm eine anständige Existenz allerseits verwehrte: dieses jüdische Volk trat ihm in einem Mann entgegen, der am Hofe geehrt, in Wissenschaften unterrichtet und in die Gemeinschaft der Gebildeten willig aufgenommen war. Reuchlin spricht immer mit der größten Hochachtung von ihm: »Praeceptor meus, mea sententia valde doctus homo Jacobus Jehiel Loans hebraeus« (Mein Lehrer, meiner Meinung nach ein höchst gebildeter Mensch, der Hebräer Jakob Jechiel Loans) – oder »humanissimus praeceptor meus doctor excellens« (Mein hochhumaner Lehrer, der hervorragende Doktor). Einen in tadellosem Hebräisch geschriebenen Brief an Loans beginnt Reuchlin: »Schalóm, schalóm lirchók welekarów miméni hamischtoték wehanichsáf lirót panécha haneimím« usf. (Frieden, Frieden den Fernen und den Nahen – von mir, der sich sehnt und der dein liebenswürdiges Gesicht zu sehen begehrt.) Der Brief ist vom 1. November 1500 datiert und von Reuchlin selbst in den »Clarorum virorum epistolae‹ veröffentlicht. Eine lateinische Übersetzung ist (wohl gleichfalls von Reuchlin) hinzugefügt. In den folgenden Zeilen bezeichnet sich Reuchlin als einen, »der den Glanz deines leuchtenden Antlitzes zu genießen und deine reine Lehre zu hören wünscht.« Er teilt Loans mit, daß er in seinen Forschungen erfolgreich war »und zu einer großen Schlußfolgerung gelangt ist, die, wie er weiß, dem Loans Freude machen wird.« – Ob er damit den fünften Buchstaben im Gottesnamen meint, erscheint mir nicht sicher, da das Buch, in dem er diese ›Entdeckung‹ veröffentlicht, allzu weit (sechs Jahre) vor dem zitierten Brief liegt. – Jedenfalls hat der gestrenge Pfefferkorn es (in seiner ›Defensio‹) nicht unterlassen, diesen Brief Reuchlins als »unerlaubte Begünstigung eines Juden« zu denunzieren. – Die Ausdrücke, die Reuchlin im Brief an Loans verwendet, erinnern an Worte, die die beiden nichtjüdischen Gesprächspartner zu Beginn des 2. Teiles des Buches ›De arte cabalistica‹ zum Lob Simons sprechen, von dem sie Lehre empfangen.
Von den neun Hauptwerken Reuchlins: Vocabularius breviloquus (1478), De verbo mirifico (1494), den beiden Komödien (1498, 1504), De rudimentis hebraicis (1506), Augenspiegel (1511), Defensio contra columniatores suos Colonienses (1513), De arte cabalistica (1517), De accentibus et orthographia linguae hebraicae (1518) sind sechs der hebräischen Sprache und Problemen des Judentums gewidmet. Außerdem noch einige kürzere Schriften und Übersetzungen. Es soll nicht behauptet werden, daß sich in allen diesen Werken der Einfluß des J. ben J. Loans zeigt oder daß er gar dominiert; aber daß stärkere oder schwächere Ausstrahlungen seines Wesens an vielen Stellen durchleuchten, kann bewiesen werden.
In zwei der aufgezählten Schriften ist jüdische Überlieferung Gegenstand des Gesprächs, das zwischen je drei Männern geführt wird. Im ›Wundertätigen Wort‹ unterhalten sich in Pforzheim der Weltenbummler Sidonius, ein Eklektiker, der anfangs als Anhänger Epikurs auftritt, – der Jude Baruchias – und der Autor selbst unter seinem Humanisten-Namen Capnion über Themen, die mit der jüdischen Geheimlehre (Kabbala) bald in entfernter, bald in näherer Beziehung stehen. Im zweiten Trialog, ›Von der kabbalistischen Kunst‹, der wesentlich kenntnisreicher und reifer ist (zwischen den beiden Werken liegt die Erfahrung nahezu eines Vierteljahrhunderts, das die Kampfjahre Reuchlins in sich einschließt), sind in Frankfurt aus sehr entfernten Gegenden, sozusagen von den Enden der Welt, zwei Denker eingetroffen, der Mohammedaner Marranus aus Konstantinopel, der Stadt, die man das ›neue Rom‹ nennt, und der Jungpythagoräer Philolaus aus dem Volk der Alanen, also der Sarmaten (des heutigen europäischen Rußland) auf dem Wege über Thrazien, wo er sich einer Kaufmannsschar angeschlossen hat. Beide sind, jenseits aller Markt- und Messegeschäfte eigens mit dem Ziel aufgebrochen, dem weltberühmten jüdischen Gelehrten Simon einen Besuch abzustatten, um von ihm Belehrung zu empfangen. Die ihnen denn auch in reichstem Maße zuteil wird. – Sowohl für die Figur des Baruchias wie für die des Simon hat die erlebte Gestalt des Lehrers und Gelehrten Jakob Loans viel Material und einzelne besonders charakteristische Züge beigestellt, wie mir scheint. Für den Baruchias ist dieser personale Beitrag weniger stoffhaltig und mit beträchtlichen Trübungen, ja Zurechtweisungen versetzt, noch nicht völlig einheitlich durchgearbeitet. Dem Simon steht Reuchlin im Abstand der Jahre, aus verklärter Erinnerung gegenüber; freier, daher wahrhaftiger. Er schafft aus dem vollen, in schmerzlicher Konzentration, mit einem ungeheuren Aufwand von Energie, ohne sich durch Gegenwartsrücksichten beirren zu lassen. Loans lebte ja im Jahre 1506 nicht mehr, in diesem Jahr erwähnt ihn Reuchlin als einen Toten, mit dem Zusatz »Misericordia dei veniat super eum« (Das Erbarmen Gottes komme über ihn), was ungefähr der hebräischen Redewendung »Aláv haschalóm« entspricht, die man nur bei Verstorbenen gebraucht: »Über ihm sei Friede.«
Meiner Meinung nach müßte man den speziell literarischen Ruhm Reuchlins, der noch kommen wird (von seinem philologischen, philosophischen, zivilcouragehaften Ruhm etc. abgesehen, den er schon genießt), weniger auf die beiden Lustspiele als auf zweierlei gründen: erstens auf die scharfen Fechterstöße, die er im ›Augenspiegel‹ führt und deren stilistische Präzision und Virtuosität, deren kraftvolle Sprachfrische zusammen mit der Redlichkeit des Herzens ihm die Rolle des Vorläufers von Lessing und dessen polemischen Meisterwerken (z. B. ›Wie die Alten den Tod gebildet‹) anweist – zweitens auf die beiden plastischen Judentypen, die er geschaffen, mit denen er vor dem ›Juden von Malta‹, vor ›Shylock‹ (den beiden ›bösen‹ Juden) ein neues Element in die Weltliteratur eingeführt hat. Durchaus Reuchlins Werk ist die Gestaltung eines bis dahin unbekannten Typs, dem man gegenüber dem allzu weltklugen, allzu durchsichtigen ›Nathan‹ den Vorrang an menschlichem Tiefgang und Bedeutung zuzuerkennen nicht umhin können wird. Die Entdeckung des ›guten‹, universal schöpfungsmächtigen, humanen und dabei so unverbrüchlich in seinem Volkstum wurzelnden Juden: eines Mannes, der Kraft und leises Wesen vereint. Letzten Endes verdanken wir vielleicht diesen Typ, weil er ihn vorgelebt hat, dem bescheidenen höflichen weisen Jakob ben Jechiel Loans. Und wenn Geigers Vermutung richtig ist (die er allerdings nur für die Gestalt des Simon, nicht auch des Baruchias ausgesprochen hat): der gestaltenden Fähigkeit Reuchlins.