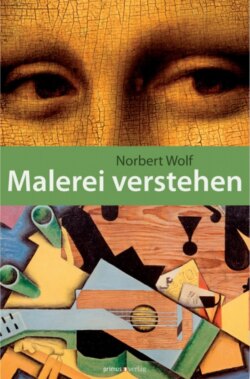Читать книгу Malerei verstehen - Norbert Wolf - Страница 11
Gelb und Grün
ОглавлениеDas „verteufelte“ Gelb – Die „Judenfarbe“
Eine eigenartige, im Grunde genommen unerklärliche Position in der Skala mittelalterlicher Farbsymbolik nimmt das Gelb ein. Im Buddhismus ist es bekanntlich bis heute eine an Rang ausgezeichnete Farbe, safrangelb ist das Gewand der Mönche gefärbt. Die christliche Kirche dagegen verzichtete darauf, das Gelb in die Reihe ihrer liturgischen Farben aufzunehmen. Ja, die christliche Gesellschaft verteufelte diese Farbe in Rückbesinnung auf alte Gepflogenheiten. Denn schon im alten Rom, unter Kaiser Augustus, mussten die Huren, die lupae (Wölfinnen), gelbe Perücken tragen, damit man sie jederzeit, auch außerhalb der Bordelle, erkennen konnte. Amtliche Verordnungen des Mittelalters taten es den antiken Gesetzgebern gleich. Die liederlichen Frauenzimmer wurden von der Obrigkeit verpflichtet, als Erkennungszeichen ihres Gewerbes etwas auffällig Gelbes, ein Band, einen Gürtel, ein Kopftuch, zu tragen, damit sich anständige Personen von ihnen fernhalten konnten. Während dieses Alleinstellungsmerkmal in der Neuzeit nicht mehr angewandt wird, erlebte eine andere mittelalterliche Stigmatisierung mit der Farbe Gelb eine perverse, auf frühere Verordnungen zurückgreifende Renaissance noch im 20. Jahrhundert. Das vierte Laterankonzil hatte 1215 entschieden, dass das ins Auge springende Gelb die Anhänger eines nichtchristlichen Glaubens, in erster Linie die Juden, kennzeichnen und aus der Menge der Rechtgläubigen aussondern solle. Gelbe, skurril spitze Hüte dienten von nun an der Brandmarkung der Juden als „Mörder“ Jesu und folglich als „Untermenschen“. Auch in der Malerei sank das Gelb bei einer ganzen Reihe von Themen zur Schandfarbe herab. Immer dann beispielsweise, wenn Christus inmitten der Apostel zu sehen ist, sei es beim Letzten Abendmahl, sei es bei seiner Ergreifung im Garten Gethsemane, trägt der Erzverräter Judas ein schreiend gelbes Gewand – und nur ganz wenige Ausnahmen bestätigen diese Regel. Und auch der Teufel liebte scheinbar diese Farbe, oft genug hüllen ihn Gemälde in einen grellgelben Mantel – sofern sie ihn nicht in zotteliger Nacktheit wiedergeben. Im 20. Jahrhundert übernahm dann der Judenstern die fürchterliche Aufgabe der Negativmarkierung. Er trat die Nachfolge jener gelben kreisförmigen Stofffetzen an, die Juden früher an ihre Kleidung zu heften hatten (meist zusammen mit dem gelben Spitzhut, dem Judenhut), wenn sie sich in der Öffentlichkeit sehen ließen. Goethe glaubte, dass die Wahl des Gelb zu solchen Zwecken seit alters eine materialbedingte Ursache besaß. Er beschrieb in seiner Farbenlehre die „unangenehme Wirkung“, die entstehe, wenn die gelbe Farbe „unreinen und unedlen Oberflächen mitgeteilt“ wird, etwa grobem Tuch oder Filzstoff. Und er vermutet, dass man deshalb die Hüte der „Bankerottierer“ und die Ringe auf den Mänteln der Juden gelb gefärbt habe, außerdem, so sagt er weiter, sei die sogenannte Hahnreifarbe ein schmutziges Gelb.
Maigrün und Giftgrün
Im Islam steht das Grün bekanntlich für alles Heilige. Nicht so ausschließlich war das im christlichen Abendland der Fall. In dessen Kulturgeschichte der Farben ist seine Symboleigenschaft erstaunlich polarisiert. Der aus der Grünen Erde gewonnene Stoff hieß seit dem frühen 17. Jahrhundert auch Seladongrün, benannt nach einem französischen Erfolgsbuch dieser Zeit: Denn Céladon, Held des fünfbändigen Schäferromans Astrée (1607–1627) von Honoré d’Urfé, trägt bei seinem unendlich langatmigen Liebeswerben ein maigrünes Gewand – seit dem Mittelalter Sinnbild des Frühlings, der Liebe, der mit der Natur erwachenden bzw. erwachten Triebe. Eben jenes Erwachen des Lebens, der natürliche und spirituelle Neuanfang, den man mit dem Grün als Positivum assoziieren konnte, erlaubte es, mit ihm die christliche Kardinaltugend der Hoffung zu repräsentieren (vgl. die oben erwähnte Maestà von Ambrogio Lorenzetti). Andererseits entstand in der deutschen Sprache die nichts Gutes verheißende Wortverbindung aus „Grün“ und „Gift“ – „Giftgrün“. Mit der Giftigkeit des Grünspanpigments hat das wohl kaum zu tun, vermutlich aber mit den Drachenlegenden. Drachenhaut war nach allgemeiner Überzeugung grünfarben. Monströse Lebenskraft und hemmungslose Sexualität als geglaubte Eigenschaften des Bösen dürften zu jener Farbikonografie geführt haben, der zufolge die Widersacher des Heiligen, die Höllendämonen, gerne mit grüner schuppiger Haut darzustellen waren. Auch in den Akten zahlreicher Hexenprozesse war vom „grünen Buhlteufel“ die Rede.
Den nicht ganz so teuflischen Makel, doch immerhin den Anschein des banal Irdischen trug das Grün gelegentlich sogar noch im 20. Jahrhundert. Für Kandinsky und insbesondere für einen Hauptexponenten der geometrischen Abstraktion im Rahmen der holländischen De Stijl-Gruppe, für Piet Mondrian (vgl. Abb. 4), wurde nicht zuletzt aus diesem Grund heraus das Grün zum verpönten Farbton in ihren Bildern. Angeblich tat Mondrian aber auch im täglichen Leben alles, um nur ja nicht aus dem Fenster auf das Grün der Landschaft blicken zu müssen.