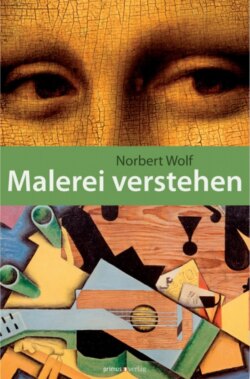Читать книгу Malerei verstehen - Norbert Wolf - Страница 13
Malen mit Gold
ОглавлениеGherardo Starnina
Als Gherardo Starnina 1408 beauftragt wurde, in Empoli Fresken zum Marienleben zu malen (nicht erhalten), schrieb man ihm vertraglich vor, das für den Marienmantel zu verwendende Ultramarin müsse von der Qualität zwei Florin pro Unze sein, für den Rest des Bildes genüge Ultramarin zu einem Florin die Unze. Mit solchen Differenzierungen gingen auch theologische Unterscheidungen einher: Latria hieß damals die höchste Art der Verehrung, die ausschließlich der Dreieinigkeit gebührte. Dulia meinte die Ehrerbietung, die man den Heiligen, Engeln und Kirchenvätern schuldete. Die gesteigerte Version, hyperdulia, kam einzig und allein der Gottesmutter zu. In Starninas Fresko kostete also hyperdulia zwei Florin die Unze. Wenn auch nicht schriftlich fixiert, so wurde in seinen Wandbildern zweifellos die latria mit Goldgrund, mit Aureolen und anderweitigen goldenen Akzenten zum Ausdruck gebracht.
Goldgrund
Gold war von jeher Synonym für Reichtum und Glück. Das Edelmetall, das, anders als Silber, nicht oxydiert, das durch das Spiel der Lichtreflexe immer lebendig erscheint, eignete sich auf besondere Weise zur mythischen Verklärung. Seines materialen und spirituellen Glanzes wegen bediente sich die frühmittelalterliche Kunst des Goldgrundes und des essenziell damit verwandten Nimbus, des Heiligenscheins, oder der goldfarbenen Gloriole bzw. Aureole (Abb. 2). Sie konnte dabei auf spätantike Traditionen, insbesondere auf Bildmittel des Kaiserkults, zurückgreifen, die seit Konstantin dem Großen im monumentalen Stil dem Christentum erschlossen wurden. Dazu gehören die schon im römischen Nationalepos, also in der 29–19 v. Chr. geschriebenen Aeneis des Vergil, als Lichtschein bezeichnete numinose Wolke (lat. nimbus), sowie die mandelförmige Aureole, die Mandorla: Schutzschild und Zeichen der Verklärung. Die solcherart ausgezeichnete Figur oder Personifikation sollte in einem überzeitlichen, immerwährenden Charakter betont werden. In diesem Sinne wurden auch die byzantinischen Kaiser bis zum Fall von Konstantinopel mit einem goldenen Heiligenschein dargestellt.
Abb. 2 Cimabue: Maestà, um 1280, Tempera auf Holz, 385 × 223 cm, Florenz, Galleria degli Uffizi.
Der Goldgrund hat sich aus der Mosaiktechnik entwickelt, wo er zunächst nur feierlich abschließender Hintergrund ist, um später dann die gesamte überirdische Sphäre anzuzeigen. Seit dem späteren 9. Jahrhundert waren in der mittelbyzantinischen Buch- und Ikonenmalerei Goldgrund und Nimbus verbindlich geworden, um später der abendländischen Tafelmalerei entsprechende Impulse zu geben. Das heilige Bild wurde zum Heiligenbild, nun auch im phänomenalen Ausdruck des göttlichen Lichtes. Das Gold, das in den Ikonen die Teilhabe der Heiligen am göttlichen Licht kennzeichnet, besitzt bekanntlich in den Mosaikgewölben der byzantinischen oder von der byzantinischen Kunst abhängigen Kirchen eine identische Symbolisierungsaufgabe. Die goldglänzenden Kuppeln und Apsiden veranschaulichen das Lichtreich des Jenseits.
Cimabues Maestà und der Goldgrund
Die einst als Altaraufsatz (Retabel) fungierende monumentale Tafel Cimabues stammt aus der Florentiner Kirche Santa Trinità (vgl. Abb. 2).
Cimabue stellt die thronende Madonna mit ihrem Kind vor Goldgrund dar; acht Engel umstehen und berühren die goldfarbenen Thronwangen, das Postament beherbergt in seinen Öffnungen die im Maßstab kleineren Halbfiguren von vier Propheten und Vorvätern Christi. Die Komposition ist von klarem Zuschnitt, den Gesamteindruck beherrscht ein präziser zeichnerischer Kontur. Betont ist die mittlere Vertikalachse mit der Madonna, deren Haupt genau vom spitzen Giebelabschluss der Tafel überfangen wird.
Auf dem Altar stehend und an dessen sakraler Bedeutung partizipierend, überhöhte einst die Tafel den die Messe feiernden Liturgen und verlieh durch ihre Gegenwart den spirituellen Inhalten des Messopfers einen anschaulicheren Charakter – der Goldgrund trug wesentlich dazu bei: Denn die Engel tragen den Marienthron wie eine unkörperliche Vision auf die Erde herab.
Der Madonnentypus mit der stilisierten Gesichtsform, sodann die preziöse Ornamentierung des Thrones, ferner das von Goldwirkerei übersäte, deshalb in irrealen Lichtstegen aufschimmernde Gewand Mariens sind byzantinisches Erbe. Daneben aber wird der aus der östlichen Kunst herrührende Flächenbezug der Gesamtkomposition von plastischer, raumfüllender Kraft ergänzt, auch wenn das perspektivische Einschwingen der Thronarchitektur, sowie Sitz- und Haltungsmotive der Figuren noch untektonisch wirken.
Blattgold
In der westlichen mittelalterlichen Malerei findet der Goldgrund seine frühest bekannte konsequente Anwendung in einem Evangeliar aus ottonischer Zeit, aus den Jahren um 990, dessen Miniaturen entweder in der Klosterschule der Insel Reichenau oder in Trier entstanden. Der Codex im Aachener Domschatz vermittelt mithilfe dieses kostbaren und feierlich strahlenden Bildgrundes das Transzendente, das aus Raum und Zeit Herausgehobene seiner Themen. Die Buchmaler, die Illuminatoren (lat. illuminare bedeutet „mit Licht tränken“, „Glanz verleihen“) – und die Tafelmaler folgten ihnen hierin spätestens seit dem 11./12. Jahrhundert –, verwendeten zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert nur noch partiell das Pinselgold, ein Goldpulver, das mit einem Bindemittel zu streichbarer Farbe angerührt wurde und dessen leicht körnige Struktur das Licht zu lediglich mildem Glanz streut. Sie suchten vielmehr die höchste Strahlkraft des Goldes, indem sie Polimentvergoldung praktizierten: Dabei wird über einen Bolusgrund, d.h. eine Schicht aus gelben oder roten Farbpigmenten, Blattgold aufgetragen und zu Hochglanz poliert. In der Tafelmalerei kann der Goldgrund auch mit punzierten Mustern durchsetzt sein.
Über Blattvergoldung unterrichtet um 1100 ausführlich der bereits erwähnte Traktat des Theophilus Presbyter. In Kapitel XXII beschreibt der Autor die Herstellung von Blattgold durch das Hämmern von Goldblech zu hauchdünnen Blättchen. Mit einer Schere schnitt der Vergolder dann die der gewünschten Form entsprechenden Stücke aus, um, wie Theophilus schreibt, „die Kronen um die heiligen Häupter, die Stolen und Säume der Kleider und das Übrige“ zu schmücken.
Leon Battista Alberti
Einen entscheidenden Bruch im Malen mit Gold bzw. dem Anbringen von Blattgold brachte die Renaissance mit sich. Als der luxuriöse Konsum von Gold und Ultramarin von Auftraggebern und Künstlern primär in Italien mehr und mehr in Frage gestellt wurde, bot sich als Ersatz etwas ganz anderes an – die malerische Raffinesse. Folgerichtig plädierte der bedeutende Architekt und Universalgelehrte Leon Battista Alberti in seinem Traktat über die Malerei 1435/36 für die Qualität der imitatio, der künstlerischen Nachahmung, die den Geldwert teurer Materialien verdrängen sollte. Es gebe, so schrieb er, Maler, die in ihren Bildern viel Gold verwenden, weil sie meinen, das trage zu deren Erhabenheit bei. Er dagegen fordere den Verzicht auf reales Gold, weil die Illusion des Goldglanzes mithilfe einfacher Farben wesentlich mehr Bewunderung und Ruhm eintrage.
Auch wenn nicht jeder Auftraggeber und jeder Maler Albertis Empfehlung folgte, markiert sein Statement doch einen entscheidenden Gesinnungswandel, der für Jahrhunderte zum Verzicht auf Pinsel- oder Blattgold in den Gemälden führte. Erst im 20. Jahrhundert kam es bei dem einen oder anderen Maler wieder zu Ehren. Etwa bei Gustav Klimt. Hat man bisher eine Ravenna-Reise 1903 und das Erlebnis der byzantinischen Mosaiken als auslösendes Moment veranschlagt für Klimts „Goldene Periode“, so ihr Prädikat in der Kunstgeschichte gelten neuerdings auch die Goldpartien in bestimmten japanischen Malereien, insbesondere der Rimpa-Schule (17. Jahrhundert), die der Jugendstilkünstler aus Reproduktionen kannte, als zusätzliche Inspiration. Ich nenne für die moderne Verwendung von Gold auch noch den Österreicher Friedensreich Hundertwasser und insbesondere den Franzosen Yves Klein, einen Künstler, der sich wie kein zweiter im 20. Jahrhundert dem Faszinosum kostbarer Farbsubstanzialität hingegeben hat.