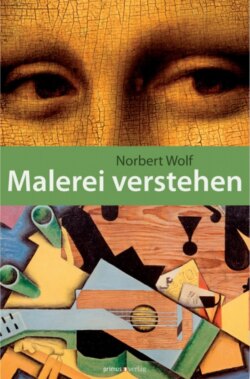Читать книгу Malerei verstehen - Norbert Wolf - Страница 14
Yves Klein und die Materialität der Farbe
ОглавлениеYves Klein
Yves Klein, dessen Karriere bei seinem frühen Tod 1962 nur acht Jahre umfasst hatte, wurde berühmt durch seine monochrom blauen Bilder. Sie sind gemalt in einem faszinierenden Farbton, dem IKB – International Klein Blue –, der mit einem bestimmten Kunstharz als Bindemittel die Intensität des Ultramarins, nur eben ohne Lapislazuli-Pigmente, erreichte. Und man denkt, hört man den Namen dieses Künstlers, an junge nackte Frauenkörper, die dick mit besagtem Blau beschmiert sind und als gleichsam lebende Pinsel auf Leinwänden Abdrücke ihrer selbst, abstrahierte, entmaterialisierte Zeichen ihrer Leiblichkeit hinterließen.
Monochrome
Der von dem so überwältigenden Blau imprägnierte Bildträger vermittelt die Wirkung einer unwirklichen Räumlichkeit. Der satte Farbton wird zur unergründlichen Tiefe – ein spiritueller Nachhall jener melancholischen Sehnsüchte und Fernwehträumereien, die die Malerei und Dichtung der Romantik mit dem Blau verband. Ende der fünfziger Jahre fügte Klein dann Naturschwämme in diese blauen Gründe ein. Intendieren die puren Monochrome das Verschwinden des Sichtbaren, die Rückkehr der Malerei zum all-over des uranfänglichen Nichts, so ruft die mit Farbe vollgesogene Substanz der Schwämme eine neue Körperlichkeit ins Leben (Abb. 3).
Monogolds
1959 rezitierte Klein in einer Galerie den Satz des französischen Philosophen Gaston Bachelard, wonach am Anfang das Nichts stehe, danach ein abgründiges Nichts, schließlich eine blaue Tiefe komme. Der Ausstellungskurator, so Klein später, habe ihn nach dem Preis eines solchen unsichtbaren Werks gefragt und er habe ein Kilo reinen Goldes vorgeschlagen. Künstlerische Sensibilität, das will Klein damit sagen, ist nicht zu kaufen wie irgendeine Ware, sondern allenfalls zu tauschen gegen einen gleichrangigen Wert, eine gleich erhabene und poetisierbare Materie. Kein Wunder, dass Yves Klein seit 1960 das Gold auch als Farbe nutzte, in den Monogolds, den Tafeln, auf denen Blättchen aus Gold im Lufthauch wie im göttlichen Anhauch erzittern.
Abb. 3 Yves Klein: Relief Éponge Bleu (Blaues Schwammrelief), 1958, Schwämme, Pigment und Kunstharz auf Pressspanplatte, Köln, Museum Ludwig.
Als 1979 ein Erdbeben und anschließende Unwetter Teile der Basilika der heiligen Rita von Cascia in Italien zerstörten und im Anschluss daran Ausbesserungsarbeiten eingeleitet wurden, bat der Restaurator die Nonnen um Blattgold. Sie drückten ihm ein Exvoto in die Hand. Der Kirchenmaler erkannte sofort, dass es von Yves Klein stammte, der es 1961 dort auf einer Pilgerfahrt niedergelegt hatte: Ein handlicher Kasten aus Plexiglas, ein modernes Reliquiar, in drei horizontale Segmente gegliedert, beinhaltete unten drei kleine, in blaues Pigment eingelegte Goldbarren, in der Mitte einen beschrifteten Zettel, oben weisen drei Fächer ein rosa Pigment, ferner Ultramarinblau und schließlich Blattgold auf. Der Zetteltext ist ein an die heilige Rita adressiertes Gebet, mit der berührenden Bitte endend, dass „alles, was von mir ausgeht, schön sei“.
Schönheit der Farben, das ist eine Kategorie, die sich zwar nicht ausschließlich, aber zu einem guten Teil den jeweiligen materiellen Bestandteilen der Farbmittel verdankt. Solche Ästhetik verbindet sich in der Wahrnehmung mit sinnesphysiologischen Farbreizen, aber auch mit den einer bestimmten Kultur und einer bestimmten Kunstepoche eigenen Gewohnheiten, Farben zu komponieren, zu nuancieren, sie psychologisch zu interpretieren. Die komplizierten Wechselbeziehungen in allen Facetten zu beschreiben, würde ein eigenes Buch füllen. Deshalb werde ich in den folgenden Kapiteln nur Sondierungen vornehmen können.