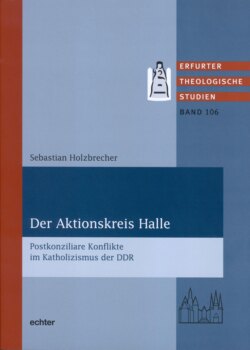Читать книгу Der Aktionskreis Halle - Sebastian Holzbrecher - Страница 23
1.2.4Bundesdeutsche Solidaritätsgruppen
ОглавлениеFür die Gründung und Organisation des späteren AKH ist schließlich eine weitere Entwicklung bedeutsam geworden. In den späten sechziger Jahren kam es weltweit zur Gründung von sogenannten Priestergruppen bzw. Solidaritätsgruppen (SOG).179 Gerade im Jahr 1968 wird man den Aufbruch einer jungen Generation nicht vernachlässigen dürfen. Doch der entscheidende Impuls für diese Gruppen ist in dem Bemühen zu sehen, die durch das Konzil begonnenen Reformansätze in konkrete Maßnahmen und Institutionen zu überführen, dem Geist der Erneuerung, der allenthalben spür- und greifbar schien, auch tatsächlich Raum in der Kirche zu gewähren.180 In der Bundesrepublik Deutschland waren im Jahr 1969 10% der katholischen Priester in einer Solidaritätsgruppe organisiert.181 Die Mitgliederzahl der einzelnen Gruppen schwankte zwischen 15 und 180, jedoch waren die Gruppen der ersten Stunde zunächst homogen von Priestern besetzt und geprägt. Bei den Gruppen der zweiten Gründungswelle ist der Unterschied zwischen Priestern und Laien schon „unprogrammatisch überspielt worden.“182 Entgegen mancher kirchenamtlicher Einschätzung, begriffen sich die Solidaritätsgruppen als Teil der Lösung und nicht des Problems.183 Eine offizielle Auseinandersetzung mit den Bischöfen hat nicht stattgefunden, vor allem auch deshalb, weil die Solidaritätsgruppen in der äußeren Wahrnehmung ihren Zenit bereits 1970 überschritten hatten und sich zudem die offiziellen Priestergremien zwar nur mühsam entwickelten, aber dennoch sukzessive Gestalt annahmen.184 Schließlich darf nicht vergessen werden, dass es sich bei den Akteuren insgesamt um eine Minorität im bundesdeutschen Katholizismus handelte, die zwar in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals das Bild einer „zerstrittenen Kirche“185 hinterließ, das aber „der Wirklichkeit so nicht entsprach.“186 Der Hauptvorwurf gegenüber den Solidaritätsgruppen lautete, dass sie in den Kernfragen erfolglos geblieben seien. Anstatt bei den Themen Zölibat, Mischehe, Priesterbild und Demokratisierung eine Veränderung angestoßen zu haben, habe sich im Gegenteil nur die Haltung der Kirchenleitung restriktiv verfestigt.
Am 27. Mai 1969 hatten sich die zahlreichen Gruppen und Aktionskreise zur „Arbeitsgemeinschaft von Priestergruppen in der Bundesrepublik“187 (AGP) zusammengeschlossen, die sich 1971 in „Priester- und Solidaritätsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland“ unbenannte.188 Die AGP hatte eine Hauptversammlung, einen gemeinsamen Sprecherkreis und einen Arbeitsausschuss.189 In der 1969 verabschiedeten Basiserklärung der AGP benannten die Gruppen drei Hauptziele ihrer Arbeit: „Neuinterpretation des Glaubens“, „Humanisierung der Kirche“, „Demokratisierung der Kirche“.190 Struktur und Ziele sollten für den AKH noch von Bedeutung werden.
Besonderen Einfluss auf die theologische Bewertung der Legitimität der Priester- und Solidaritätsgruppen hatte Karl Rahner.191 Rahner zeigte, dass es derartige Gruppen im Leben der Kirche geben muss und auch immer gegeben hat. Gerade wenn es in der Kirche notwendig ein charismatisches Moment gibt, das nicht allein durch das kirchliche Amt verwaltet und repräsentiert werden kann und darf, seien diese Gruppen wichtig und nötig.192 Denn sie verleihen dem Charismatischen in der Kirche Konkretheit und Effizienz.193 Weil sich diese Gruppen besonders dadurch auszeichneten, dass sie nicht Ausfluss positiven kirchlichen Rechtes sind und sich von sich aus gründeten, bedürften sie „grundsätzlich auch keiner offiziellen Approbation von oben.“194 Trotz ihres „parakanonischen Charakters“195 dürften sie nicht von vornherein unter dem Verdacht stehen, schismatisch zu sein. Dies sei vor allem dann zu beachten, wenn sich die Priestergruppen „in einem gewissen Gegensatz zu den Bischöfen als Leitern der Kirche“196 befinden. Gerade für die ostdeutsche Situation barg eine solche Feststellung eine nicht zu unterschätzende Brisanz in sich.
Ende 1968 hatten sich das Kommissariat Magdeburg und hier besonders die katholische Kirche in der Stadt Halle zu einem Schmelztiegel von Reformbewegungen entwickelt. Besonders junge Akademiker sahen in den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils zum Kirchenverständnis, Laienapostolat und zum Weltdienst der Christen einen Impuls, die Situation der katholischen Kirche in der DDR theologisch neu zu bewerten. Die strikt durchgehaltene Abstinenzpolitik der katholischen Bischöfe gegenüber der sozialistischen Gesellschaft schien ihnen nicht erst seit dem Konzil anachronistisch. Aber durch seine Aussagen sahen sie ihre Position in besonderer Weise legitimiert. Dass sich in Halle ein weitverzweigtes Netzwerk reformorientierter Katholiken etablieren konnte, dürfte sowohl an begünstigenden personellen als auch institutionellen Rahmenbedingungen gelegen haben. Die ausgezeichneten Verbindungen der in Magdeburg eingesetzten Paderborner Priester sowie der Studentengemeinden nach Westdeutschland scheinen nicht unwesentlich dazu beigetragen zu haben, dass das Erzbischöfliche Kommissariat trotz der seit 1961 bestehenden staatlichen Isolation infolge der Errichtung der innerdeutschen Grenze am Pulsschlag des internationalen Katholizismus blieb. Der weitgehend inoffizielle Import westlicher theologischer und soziologischer Literatur stieß zwar bei den ostdeutschen Bischöfen auf Skepsis, verstärkte jedoch nur ein ohnehin existentes Reformbestreben, das aus der Situation der Kirche unter einer sozialistischen Diktatur erwuchs. Die zunehmende Verschärfung der Autoritäts- und Priesterkrise 1968, die zeitgleiche Erlahmung der Konzilsrezeption und das Erstarken restaurativer Kräfte, die Niederschlagung des Prager Frühlings, das Ende des Erfurter Gesprächskreises, das Ende des „Hallenser Experimentes“ mit dem Sprachenkurs und der Studentengemeinde sowie das vielfach ungenutzte Potential und Mitspracherecht der katholischen Akademiker, all das hatte für diejenigen, die im Konzil einen Aufbruch der Kirche erblickt hatten, das Fass der Enttäuschungen randvoll gefüllt. Die Nachfolgeregelung für den Paderborner Weihbischof in Magdeburg im Jahr 1969 stellte insofern den sprichwörtlichen Tropfen dar, der den postkonziliaren Reformelan auf breiter Front entfesselte.