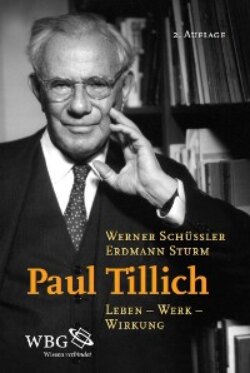Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 10
§ 2 Die Entdeckung der Spätphilosophie F. W. J. Schellings
ОглавлениеVon 1904 bis 1909 studierte er Theologie an den Universitäten Berlin, Tübingen und Halle. In einem von Thomas Mann für seinen Roman „Doktor Faustus“ von Tillich erbetenen Bericht erfahren wir Näheres über seine Studienzeit in Halle und seine Stellung zu den damaligen theologischen Schulen und Richtungen (vgl. G XIII, 23–27). Die positiv-konservative Vermittlungstheologie Martin Kählers, ihre Betonung der paulinisch-lutherischen Rechtfertigungslehre, ihre Einsicht in den dämonischen Charakter der menschlichen Existenz haben ihn stärker bestimmt als die liberale Theologie, die sich auf die Bastion der sittlichen Persönlichkeit zurückgezogen, im Übrigen aber die gesamte Wirklichkeit, Natur und Geschichte, dem „Mechanismus der bürgerlichen Weltanschauung“ (G XIII, 25) überlassen hatte. An dieser Grundentscheidung gegen die liberale Theologie und für eine Theologie, in deren Zentrum die Paradoxie der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein aufgrund des Glaubens steht, hat Tillich zeitlebens festgehalten. Prägend war für ihn insbesondere die Einsicht seines Lehrers Martin Kähler, „daß auch unser Denken gebrochen ist und der Rechtfertigung bedarf, und daß darum Dogmatismus die intellektuelle Form des Pharisäismus ist“ (G XIII, 24).
Zeitlebens prägend war für ihn aber auch die Spätphilosophie F. W. J. Schellings, also die 1809 erschienene Schrift „Über das Wesen der menschlichen Freiheit“ und die „Vorlesungen zur Philosophie der Mythologie und Offenbarung“. Tillich unterscheidet zwei Perioden im Denken Schellings: „Schelling I“ meint dessen noch ganz dem Deutschen Idealismus verhaftete sog. negative Philosophie, „Schelling II“ die über den Deutschen Idealismus hinausführende, sog. positive Philosophie. Unter der negativen Philosophie ist die Philosophie der reinen Vernunft ohne Rückgriff auf die Erfahrung zu verstehen, ein Apriorismus im Sinne Kants also, der vom Reich der Ideen handelt, aber nichts aussagt über das Gegebene. Von der konkreten Wirklichkeit wird in ihr also abgesehen. Von dieser jedoch handelt die positive Philosophie.
Mit der Spätphilosophie Schellings beschäftigen sich die 1910 in Breslau vorgelegte philosophische Dissertation über „Die religionsgeschichtliche Konstruktion in Schellings positiver Philosophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien“ (vgl. E IX, 154–272) und die 1912 in Halle vorgelegte theologische Lizentiaten-Dissertation „Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung“ (vgl. M I, 21–112). Tillich deutet in diesen akademischen Arbeiten den späten Schelling nicht in Antithese zum transzendentalen Idealismus, etwa von Jakob Böhme und der Theosophie her, sondern im Duktus des bisherigen Denkens Schellings selbst, des vom transzendentalen Idealismus thematisierten Problems der Selbstkonstitution des Ich. Demnach ist das Spätwerk Schellings als „Vollendung des Idealismus“ (Walter Schulz) zu charakterisieren.
Tillichs Darstellung der Religionsphilosophie Schellings ist als Kritik an Troeltschs „Absolutheit des Christentums“ zu verstehen. Das gilt vornehmlich für die philosophische Dissertation von 1910, deren ursprünglicher Titel „Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte in Schellings positiver Philosophie“ dies auch zum Ausdruck bringt. Tillich sieht den Unterschied zwischen Troeltsch und Schelling gerade in dem, was man als „Vollendung des Idealismus“ bezeichnet hat. Im Blick auf die Differenz zwischen der Absolutheitsthese Troeltschs und der religionsgeschichtlichen Konstruktion Schellings schreibt er: „Wenn zwei so hervorragende Kenner der Religionsgeschichte wie Schelling und Tröltsch … zu so entgegengesetzten Resultaten kommen, dann liegt das aber an der Verschiedenheit des Gottesgedankens. Tröltsch hat nie aus seiner Übereinstimmung mit einem Euckenschen, d.h. aber modificiert Fichteschen Idealismus ein Hehl gemacht. Er steht damit auf einer Stufe der idealistischen Gesamtentwicklung, die vor Schellings Freiheitslehre liegt. Die erste Aufgabe ist es zu zeigen, wie Schelling über diese Epoche hinausgeschritten ist bis zu dem Endpunkt seiner Entwicklung, der positiven Philosophie.“3
Gott steht für Schelling nicht unter der Herrschaft des Begriffs der unveränderlichen Substanz, sondern er denkt ihn als aktuelle, lebendige, geistige Persönlichkeit. Schellings Methode beschreibt Tillich so: „Sie beginnt mit der Erfassung der Prinzipien in der Selbsterfassung der geistigen Persönlichkeit. Sie zeigt, daß in dieser Selbsterfassung ein Hinausgehen über die individuelle Subjektivität unmittelbar gegeben ist, insofern diese auf einer Verkehrung der Prinzipien beruht, deren Unwahrheit zugleich mit der Wahrheit des überindividuell Geistigen zum Bewußtsein kommt. Sie steigt auf diese Weise zum Gottesgedanken auf, um von da aus wieder herabzusteigen zur Naturphilosophie und am Ende derselben in der Anthropologie ihr Ziel zu erreichen und zugleich ihren Ausgangspunkt spekulativ zu rechtfertigen. Konkret gestaltet sich die Entwicklung folgendermaßen: Das Individuum erfaßt sich als freie, geistige Einheit eines subjektiven und eines objektiven Prinzips; zugleich aber wird es sich bewußt, daß, empirisch betrachtet, diese Einheit durch die Herrschaft des subjektiven Prinzips zerstört ist. Da aber das Individuum weiß, sich in jener Geistigkeit in seiner eigentlichen Wahrheit erfaßt zu haben, wird es auf einen objektiven, überindividuellen, absoluten Geist geführt, in dem die Prinzipien in vollkommener Freiheit und Geistigkeit realisiert sind. Hat auf diese Weise die Erhebung des individuellen Geistes über sich selbst zum absoluten Geist geführt, so muß jetzt die Herablassung des absoluten Geistes zum individuellen betrachtet werden; dies ist der positiven, empirischen Seite nach Aufgabe der positiven Philosophie als Lehre von der Schöpfung, von der rationalen Seite Aufgabe der Naturphilosophie.“ (E IX, 234) Schelling hat also erkannt – und Tillich unterstreicht dies –, dass die Subjektivität sich nicht selber setzen kann, dass sie vielmehr nur in ihrer ursprünglichen Bezogenheit auf Gott, den absoluten Geist, sie selber sein kann. Ihre Freiheit ist vermittelte Freiheit. Der individuelle Geist muss über sich selbst zum absoluten Geist geführt werden. Genau dieses erschließt sich der Subjektivität durch ihre Selbsterfassung als Geist. Tillichs spätere Rede von der „Tiefe der Vernunft“ erinnert an diese Einsicht Schellings, die Tillich sich offenbar aneignet.4
Der systematisch-theologische Gehalt der philosophischen Schelling-Dissertation ist nicht gering zu achten. Dies gilt aber auch für die zwei Jahre später eingereichte Hallenser theologische Lizentiaten-Dissertation „Mystik und Schuldbewußtsein in Schellings philosophischer Entwicklung“. Allein schon die Aufnahme und Bearbeitung der in der protestantischen Theologie verpönten Begriffe „Mystik“, „mystische Identität mit Gott“ (M I, 83) oder der „unio mystica“ (E IX, 385), die Tillich sich durch Schelling vorgeben lässt, ist bedeutsam. Der Begriff der Mystik markiert eine Problematik protestantischer Theologie, die durch die Theologie Ritschls für Tillich aktuell geworden war und die nach dem Ersten Weltkrieg in Gestalt der Dialektischen Theologie Barths und Gogartens erneut aufbrechen und Tillich zum Widerspruch herausfordern wird.5 Die mit dem Begriff „Mystik“ gewiss nicht eindeutig umschriebene Problematik wird Tillichs Thema bleiben.
In der genannten theologischen Dissertation arbeitet Tillich das Thema wiederum am Stoff von Schellings Spätphilosophie durch. Die prinzipielle Lösung, die er bei ihm findet, lässt sich als „Synthese von Mystik und Schuldbewußtsein“ (M I, 77) namhaft machen. Hinter dieser Synthese steht die unauflösliche Einheit von Wesen und Widerspruch, „die große Synthese von Identität und Gegensatz“ (M I, 84). „Je mehr Wesen, desto größer der Widerspruch, desto höher die Synthesis; in der absoluten Synthesis setzt sich das Wesen in Ewigkeit durch gegen den absoluten Widerspruch, die Freiheit gegen die Notwendigkeit, das Rationale gegen das Irrationale, das Licht gegen die Finsternis; diese Synthesis aber ist Gott.“ (M I, 80) Diese Einheit ist in allen Dingen; auch im Menschen bildet sie sich analog ab. So ist die Zeit Widerspruch gegen die Ewigkeit. „Zeit ist das schlechthin Andere der Ewigkeit, die Ewigkeit unter der Bestimmung des Widerspruchs, wie Natur der Geist unter der Bestimmung des Widerspruchs ist.“ (M I, 90) Der Widerspruch lebt also aus seiner Einheit mit dem Wesen – unter der Bestimmung des Nein. Das Nein lebt vom Ja. Das ist eine These, die auch für Tillichs späteres Denken grundlegend ist und die er z.B. gegen die Dialektische Theologie, aber auch gegen das protestantische Prinzip, sofern sie sich auf ein Nein beschränken und nicht das Ja voraussetzen, zur Geltung bringen wird. Für das Schuldbewusstsein heißt dies, dass es „das Bewußtsein um die wahre Einheit in sich [schließt]“. „Je tiefer und absoluter das Schuldbewußtsein, desto höher die Erfassung der wahren Identität. Ja und Nein stehen auch hier in voller Absolutheit nebeneinander und ineinander. Es ist das Wesen aller Flachheit des Geistes, diese Identität des Widerspruchs abschwächen zu wollen.“ (M I, 91f.) So gehören dann auch Gottes Zorn und Gnade zusammen. „Das Band bleibt unzerrissen, auch wenn es unter dem Zeichen des Gegensatzes steht.“ (M I, 93)
Tillich sieht in dieser Einheit von Ja und Nein eine Lehre, die „religiös von allerhöchster Bedeutung“ ist: „Sie entnimmt diejenigen Zustände, in welchen der Mensch sich von Gott fern fühlt und die einzige Empfindung Furcht ist oder gar Gleichgültigkeit, der atheistischen Beurteilung und behauptet auch für sie die Identität mit Gott, freilich mit dem, dessen Wille Zorn ist.“ (M I, 93) Hier ist Tillichs These von der Rechtfertigung des Zweiflers, ja des Gottlosen, die er 1919 ausarbeiten wird, bereits vorweggenommen. Dass Tillichs Lehrer an der theologischen Fakultät Halle, die seine Dissertation zu begutachten und zu bewerten hatten, den Gehalt dieser Arbeit und insbesondere seine zentrale, die Theologie herausfordernde These offensichtlich nicht wahrgenommen haben, ist bemerkenswert.6
In seiner während des Ersten Weltkrieges ohne große Sorgfalt ausgearbeiteten und 1915 von der theologischen Fakultät Halle angenommenen Habilitationsschrift „Der Begriff des Übernatürlichen, sein dialektischer Charakter und das Prinzip der Identität dargestellt an der supranaturalistischen Theologie vor Schleiermacher“ (vgl. E IX, 439–592) behandelt Tillich die Widersprüche des Supranaturalismus-Begriffs. Er geht dabei von dem in der theologischen Dissertation im Anschluss an Schelling entwickelten Identitätsprinzip aus. In der supranaturalistischen Theologie vor Schleiermacher, die er durch viele Zitate belegt, sieht er eine das Identitätsprinzip leugnende, entschieden antimystische Theologie. Ein adhaerere Deo, eine mystische Identität mit Gott wird von ihr abgelehnt. „Und so kommt es, daß Gott lediglich als Träger des höchsten Gutes, als Vollstrecker der moralischen Weltordnung aufgefaßt wird.“ (478) Das Supra der supranaturalistischen Methode zwingt, „jede Ineinssetzung von objektiver Offenbarung und fragendem Subjekt zu bestreiten“ (588), also eine nur subjektive Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit zuzulassen. Supranaturalistische Theologie ist, so Tillichs These, nur eine Wahrscheinlichkeitstheologie. Auch die Thematik der Gewissheit wird Tillich in seiner Arbeit „Rechtfertigung und Zweifel“ von 1919 weiterführen und mit dem Identitätsprinzip verbinden.
3 P. Tillich, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte in Schellings positiver Philosophie, unveröffentl.: Amerikanisches Paul-Tillich-Archiv an der Andover-Harvard Theological Library, Cambridge, Mass., Box 101/2, Bl. 7. Das Manuskript stellt die ursprüngliche Version der philosophischen Dissertation dar und ist leider in der Edition der Dissertation in E IX nicht berücksichtigt worden.
4 “Die Vernunft widerspricht nicht der Offenbarung. Sie fragt nach der Offenbarung, denn Offenbarung bedeutet die Integration der in sich zwiespältigen Vernunft.“ (S I, 113)
5 Vgl. dazu H. Fischer, Theologie des positiven und kritischen Paradoxes. Paul Tillich und Karl Barth im Streit um die Wirklichkeit, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 31 (1989) 196–212; ders., Sinn und Funktion des Begriffes Mystik in Tillichs frühen Schriften, in: G. Hummel/D. Lax (Hg.), Mystisches Erbe in Tillichs philosophischer Theologie/Mystical Heritage in Tillich’s Philosophical Theology (= Tillich-Studien, hg. von W. Schüßler u. E. Sturm, Bd. 3), Münster, 2000, 33–50.
6 Vgl. dazu den Bericht von G. Wenz über die Voten von W. Lütgert, F. Kattenbusch, M. Kähler u.a. in: MI, 21.