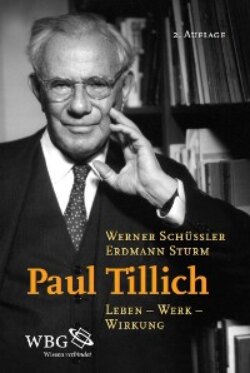Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 11
§ 3 Im kirchlichen Dienst in der Heimat und an der Westfront (1908–1918)
ОглавлениеNach dem ersten theologischen Examen (1908) stand Tillich zehn Jahre im kirchlichen Dienst, zunächst in der Umgebung von Berlin, dann während des ganzen Ersten Weltkrieges als Feldprediger in verschiedenen Kampfgebieten an der Westfront.
In die Zeit seiner Tätigkeit in der Kirchengemeinde Berlin-Moabit (1911/12) gehören seine apologetischen Vorträge, mit denen er sich an einen Kreis von Gebildeten wandte, die an philosophischen und kulturellen Fragen interessiert waren, aber der Kirche fern standen. Er lud zu „Vernunft-Abenden“ ein. Die Stoßrichtung gegen den Skeptizismus und Relativismus ist eindeutig: „Den Mut zur Wahrheit wollen wir wiedergewinnen.“ (G XIII, 61)
In den Gemeindepredigten7 behandelte er jeweils unter einem von ihm selbst gewählten Schriftwort Glaubens- und Lebensprobleme. In ihnen spricht der Systematiker, aber auch der Apologet und Seelsorger.
Im September 1914 meldete er sich freiwillig als Feldgeistlicher. Kurz vor seiner Abreise an die Westfront heiratete er Greti Wever. Seine Feldpredigten8 spiegeln das innere Erleben des Krieges wider, vom Siegeswillen bis zum Abgrunderlebnis. In einer Predigt aus dem Jahre 1916, nach der Schlacht von Verdun, heißt es: „Wir haben uns alle ausnahmslos getäuscht in der Welt und dem, was sie uns geben kann. … Auch die, die wenig Anteil hatten an den Gütern der Kultur, haben ihre Hoffnung … auf die Kultur gesetzt. … Nun sind wir alle aufs Tiefste erschreckt vor dem Abgrund, der sich uns geöffnet hat. Nun sind wir mit Grauen erfüllt vor dem, was Leben und Kultur und Menschen in Wahrheit uns gegeben haben. Was anders als die Hölle auf Erden! Zerbrochen ist unser Glaube an die Welt, zerbrochen unser Glaube an die Kultur, zerbrochen unser Glaube an die Menschheit. Seht, das ist es, was unsere Seelen bewegt, das ist die ungeheure Last, an der wir jetzt alle tragen, das ist der tiefe Schmerz, von dem alle anderen Schmerzen, um unsere Toten, um das Leiden, das die Wunden bereiten, um das Elend derer, die in der Heimat weinen, nur ein Teil sind. Der Schmerz über das Leben selbst, das ist das Tiefste in allem Leiden und Mitleiden.“ (E VII, 498f.)
Durch den befreundeten Kunsthistoriker Eckart von Sydow lernt Tillich die Malerei des Expressionismus kennen und besucht die Ausstellung des „Blauen Reiter“. Während eines Fronturlaubs wird ihm die Betrachtung von Sandro Botticellis „Madonna mit Kind und singenden Engeln“ im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum zum Erlebnis, das er später so beschrieb: „In einem Moment, für den ich keinen anderen Namen als den der Inspiration weiß, eröffnete sich mir der Sinn dessen, was ein Gemälde offenbaren kann. Es kann eine neue Dimension des Seins erschließen, aber nur dann, wenn es gleichzeitig die Kraft hat, die korrespondierende Schicht der Seele zu öffnen.“ (G IX, 345)
7 Zu Tillichs Lebzeiten unveröffentl., jetzt in: E VII, 19–353.
8 Ebenso zu Tillichs Lebzeiten unveröffentl., jetzt in: E VII, 355–665.