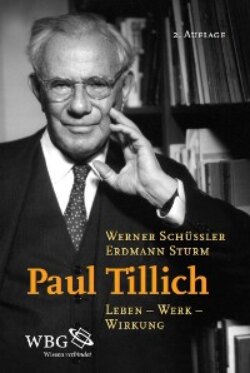Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 13
§ 5 Kairos-Kreis und Religiöser Sozialismus
ОглавлениеIn Berlin hatte sich 1920 ein religiös-sozialistischer Arbeitskreis um Carl Mennicke gebildet, der sog. Kairos-Kreis.12 Ihm gehörten die Nationalökonomen Adolf Löwe, Alexander Rüstow, Eduard Heimann und Arnold Wolfers und die Theologen Günther Dehn und Karl Ludwig Schmidt an. Tillich schloss sich ihnen an, er wurde der Kopf der Gruppe. Man theoretisierte über den Geist der Zeit, über die religiöse Lage, über den Sozialismus. Ihre Zeitschrift „Blätter für religiösen Sozialismus“ zeichnete sich durch ein hohes intellektuelles Niveau aus, blieb aber politisch bedeutungslos. In ihr publizierte Tillich Aufsätze zum Thema „Christentum und Sozialismus“, so auch seinen systematischen Entwurf „Grundlinien des religiösen Sozialismus“ (vgl. M III, 103–130).
Tillichs religiöser Sozialismus versteht sich als eine Bewegung, nicht als Teil einer Partei oder der Kirche. Wie der Sozialismus stellt er die bürgerlich-kapitalistische Ordnung in Frage. Eine neue Gesellschaftsordnung soll und wird an die Stelle der alten Ordnung treten. Das Proletariat, die Verkörperung der Frage nach Lebenssinn, ist der Träger des Neuen. Die Frage nach dem Sinn der Geschichte stellt sich neu.
Ein ethisches und ein eschatologisches Motiv greifen in den Debatten und Schriften des Kreises ineinander. Die Idee des Sozialismus versteht man als Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, als „neues ethisches Ideal“, das für alle Menschen Geltung hat. Die Ethik der christlichen Liebe, so heißt es in einer der frühen Schriften, erhebt Anklage „gegen den grundsätzlichen Egoismus der Privat- und Profitwirtschaft, die ihrem Wesen nach ein Kampf aller gegen alle ist, und fordert eine Wirtschaft der Solidarität aller und der Freude nicht am Gewinn, sondern am Werk selber“ (M III, 33). Entsprechend wird auch der grundsätzliche Egoismus der nationalen Machtpolitik angeklagt. Das zweite (eschatologische) Motiv ist das Kairos-Bewusstsein. „Kairos“ ist die „rechte Zeit“, der inhalts- und bedeutungsvolle Zeitmoment, erfüllt mit unbedingtem Gehalt und unbedingter Forderung, der Augenblick, in dem Gegenwärtiges und Zukünftiges, Gegebenes und Gefordertes sich berühren. Dieser Kairos geschieht „weltlich“, in den äußeren gesellschaftlichen Erschütterungen und Umwälzungen. Gott ist nicht ein Gott der Innerlichkeit gläubiger Individuen oder der Kirche, sondern ein Gott, der sich in der Welt geschichtsmächtig offenbart in Gericht und Gnade, also im Niederreißen und Aufbauen, im Erschüttern und Umwenden gesellschaftlicher Zustände und Strukturen. Gott handelt jetzt, in der Geschichte, nicht erst am Ende der Tage. Das Reich Gottes bricht ein in unsere reale Menschenwelt. Reich Gottes und Sozialismus berühren und verbinden sich. Gott „realisiert sich“ in unserer Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft.
Tillichs erstes größeres systematisches Werk ist sein 1923 erschienenes „System der Wissenschaften“ (vgl. M I, 113–263), eine Ortsbestimmung der Theologie als Wissenschaft unter den Wissenschaften. Er geht darin von dem theonomen Charakter alles Erkennens aus, dem „Verwurzeltsein des Denkens im Unbedingten“ (G XII, 35). Was unausdrücklich Voraussetzung alles Erkennens ist, das macht die Theologie ausdrücklich zum Gegenstand.
12 Vgl. dazu die Mitteilungen von E. Heimann, in: E. Amelung, Die Gestalt der Liebe. Paul Tillichs Theologie der Kultur, Gütersloh 1972, 215–217.