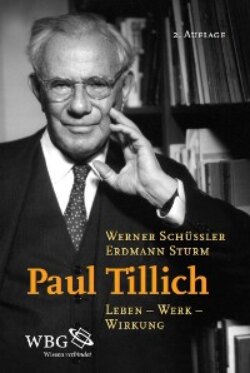Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 17
§ 9 Glaube als „Mut zum Sein“ im Zeitalter der Leere und Angst (New York, 1945–1955)
ОглавлениеNach dem Kriege wendet sich Tillich wieder theologischen Themen zu. Zunächst greift er drei Themen seiner Theologie auf: seine Idee einer theonomen Kultur, seine am Identitätsprinzip orientierte, ontologisch ausgerichtete Religionsphilosophie und das Problem ontologischer Rede von Gott.
In seinem 1946 gehaltenen Vortrag „Religion and Secular Culture“ (vgl. M II, 197–207, dt.: G IX, 82–93) gibt er einen autobiographisch gefärbten Rückblick auf seine nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte Idee einer Theologie der Kultur: „Der kairos, den wir nahe herbeigekommen wähnten, war das Kommen eines neuen theonomen Zeitalters, das die zerstörerische Kluft zwischen Religion und Kultur beseitigen sollte.“ (G IX, 87) Doch die Geschichte sei einen anderen Weg gegangen. Ein neues Element sei ins Bild gekommen: die Erfahrung des Endes. Habe nach dem Ersten Weltkrieg die Stimmung eines neuen Anfangs vorgeherrscht, so nach dem Zweiten Weltkrieg die Stimmung des Endes. „Theologie der Kultur“ sei heute vor allem eine Theologie des Endes der Kultur, der „Leere“. Tillich deutet die Erfahrung der „Leere“, des geistigen Vakuums, religiös, indem er sie als ein Warten, ein Noch-nicht, ein Von-oben-her-Gebrochensein, sozusagen als „heilige Leere“ (sacred void) versteht. So gesehen, widerlege die Erfahrung der Leere nicht seine Idee einer Theonomie, wenn nur diese Leere nicht vorschnell verdrängt, sondern ehrlich und ernsthaft angenommen und ausgehalten wird im geduldigen Warten auf eine Antwort.
Ebenso aus dem Jahre 1946 stammt sein Aufsatz „The Two Types of Philosophy of Religion“ von 1946 (vgl. M IV, 289–300, dt.: G V, 122–137). Darin unterscheidet er in der Religionsphilosophie einen ontologischen und einen kosmologischen Typ. Für den ontologischen Typ ist Gott die Voraussetzung alles Fragens nach Gott, also auch des Zweifels an Gott. Gott kann niemals erreicht werden, wenn er nur Gegenstand der Frage ist und nicht auch schon ihre Voraussetzung. Dies ist Tillichs seit seinen Schelling-Dissertationen bekannte Position. Für den kosmologischen Typ gibt es nur eine mittelbare, durch Beweisführung auf Grund von Autorität ermöglichte Gotteserkenntnis. Der kosmologische Typ aber setzt den ontologischen Typ voraus und baut auf ihm auf.
In seiner auf eine Vorlesung von 1951 zurückgehenden Schrift „Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality“ (vgl. M IV, 357–388, dt.: G V, 138–184) konfrontiert Tillich das philosophische Reden von Gott mit der konkreten, bildhaften Sprache der Bibel. Die Korrelation von Ontologie und biblischer Religion hält er für eine notwendige, aber unendliche Aufgabe. Ausdrücklich gegen Pascal behauptet er: „Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott der Philosophen ist der gleiche Gott. Er ist Person und die Negation seiner selbst als Person.“ (G V, 184)
Im Jahre 1948 veröffentlichte Tillich zwei Bände, mit denen er sich erstmalig einem breiteren theologisch-kirchlichen Leserpublikum in den USA präsentierte, die bald darauf auch ins Deutsche übersetzt wurden und ihn in Deutschland als einen Denker des Protestantismus und Prediger vorstellen. Es handelt sich um die Aufsatzsammlung „The Protestant Era“, die in deutscher Übersetzung 1950 unter dem Titel „Der Protestantismus. Prinzip und Wirklichkeit“ erschien, und um den Predigtband „The Shaking of the Foundations“, der in deutscher Übersetzung unter dem Titel „In der Tiefe ist Wahrheit“ als erster Band seiner „Religiösen Reden“ 1952 veröffentlicht, mehrfach aufgelegt und in mehr als zehn Sprachen übersetzt wurde.
„The Protestant Era“ enthält 18 seit 1922 veröffentlichte Aufsätze, die alle um das Thema „Protestantismus“ kreisen. Unter „Protestantismus“ versteht er die geschichtliche Verkörperung eines Prinzips – des „protestantischen Prinzips“ –, das in allen großen Religionen und Geschichtsperioden der Menschheit wirksam ist, durch die jüdischen Propheten verkündet wurde und manifest ist „im Bilde Jesu als des Christus“. Mit dem „Bild Jesu als des Christus“ ist nicht der historische Jesus als Gegenstand der Geschichtsforschung gemeint, sondern das neutestamentliche Glaubenszeugnis von Jesus als dem Christus. Das protestantische Prinzip bedeutet den göttlichen und menschlichen Protest gegen jeden Absolutheitsanspruch, der für eine endliche Wirklichkeit erhoben wird.
Der Predigtband „The Shaking of the Foundations“, dem noch zwei weitere Bände folgten23, enthält Predigten, die im akademischen Gottesdienst gehalten und auch von Studierenden „from outside the Christian circle in the most radical sense of the phrase“ gehört wurden. Den von ihm entwickelten Predigttyp nennt er „apologetisch“. Dem entspricht in der deutschen Ausgabe der an Friedrich Schleiermacher sich anlehnende Begriff „Religiöse Rede“.
Wollen die Predigten die konkrete menschliche Situation im Lichte der göttlichen Botschaft deuten, so ist es umgekehrt Aufgabe der Theologie, die christliche Botschaft im Horizont der menschlichen Situation zu bedenken und neu auszulegen. In diesem Sinne ist Tillichs opus magnum, die „Systematic Theology“, die andere Ausführung seiner Methode der Korrelation. Im Jahre 1951 erschien der erste Band, 1957 der zweite, 1963 der abschließende dritte Band.24
Das Konstruktionsprinzip dieses späten Hauptwerks ist bereits seit der Antrittsvorlesung „Philosophy and Theology“ von 1940 bekannt: die Korrelation von existentiell-philosophischer Frage und theologischer Antwort.
Tillichs bekannteste Schrift ist „The Courage to Be“ von 1952 (vgl. MV, 141–230). Wie kein anderes Werk zeigt es ihn im Gespräch mit der Existenzphilosophie, der Psychoanalyse und der zeitgenössischen Literatur (F. Kafka, T. S. Eliot, W. H. Auden, J.-P. Sartre, A. Camus u.a.). Die Grunderfahrung, von der er ausgeht, ist die Nichtigkeitserfahrung, die die Menschen in der westlichen Welt nach zwei Weltkriegen und nach dem Zerbrechen aller tragenden Traditionen und Wertsysteme gemacht haben. Der Sinnkrise entspricht die Grundstimmung der Angst. Der Sinn des Seins hat sich verschlossen. Die Quelle des Mutes zum Sein, der allein die Sinnangst zu verarbeiten in der Lage ist, findet Tillich in der Macht des Seins selber, in dem „Gott über Gott“.
In New York hatte Tillich weniger zu Künstlern und Schriftstellern Kontakt als zu Vertretern und Vertreterinnen der Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Er war Mitglied der New York Psychology Group. Hier begegnete er unter anderen Karen Horney, Gotthard Booth, Seward Hiltner und Rollo May. Seine Schrift „The Courage to Be“, als Antwort auf Rollo Mays „The Meaning of Anxiety“ (1950) geschrieben, belegt dieses Interesse. In seinen „Autobiographical Reflections“ von 1952 berichtet er: „Das Problem der Beziehung zwischen theologischem und psychotherapeutischem Verständnis des Menschen ist mehr und mehr in den Vordergrund meines Interesses getreten. … Ich glaube nicht, daß es heute möglich ist, eine christliche Lehre vom Menschen zu entwickeln und besonders eine verbindliche christliche Lehre vom christlichen Menschen, ohne das ungeheure Material zu benutzen, das die Tiefenpsychologie ans Licht gebracht hat.“ (G XII, 74) Der von Perry Le Fevre herausgegebene Band der Schriften Tillichs über das Verhältnis von Religion und Psychotherapie enthält 26 Beiträge.25
Die Vorlesung „Love, Power, and Justice“ wurde 1954 publiziert, in deutscher Übersetzung 1955. Es handelt sich um eine Ontologie und Ethik von Liebe, Macht und Gerechtigkeit. Alle drei sind Verwirklichungen des Seins-Selbst, sie haben ihre letzte Einheit im Sein-Selbst, in Gott, der Quelle von Liebe, Macht und Gerechtigkeit.
23 The New Being, New York 1955, dt.: Das Neue Sein, Stuttgart 1957; The Eternal Now, New York 1963, dt.: Das Ewige im Jetzt, Stuttgart 1964.
24 Dt.: Systematische Theologie, Bd. I, Stuttgart 1955, 2. veränderte Aufl. 1956; Bd. II, Stuttgart 1958; Bd. III, Stuttgart 1966.
25 P. Tillich, The Meaning of Health: Essays in Existentialism, Psychoanalysis, and Religion, hg. von Perry Le Fevre, Chicago 1984.