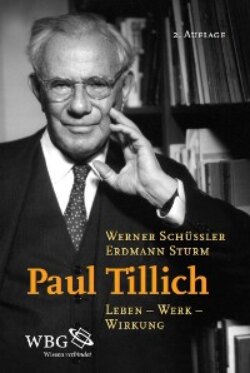Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 14
§ 6 Gläubiger Realismus (Marburg und Dresden, 1924–1929)
ОглавлениеIm Jahre 1924 wurde Tillich zum außerordentlichen Professor für Systematische Theologie an die Universität Marburg berufen. Doch schon ein Jahr später wurde er Professor für Religionswissenschaft an der Technischen Hochschule Dresden, im Jahre 1927 auch Honorarprofessor für Religionsphilosophie und Kulturphilosophie an der Universität Leipzig. Marburg empfand er als provinziell und eng, in Dresden faszinierten ihn das Kulturleben und die Beziehungen zu Künstlern und Künstlerinnen. Seine kleine Schrift „Die religiöse Lage der Gegenwart“ von 1926 (vgl. M V, 27–97) ist ein Dokument seiner Dresdner Kulturtheologie. Sie erschien 1932 in Übersetzung in den USA und hat ihn dort bekannt gemacht.
Seine „Religionsphilosophie“ von 1925 (vgl. M IV, 117–179) lässt sich als Versuch verstehen, sich auf der Grenze von Philosophie und Theologie zu bewegen. Durch die Analyse des Sinnbewusstseins stößt die Philosophie auf den unbedingten Sinn. Der unbedingte Sinn aber ist das eigentliche Thema der Religion. Der Gott der Philosophie und der Gott der Religion ist also intentional, nicht aber real verschieden.
In dem von ihm 1926 herausgegebenen ersten Band von Aufsätzen des Kairos-Kreises13 klingt ein gegenüber den bisherigen religiös-sozialistischen Schriften ganz neuer Ton an. Geschichtsbewusstes Denken, so Tillich in der Einleitung, trage notwendig den Willen zur Gestaltung in sich. Eine Philosophie, die darauf verzichte, gestaltende Philosophie sein zu wollen, habe das Schicksal verdient, „als Sache der Gelehrsamkeit hinter dem Leben her zu gehen und nachzuweisen, wie das, was wirklich war, auch möglich ist“.14 Tillichs Wahrnehmung der geistigen und politischen Wirklichkeit war viel zu wach, um blind zu sein für die Realitätsferne und Ohnmacht der bisherigen theoretischen Debatten seines Kreises. „War nicht doch alles Romantik, Rausch, Utopie?“, fragt er selbstkritisch: „Es ist, als ob ein Reif gefallen wäre auf all die Dinge, … heißen sie Jugendbewegung oder Lebensphilosophie, heißen sie Expressionismus oder religiöser Sozialismus! … Eins ist sicher: es vollzieht sich an all dem, und das heißt an uns, an den Schicksalerfülltesten von uns wieder einmal das Gericht. Was nicht Realität war an dem, was wir taten und dachten, wird verbrannt. Ein Realismus, hart und brutal, tritt hervor. … Es ist nicht der Realismus der in sich ruhenden Endlichkeit, sondern es ist ein Realismus, der offen ist für das Ewige. Es ist gläubiger Realismus.“ (M IV, 181)
Tillich hatte in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erfahren: „Der Geist der bürgerlichen Gesellschaft ist viel zu stark, als daß er durch Romantik, Sehnsucht und Revolution überwunden werden könnte“. Und: „Seine dämonische Kraft ist viel zu groß.“ (M IV, 181) Die neue Haltung, die sich seit Mitte der 20er Jahre in Tillichs Denken abzeichnet, nennt er „gläubigen Realismus“. Der religiöse Sozialismus ist damit nicht verabschiedet, wohl aber die kulturtheologische Schwärmerei der ersten Jahre nach dem Weltkrieg. Tillich sieht in der Malerei eine analoge Wendung vom Expressionismus zur Neuen Sachlichkeit. Hatte der Expressionismus die äußere Form zerbrochen, damit ihre innere Bedeutung sichtbar werde, so wendet sich der neue Realismus wieder der Form zu, um mit ihr auf den Sinngehalt, der unter ihr verborgen ist, hinzuweisen. Realismus und Glaube stehen in der Wirklichkeit und transzendieren die Wirklichkeit – dieses ist die Spannung, die auszuhalten und der nicht auszuweichen ist, weder zur einen noch zur anderen Seite.
Es geht Tillich um das wahrhaft Wirkliche, die unbedingte Seinsmächtigkeit in allem Seienden. Die Wirklichkeit wird transparent für das letztlich Wirkliche – blitzartig, in einer ekstatischen Erfahrung. Religiöse Worte übersteigen die gegebene Wirklichkeit, sie deuten die Spannung zwischen dem Bedingten und dem Unbedingten an. Sie dürfen die unendliche Kluft zwischen dem Bedingten und dem Unbedingten nicht überspielen, wie es der Idealismus tut, sie dürfen Gott nicht auf die Ebene endlicher Objekte herabzwingen („verdinglichen“).
Von hier aus ist auch Tillichs Symboltheorie zu verstehen. In seinem 1928 publizierten Aufsatz „Das religiöse Symbol“ (vgl. M IV, 213–228) charakterisiert er das religiöse Symbol (im Unterschied zu den übrigen Symbolen) als Veranschaulichung des Unanschaulichen, des im religiösen Akt eigentlich und zuletzt Gemeinten. Das Symbol ist also „uneigentlich“. Aber es wohnt ihm eine Macht inne, durch die es sich von vereinbarten und willkürlichen Zeichen unterscheidet. Auch das Wort „Gott“ ist ein Symbol. Einerseits meint es einen anschaulichen Inhalt des religiösen Bewusstseins, ein höchstes Wesen mit bestimmten Eigenschaften, z.B. allmächtig, gerecht, liebend. Aber dieser Gegenstand des Bewusstseins „vertritt“ das eigentlich Gemeinte. Der Bewusstseinsinhalt steht für das eigentlich Gemeinte, das jenseits des Gegensatzes von Subjekt und Objekt steht und niemals Gegenstand sein kann. Von Gott kann also symbolisch und nicht-symbolisch gesprochen werden. „Gott“ ist Gegenstand und sogleich Verneinung des Gegenstandes. Tillich sieht die religiöse Bedeutung des Atheismus darin, dass er an die Notwendigkeit erinnert, Gott als Gegenstand des Bewusstseins zu verneinen.
Gläubiger Realismus heißt aber auch Erkenntnis des Dämonischen im persönlichen wie im geschichtlichen Leben. In seinem Aufsatz „Das Dämonische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte“ von 1926 (vgl. M V, 99–123) zeichnet Tillich das Bild des Dämonischen in der Kunst und Religion der Primitiven. Er stößt dabei auf die „Form der Form-Widrigkeit“, das Wesen des Dämonischen, das er als dämonischen Machtwillen entschlüsselt. Überall sieht er die Urbilder politischer und wirtschaftlicher Dämonie. Freilich, das Dämonische ist keineswegs nur Zerstörung, es ist immer zugleich auch schöpferisch. Die Einsicht in die Dialektik des Dämonischen wird nun spekulativ weitergetrieben zu einer Metaphysik, in der Tillich zur „Seinsunerschöpflichkeit“, zur „aktiven Unendlichkeit des Seins“ vorstößt. Denn, was im Dämonischen gestaltwidrig hervorbricht, ist nichts anderes als der Seinsgrund. Jedes Ding hat seine Tiefe, seinen es tragenden Grund, der zugleich sein Abgrund ist. In jedem Ding lebt der Wille, seine eigene begrenzte Gestalt zu durchbrechen, die Unendlichkeit in sich als Einzelnem haben zu wollen, „den Abgrund in sich zu verwirklichen“ (M V, 103). Dies gilt auch im geschichtlich-politischen Leben. Alle Geschichte ist Geschichte des Kampfes zwischen dem Dämonischen und dem Göttlichen, allen dämonischen Mächten zum Trotz ist sie Heilsgeschichte; denn im Göttlichen ist Tiefe und Klarheit, das Dämonische ist in ihm überwunden. Darum müssen auch wir dem Abgrund und der Sinnlosigkeit nicht das letzte Wort geben.
In diesen Zusammenhang gehört Tillichs Verständnis des Protestantismus. Das protestantische Prinzip ist Protest gegen jede endliche Macht, die für sich göttlichen Charakter beansprucht – in Staat, Gesellschaft, Kultur und Religion.
Aus der Dresdner Zeit stammt auch die „Dogmatik“-Vorlesung (1925–1927) (vgl. E XIV). Tillich behandelt damit ein klassisches Thema einer theologischen Fakultät. Er hatte durchaus den Wunsch, von Dresden aus an eine theologische Fakultät zurückzukehren, am liebsten nach Berlin. So machte er sich 1928 Hoffnungen auf die dortige Systematik-Professur (Nachfolge Reinhold Seeberg). Die Bewerbung scheiterte, weil die Kirchenleitung ihn wegen seiner „mangelnden Kirchlichkeit“ nicht bestätigen wollte. Im Jahre 1929 sollte die Nachfolge von Rudolf Otto in Marburg geregelt werden. Tillich stand an zweiter Stelle des Berufungsvorschlags. In einem Sondervotum äußerte Bultmann gegen Tillich „schwerste Bedenken“. Tillichs Arbeit bestehe in einer „Umdeutung der theologisch-dogmatischen Sätze in eine spekulative Religionsphilosophie“. Sie sei von ästhetischen Motiven getragen, sie bestehe nicht in Forschung und wissenschaftlicher Analyse, sondern in Konstruktion (E XIV, S. XLII). So schlug er an Stelle von Tillich Karl Barth vor. Berufen wurde Heinrich Frick.
13 P. Tillich (Hg.), Kairos. Zur Geisteslage und Geisteswendung, Darmstadt 1926.
14 Ebd., X.