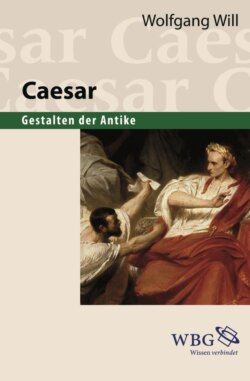Читать книгу Caesar - Wolfgang Will - Страница 23
Im Schatten Pompeius
ОглавлениеDie siebziger Jahre waren ein Jahrzehnt, das von einem Politiker popularer Prägung Mut, Anpassung und Verstellung erforderte. Das war freilich nichts Besonderes. Wer aufsteigen wollte, benötigte diese Eigenschaften. Vielleicht lernte der junge Caesar auch gerade unter diesen erschwerten Bedingungen, seine Kräfte anzuspannen und zu konzentrieren. Seine Karriere war nur vorübergehend blockiert und verlief später dann sogar schneller als die der meisten Altersgenossen, und genau dies veranlasste Mommsen ja dazu, Caesars Alter nach oben zu korrigieren.
Caesar agierte in den siebziger Jahren vorsichtig, aber nicht so, dass ihm in Zeiten eines nicht mehr so fernen politischen Wechsels Opportunismus nachgesagt werden konnte. Er befürwortete einen Antrag des Tribunen Plautius, den Anhängern des Lepidus und des Sertorius die Rückkehr zu gestatten.1 Das war ein Beitrag zur Versöhnung, ähnlich dem, den der Historiker Sallust später leisten sollte, als er mit seiner Biographie über Catilina zwischen den Parteigängern Caesars und Catos vermitteln wollte. Als Caesar schließlich „Kräfte“ unterstützte,2 die den Volkstribunen wieder in seine alten Rechte einsetzen wollten, besaß dies schon nichts Aufrührerisches mehr, denn hinter diesen Kräften verbargen sich die mächtigsten Männer der Zeit. Caesar hatte kein anderes Ziel als den regulären Gang durch die Institutionen. Er wusste, dass dieser ihn an die Spitze des Staates führen konnte. Caesar war durch und durch Beamter, er war kein Revolutionär und schon gar kein Außenseiter. Diese Rolle kam, sofern sie wörtlich genommen wird, einem anderen zu, dessen Aufstieg schneller und glänzender war.
Pompeius wurde 106 geboren, in der Zeit der Kimbern- und Teutonenstürme. Er war neun Jahre jünger als Crassus, sechs Jahre älter als Caesar, gleichaltrig mit Cicero. Dessen Briefen ist es zu danken, dass wir über die Beziehung dieser vier Politiker seit Ende der sechziger Jahre ungewöhnlich gut unterrichtet sind. Cicero mag sich in vielen Einschätzungen getäuscht haben, aber er tat dies in stilistisch unübertrefflicher Weise. Pompeius und er teilten nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch die ersten militärischen Erfahrungen. Beide kämpften während des Bundesgenossenkrieges im Heer des Pompeius Strabo, beide traten später auf die Seite Sullas. Danach trennten sich ihre Wege und fanden erst wieder zusammen, als sie abwärts führten.
Pompeius’ Aufstieg begann mit Sullas Rückkehr aus Asien im Jahre 82, als er, der damals nichts anderes war als ein reicher Privatmann mit einem berühmten Vater – dem genannten Pompeius Strabo – aus der Klientel der Familie und den Veteranen des Vaters drei Legionen rekrutierte, um den Heimkehrer zu unterstützen. Ab da hielt sich Pompeius über drei Jahrzehnte, länger als jeder andere seiner Standesgenossen, im Zentrum der Macht. Seine vielfältigen militärischen Erfolge, ob in Sizilien, in Afrika, Spanien oder Asien, verstärkten seinen politischen Einfluss. Erst als das glanzvolle Feldherrenimage zu bröckeln begann, Caesar die Siege für Rom errang, die vorher Pompeius gehörten, sank dessen Stern, ohne allerdings unterzugehen. Wenn sich auch die Senatoren in den fünfziger Jahren heimlich über den Mann lustig machten, den sie als möglichen neuen Sulla jahrelang gefürchtet hatten, so brauchten sie ihn doch gegen den, der nun ihre Stellung bedrohte, gegen Caesar. So untergrub dieser mit seinen Erfolgen in Gallien zwar Pompeius’ vorrangige Stellung, sein Prinzipat, garantierte ihm aber gerade dadurch das politische Überleben, denn Caesars Gegner hatten sonst niemanden, den sie ihm entgegenstellen konnten.
Das freilich war in den siebziger Jahren noch ferne Zukunft, die Gegenwart hingegen so, dass ein Pompeius von Caesar keinerlei Notiz nehmen musste. Während sich dieser immer noch vor Sullas Fahndern versteckte, erhielt jener, inzwischen auch Schwiegersohn des Diktators, bereits einen ersten Triumphzug zugesprochen: Pompeius saß weder im Senat, noch hatte er das vorgeschriebene Alter; er war weder Prätor noch Konsul gewesen, doch selbst der mächtige Sulla mochte ihm schließlich die Ehre nicht verweigern. Während Caesar sich mit kilikischen Piraten herumschlug, kämpfte Pompeius, vom Senat mit einem außerordentlichen Kommando ausgestattet, gegen die letzten Gegner der sullanischen Reformen. Während Caesar unbemerkt von der Geschichte als Tribun mit rebellierenden Sklaven kämpfte, schlug Pompeius gleichsam en passant die Überreste des Spartacusheeres und schritt zum zweiten Mal als triumphierender Feldherr die Stufen zum Jupitertempel auf dem Kapitol hinauf.3
Nach ihren militärischen Erfolgen bewarben sich Pompeius und Crassus um das Konsulat des Jahres 70. Die Standesgenossen hatten beiden zu danken, auch wenn sie es nicht gerne taten. Zwar wurden die Konsuln von der Volksversammlung – genauer: von den Zenturiatskomitien – gewählt, doch das Volk wählte das, was die Nobilität ihm sagte. Pompeius und Crassus wurden die legalen Erben Sullas, und in dieser Eigenschaft konnten sie darangehen, die Reformen, die sie selbst so lange verteidigt hatten, wie sie ihnen nützlich schienen, wieder aufzubrechen. Das Problem, das die Senatoren mit den Rittern hatten, war durch Sulla weitgehend gelöst worden, der Ritterstand erholte sich in der kurzen Zeit, die der Republik noch blieb, nicht mehr von dem doppelten Aderlass, der Liquidierung und Beförderung hieß. Die Konsequenz war, dass die Senatoren ihre Fehden um die Macht nun ganz allein unter sich austragen konnten, bis sich am Ende in Augustus der einzige Nutznießer fand. Im Jahre 70 trat aber zunächst eine Entspannung ein. Die erste Phase der Bürgerkriege hatte mit dem Tod des Sullagegners Sertorius und der Niederlage seiner Anhänger in Spanien ihr Ende gefunden. Es herrschte über zwei Jahrzehnte relative Ruhe, bevor Caesar und Pompeius mit Unterstützung der übrigen Aristokraten einen neuen Bürgerkrieg anzetteln sollten. Es mussten erst wieder Kräfte gesammelt werden, um diesen auch effektiv führen zu können.
Abb. 5: Münze des Pompeius mit Neptun-Dreizack. Prägung 44/43 v. Chr. Staatliches Münzkabinett, Berlin.