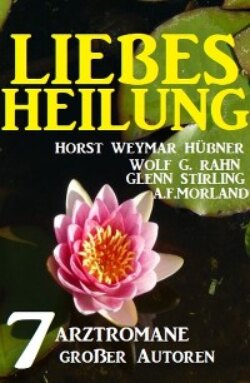Читать книгу Liebesheilung: 7 Arztromane großer Autoren - A. F. Morland - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеVier, fünf Tage, das ging ja noch. Das war normal. Vierzehn Tage waren das nicht mehr. Dennoch hatte Walter kein Gespräch gesucht und keine Fragen gestellt, der er doch sonst sehr verständnisvoll und sehr besorgt um das Wohlergehen ihrer kleinen Familie war.
Nur brummig war er geworden.
Sie hatte so gehofft, der dumpfe Druck und das Völlegefühl im Unterleib würden von allein wieder verschwinden, und alles könnte wie zuvor sein.
Statt dessen hatten sich die Beschwerden verstärkt. Seit drei Tagen kamen infame Schmerzanfälle mit Stichen hinzu, die ihr den Leib zu zerreißen schienen.
Gestern hatte eine starke Blutung eingesetzt, völlig außer der Zeit.
Sie hatte Hermann anrufen wollen, einen Jugendfreund. Er war Arzt an einer Klinik in Bonn. Manchmal kam er auf einen kurzen Besuch vorbei Vielleicht wusste er Rat. Wegen eines schmerzhaften Unwohlseins lief sie schließlich nicht gleich zum Frauenarzt.
Aber dann kam Martina aus der Schule, zeigte mit einem Flunsch die umfangreichen Hausaufgaben vor, die sie aufbekommen hatte, und erklärte mit der ganzen Überzeugung und dem Gewicht ihrer acht Lebensjahre, die Mathelehrerin sei ja unheimlich doof und hätte von nichts eine Ahnung.
Nachmittags schaute die Nachbarin herein, um sich einigen Kummer von der Seele zu reden. Ihr Mann scharwenzelte um seine Sekretärin herum, machte in Midlife Krisis, und wie es aussah, drohte der anfänglich harmlose Flirt in eine handfeste Affäre auszuarten.
Als es Abend war, hatte Eva-Maria natürlich nicht bei Hermann Mittler angerufen.
In der Nacht waren die irrsinnigen Schmerzen zweimal gekommen. Als schließlich der Wecker ging, hatte sie sich wie gerädert gefühlt. Da hatte sie sich geschworen, heute wirklich zu telefonieren und nichts dazwischenkommen zu lassen.
Walter rührte versunken in der leeren Tasse und blieb ins Studium der Zeitung vertieft. Die Unsitte des Zeitunglesens beim Frühstück hatte er sich in all den Jahren nicht abgewöhnt.
Jetzt merkte er, dass sein Löffel keinen Widerstand in der Tasse fand und das leise Klirren ganz anders als sonst klang. Er blickte hoch, abwesend und noch ganz bei den Schlagzeilen von Wirtschaft und Politik, und hörte Tina in kindlich mitfühlendem Ton sagen: „Jetzt kneift’s die Mami aber wieder tüchtig im Bauch!“
Sein abwesender Blick kehrte in die Wirklichkeit und an den Frühstückstisch ihrer kleinen Familie zurück.
„Kneift? Im Bauch?“ Er sah die abgestellte Kanne, die leere Tasse und dahinter seine Frau in unnatürlicher Haltung. Eva-Marias Gesicht war schmerzverzerrt und bleich, auf der Stirn perlte feiner Schweiß.
Mit einer jähen, fast wilden Behändigkeit kam er vom Stuhl hoch, den Ausdruck größter Besorgnis im Blick. Achtlos flog die Zeitung zu Boden.
„Seit wann hast du das?“ Seine Hand legte sich behutsam auf ihre Stirn. „Eine Erkältung vielleicht? Letzte Woche hast du doch im Steingarten gearbeitet, da ging ein ziemlich kühler Wind.“ Die Stirn war kühl. Verwundert nahm er die Hand weg. „Wo sitzt der Schmerz?“ Das war wieder seine besorgte Stimme, wie sie sie schon lange nicht mehr gehört hatte. Ja, damals, als sie mit Martina schwanger war. Aber das war lange her.
Seine plötzliche Fürsorge tat ihr gut. Zaghaft sagte sie: „Im Leib. Und im Rücken.“
„Seit wann?“, wiederholte er.
„Ein paar Tage schon. Ich dachte, es ginge so vorbei. Nachher rufe ich Hermann an. Das habe ich mir fest vorgenommen.“
„Wozu Hermann, mein Schatz? Der ist in Bonn, und das ist ein bisschen weit, meine ich. Du willst dich doch von ihm untersuchen lassen. Nicht?“ Er sah, dass sie die Arme um den Leib gepresst hielt und bemüht war, das vor ihm zu verbergen. „Dann rufe ich Scharnitz an. Besser noch, ich bringe dich gleich runter zu ihm.“
Sie lächelte tapfer und schüttelte den Kopf. „Es ist gleich vorbei, ich kenne das schon. Es kommt und geht.“
„Seit ein paar Tagen!“, hielt er ihr die eigenen Worte vor. „Das kann kein Dauerzustand werden. Bitte, mache dich fertig. Ich nehme dich mit runter in die Stadt.“
Der grässliche Schmerz ließ allmählich nach. Eva-Maria richtete sich auf. „Siehst du, es geht schon wieder.“ Sie brachte die Arme zum Vorschein, griff nach der Kanne und schenkte ein. „Außerdem kommst du zu spät. Und zu Doktor Scharnitz will ich nicht.“
Er hörte den Unterton. „Was hast du gegen ihn? Er hat unser Tina Mäuschen geholt, und du warst sehr zufrieden mit ihm.“
„Vor acht, vor neun Jahren, ja. Bitte, lass mich erst mit Hermann sprechen. Ich lege Wert auf seinen Rat.“
Ihre Abneigung gegen einen Besuch bei Dr. Scharnitz war nicht zu übersehen. Er machte gar nicht erst den Versuch, sie umzustimmen. Dunkel erinnerte er sich an alten Klatsch, der Jahre zurücklag. Scharnitz wurde eine Liaison mit einer Kollegin nachgesagt. Genaues war nie herausgekommen. Der Mann galt weiterhin als ausgezeichneter Frauenarzt.
Möglich, dass dieses alte Gerücht den Ausschlag gab. Eva-Maria war in Dingen der Moral konservativ und konsequent. Untreue war etwas, das niemals ihre Billigung fand und das sie auch nicht tolerierte.
Vielleicht war an der Sache damals auch mehr dran. Frauen pflegten meist besser informiert zu sein.
Er betrachtete sie besorgt. Sie gewahrte, wie eine stille, verhaltene Zärtlichkeit in seinen Blick kam.
„Du kannst auch den Wagen haben“, bot er ihr an. „Ich nehme die S-Bahn.“
„Das ist wirklich nicht nötig, Walter. Sobald ich euch zwei aus dem Haus habe, rufe ich in Bonn an.“ Sie schaute auf die Uhr. „Du musst dich beeilen.“
Er ging zu seinem Stuhl und hob die Zeitung auf. „Der Ärger erwischt mich noch früh genug. Und im Büro kennen sie mein Gesicht.“ Prüfend und eindringlich blickte er sie an. „Auf elf Uhr ist eine Konferenz angesetzt, der Etat fürs nächste Jahr soll um dreißig Prozent gekürzt werden. Schwer zu sagen, wann ich da herauskomme. Ich rufe dich besser vorher an.“
„Wozu?“ Ihre ganze Haltung drückte Ablehnung aus. Sie fühlte sich gedrängt. Das mochte sie nicht.
„Um zu hören, was dein Hermann meint. Ich bezweifle allerdings, dass er dir von großem Nutzen ist. Ein Arzt muss seinen Patienten vor sich sehen. Er wird dir raten, hier zum Doktor zu gehen.“
„Ich will ja gar keine Diagnose von ihm gestellt haben. Nur seine Meinung möchte ich hören. Außerdem ist er nicht mein Hermann“, verwahrte sie sich vorsorglich.
„Er hätte es gut werden können, wenn ich mich nicht mehr ins Zeug gelegt hätte als er. Immerhin hat er mir voraus, dass ihr euch schon im Sandkasten geprügelt habt. Das verbindet.“
„Werde nicht kindisch, Walter. Er hat mich nie geprügelt.“
„Aber du ihn. Er hat es mal erzählt, ich entsinne mich.“ Seine Augen blickten vergnügt.
Sie atmete auf. Seine brummige Laune der letzten Tage war wie weggewischt. Diese phänomenale Wandlungsfähigkeit faszinierte sie immer wieder.
Er konnte mit Ausdauer und Sturheit und tiefem Ernst einen Standpunkt im Gespräch vertreten, bis plötzlich ein Stichwort, eine Geste oder eine Entgegnung den Umschwung bei ihm auslöste. War er eben noch ein erbitterter Debattieren zeigte er sich im nächsten Augenblick als unterhaltsamer launiger Plauderer, der auch einem derben Flachs nicht abgeneigt war.
Seine Anspielung auf die Sandkastenabenteuer im zarten Kindesalter ließ sie lächeln. Irgendwie schaffte er es immer, einer Begebenheit eine spaßige Seite abzugewinnen.
Das war wohltuend, und sie wusste nur zu genau, wie oft er sie damit schon ins Gleichgewicht gebracht hatte, wenn sie niedergeschlagen war.
Liebevoll beobachtete sie ihn, wie er Tina den Schulranzen hinhielt, sein Jackett von der Garderobe nahm und den Wagenschlüssel suchte, der wie immer auf der Ablage deponiert war. Er wühlte jedoch immer erst in den Taschen.
Mit einem Lachen voll diebischer Freude schnappte Martina nach dem Schlüssel und hielt ihn triumphierend hoch. „Da ist er doch, Papi!“
Es gab das übliche Gerangel um den Schlüssel. Dann ergriff er den Aktenkoffer und kam noch einmal herein, trank den letzten Schluck Kaffee und gab ihr einen Kuss.
Es war eine Zeremonie, die sich etwas abgenutzt hatte. Dennoch mochte sie diese morgendliche Verabschiedung nicht missen.
Heute kam ihr sein Kuss weniger flüchtig vor.
War das eine liebenswürdige Aufmerksamkeit oder Ausdruck seiner Sorge um ihre Gesundheit?
Er durfte sich nicht damit belasten. Nicht heute, wo es in seiner Firma um wichtige Entscheidungen ging.
Die ganzen Jahre hatte er sie an den Vorgängen im Büro teilhaben lassen, hatte mit ihr prekäre Situationen besprochen und sie um ihre Meinung gefragt. Er liebte seinen Beruf, und er nahm ihn ernst.
Gerade heute musste er alle Gedanken beisammen haben, durfte nicht abgelenkt sein.
Sie deutete auf seinen Aktenkoffer. „Bedeutet die Etatkürzung Entlassungen?“
Er sollte das Gefühl und die Gewissheit mitnehmen, dass sie sich mit seinen Sorgen und Nöten befasste, dass sie ihm eine Stütze war und er jederzeit auf sie zählen konnte, soweit sie etwas von den Dingen verstand.
Ein Schatten flog über sein Gesicht. „Es wird nicht ohne abgehen. Aber zerbrich dir nicht meinen Kopf. Tschüs, mein Schatz, und halt die Ohren steif!“
In der Diele steckte er sich seine Zigarette an, ohne die er morgens nie das Haus verließ. Der strenge Rauch des schwarzen Krautes zog ins Esszimmer.
Jetzt musste die Haustür klappen.
Eva-Maria vermisste das altvertraute Geräusch. Statt dessen hörte sie ein Tuscheln.
Sicher Martina, die versucht, ihm ein paar Groschen abzuluchsen, um sie im Geschäft gegenüber der Schule in Süßigkeiten umzusetzen, dachte sie.
Doch dann hörte sie Tina wispern: „Doch, Paps, unheimlich lang schon. Als ich vom Schwimmen kam, hat sie sogar geweint. Ich musste gleich Schulaufgaben machen, aber ich hab’s doch gemerkt. Und noch eine Weile ganz deutlich gehört ...“
Jäher Schreck erfasste sie.
Der Nachmittagsschwimmunterricht war vor drei Tagen gewesen. Sie erinnerte sich, dass sie gerade den zweiten Schmerzanfall hatte, als Tina an der Haustür schellte.
Sie hatte sich bemüht, sich nichts anmerken zu lassen.
Vergebens, wie sich jetzt herausstellte. Kinder sind überaus hellhörig, gerade in diesem Alter. Und sie erweisen sich als gnadenlose Beobachter.
Endlich fiel die Haustür zu. Sie hörte das Garagentor hoch kippen und kurz darauf Walter mit Tina wegfahren; an der Schulbushaltestelle setzte er sie ab.
Mit der gleichen Abwesenheit, mit der Walter von der Zeitung hoch gesehen hatte, blickte sie über den Frühstückstisch. Sie spürte eine nie gekannte Mattigkeit und empfand Unlust.
Das Geschirr musste warten. Sie konnte es später abräumen.
Wenn sie vielleicht ernstlich krank war und in die Klinik musste, wer kümmerte sich dann um die beiden? In häuslichen Dingen war Walter ungeschickt, und Tina war noch zu klein, bestimmt aber keine große Hilfe. Ein schönes Durcheinander würde das werden.
Sie saß und dachte nach. Sicher wäre es besser gewesen, sie wäre zur Vorsorgeuntersuchung gegangen, wie Dr. Scharnitz ihr damals ans Herz gelegt hatte. Regelmäßig, mindestens einmal im Jahr.
Zwei Jahre nach Tinas Geburt war sie einfach nicht mehr hingegangen.
Ein unkluger Entschluss, wie sie sich nun eingestand.
Sie musste Hermann dieses Versäumnis beichten. Gewiss war er nicht entzückt, höchstwahrscheinlich würde er ihr sogar gehörig den Kopf waschen.
Was sollte sie ihm überhaupt sagen? Einfach schildern, was sie an sich beobachtete?
Routine und Erfahrung im Klinikbetrieb setzten ihn sicher in die Lage, ihr zu sagen, was ihr fehlte.
Nach einiger Zeit begriff sie, wie naiv sie dachte.
Hermann war viel zu überzeugt von seinem Beruf, um eine Ferndiagnose zu stellen.
Und würde er ihr überhaupt die Wahrheit sagen? Ein leises Misstrauen gegenüber jedem Arzt hatte sie stets erfüllt. Nicht, dass sie an der Fähigkeit gezweifelt hätte. Aber sie meinte, dass die Mediziner sehr oft nicht die Wahrheit sagten, die ganze Wahrheit. Und sie klammerte Hermann nicht aus.
Wenn sie vielleicht selber ...? Wozu waren schließlich die medizinischen Bücher im Haus?
Sie ging ins Wohnzimmer. Jeder Schritt bereitete ihr Schmerzen.
Im Bücherregal suchte sie die Nachschlagewerke, die sie während der ersten beiden Lebensjahre von Tina angeschafft hatten. Das Baby war drei Wochen zu früh gekommen, bei der Geburt hatten sich Komplikationen ergeben. Für die ersten zwölf Lebensmonate galt Tina als Risikokind; sie hatten sich informieren wollen, was auf sie und das Kind möglicherweise zukam.
Nervös suchte sie die Symptom-Beschreibungen. Sie wusste genau, dass sie die mal überflogen hatte.
Die Bücher enthielten nicht nur Beschreibungen der gängigen Kinderkrankheiten, es waren auch allgemeinmedizinische Aspekte angesprochen. In einem Anhang gab es Stichworte zu Fachgebieten.
Sie legte das Buch beiseite und nahm das nächste heraus. Hastig blätterte sie.
Da war es – Unterleib.
Ihr Finger glitt die Auflistung hinab.
Dumpfer Druck – Myome.
Dumpfer Druck und anhaltendes Völlegefühl – Ovarialtumoren.
In Verbindung mit Schmerzattacken und blutigem Ausfluss: Menorrhagie, lang dauernde Gebärmutterblutung außerhalb der Menses. Ovarialkarzinom möglich.
Sie las es noch einmal.
Ganz plötzlich begann die Schrift vor ihren Augen zu tanzen und zu flimmern.
Karzinom hieß Krebs oder Krebsgeschwür!
Eine gemeine, furchtbare, niederträchtige Angst erfasste sie. Sie fühlte sich hundeelend und kämpfte mit den Tränen.
Krebs! Sollte sie Krebs haben?
Alles in ihr sträubte sich, lehnte sich auf gegen diese dumpfe Erkenntnis. Ausgeschlossen, wie sollte sie zu Krebs kommen?
Dann wieder fraß sich der nagende Zweifel in ihr Herz. Sie war schließlich die letzten Jahre zu keiner Vorsorgeuntersuchung mehr gegangen. Vielleicht also doch!
Mit einem wilden Trotz klammerte sie sich an die Hoffnung, dass sie sich irrte, dass sie in der Aufregung die Bedeutung des Wortes Karzinom verwechselte.
Die Blätter knisterten, als sie eifrig, fast beschwörend blätterte.
Unter Karzinom stand, was sie eben gelesen hatte. Kein Irrtum also!
Sie wusste nicht, wie lange sie so stand und in das Buch starrte, ohne etwas zu sehen.
Krebs – hämmerte es in ihrem
Kopf. Wahrscheinlich Krebs!
Die Angst schnürte ihr die Kehle zu, das Herz pochte wild gegen die Rippen.
Aber sie spürte es nicht. In ihr war alles tot und taub.
Irgendwann setzte sie sich, weil die Beine sie nicht mehr trugen.
Das Buch schlug zu Boden und klappte zu. Ihre Gedanken begannen sich im Kreis zu drehen. Nun war die Reihe an ihr nach all den Fällen im großen Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Schlimme Fälle. Nicht alle, aber doch einige. Zu spät erkannt und zu spät behandelt. Zugenäht und wieder nach Hause geschickt, weil jeder Eingriff aussichtslos war.
War es bei ihr auch bereits zu spät?
Die dumpfe Lethargie fiel von ihr ab und wich der Panik.
Warum gerade ich? Nein, ich will nicht sterben, ich will mich nicht zunähen und heimschicken lassen! Warum bin ich nie mehr zur Untersuchung gegangen? Warum nicht gleich zum Arzt, als es anfing?
Sie war auf dem besten Weg, völlig durchzudrehen.
Gehetzt blickte sie um sich, starrte auf die Bücherwand, das Fenster, auf die Blumen davor. Ihr Blick blieb auf dem kleinen roten Telefonbuch haften.
Hermann! Ihn musste sie anrufen. Jetzt auf der Stelle. Er wusste Rat, ganz bestimmt. Er war doch Arzt, arbeitete doch in einer bekannten Klinik, er wusste doch, was jetzt zu tun war!
Sie stand auf, spürte, dass alles schmerzte, dass sie völlig verkrampft war. Wie eine Ertrinkende griff sie nach dem Telefonbuch und schleppte sich in die Diele.
In ihren Ohren rauschte es, in den Schläfen war ein Hämmern und Klopfen.
Krebs! Du hast Krebs! Es ist zu spät!