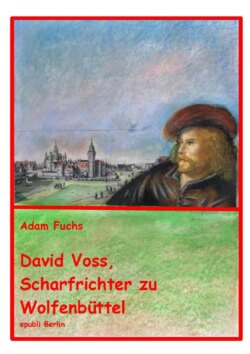Читать книгу David Voss - Scharfrichter zu Wolfenbüttel - Adam Fuchs - Страница 6
ОглавлениеMein Vater
Sechsundfünfzig Jahre war mein Vater, genannt der alte David Voss, bereits alt, als ich auf die Welt kam und noch vor meinem zweiten Geburtstag ist er gestorben, so dass ich ihn gar nicht mehr richtig kennengelernt habe.
Was ich über ihn weiß, habe ich eigentlich nur aus den Erzählungen meiner Mutter und denen meiner ältesten Schwester.
Mit fünfzig Jahren hat er seine vierte Frau, meine Mutter, geheiratet, die damals gerade einmal zwanzig Jahre alt war.
Seine erste Frau, Maria, kam aus der bekannten Scharfrichtersippe Clauss zu Lemgo im Lippischen, wo nicht nur mein Vater seine Lehrjahre absolviert hat, sondern auch ich später ein paar Jahre verbringen durfte und das waren nicht die schlechtesten, die ich erlebt habe.
Mit dem Vermögen, das Maria ihm hinterlassen hatte, brachte er es zu mehreren Abdeckereien, zwei weiteren Frauen und schließlich zur Scharfrichterstelle in Braunschweig.
Und dann kam Catharina, genauer Catharina Jahn, die im Jahr 1640 die vierte und auch jüngste Frau meines Vaters wurde.
Catharina Jahn, meine Mutter, stammte aus Schöppenstedt und wie auch immer mein Vater an sie geraten ist, sie hat ihm Glück gebracht.
Mit ihr kam die Berufung nach Wolfenbüttel, wo er schon kurze Zeit danach mit der weit lukrativeren Meisterei des Herzogtums bestallt wurde.
Ein so alter Mann und eine so junge Frau?
Da wird so manch einer geredet haben, die “Jahnsche”, wie meine Mutter nach ihrem Geburtsnamen immer genannt wurde, wird doch wohl Mittel und Wege finden, den Alten aus dem Weg zu räumen, ohne dass es groß auffällt.
Schließlich war sie als Tochter eines Scharfrichters mit der Herstellung allerlei Tränke und Medizinen bestens vertraut.
Natürlich wusste sie auch, wie man wirksame und doch kaum nachweisbare Gifte herstellte.
Meine Mutter hat oft erzählt, dass sie das Getratsche der Weiber gehört hat, wenn sie gelegentlich am Markttag in die Festung ging, um Gewürze oder Tuche für neue Kleider zu kaufen.
Sie ging zwar so selten wie nur irgend möglich dorthin, aber manchmal ließ es sich nicht ganz vermeiden.
Die Frauen aus der Stadt standen dann in einigem Abstand von ihr an den Ständen der Händler und tuschelten miteinander, wobei das Tuscheln häufig sehr laut wurde, so dass man auch ja hören konnte, was sie zu sagen hatten, die ehrbaren Weiber von Wolfenbüttel.
Meine Mutter hat sich immer beeilt auf dem Markt.
Darüber waren die Händler froh, denn sie hatten kein Interesse daran, dass sich die Henkerin länger als nötig an ihrem Stand aufhielt.
Nun ja, der Tuchhändler mag da wohl eine Ausnahme gewesen sein, denn wenn wir auch gehalten sind, besondere Kleidung zu tragen, um für Jedermann erkennbar zu sein, so ist es doch nicht verboten, die Kleider aus teuren Stoffen machen zu lassen.
Meine Mutter hatte eine ausgesprochene Vorliebe für schöne Stoffe und liebte besonders die flandrischen Tuche wie auch die farbigen Seidenwaren.
Da konnte der Händler schon einmal die Gegenwart der Henkerin ertragen, wenn er mit ihr über die nächste Lieferung verhandelte.
Auf diese Weise hatten die Weiber auch ausreichend Gelegenheit, sich über den Reichtum der Jahnschen auszulassen und darüber, wie unehrenhaft ihr Geld verdient wurde.
Aber meine Mutter hat auch gern erzählt, wie manches Mal ein Weib rot wurde, wenn sie es scharf ansah.
Dann erinnerte sich manche junge Frau, dass man gerade vor kurzer Zeit erst heimlich nachts in das Henkershaus geschlichen war, um nach einem Trunk zu fragen, damit das ungewollte Kind nicht zur Welt kommen musste und dafür bezahlten sie nicht schlecht, die gerechten Weiber von Wolfenbüttel.
Meine Mutter hat übrigens allem Gequake zum Trotz noch sieben Kinder mit meinem damals schon recht betagten Vater bekommen.
Im Mai 1641 kam meine Schwester Dorothea zur Welt, noch zu der Zeit, als die Familie im alten Haus auf dem Juliusdamm wohnte.
Einsam war es dort, keine Nachbarn, keine Gesellschaft, nur meine junge Mutter und eine einzige Magd im Haus.
Und drumherum nichts als Wasser und Sumpf.
Zudem war Krieg und nicht nur einmal mussten die beiden Frauen erleben, dass marodierende Soldaten herumzogen und sie in Angst und Schrecken versetzten, während mein Vater den ganzen Tag mit dem Knecht über Land war.
Und dann das alte Haus.
Überall saß der Schwamm und es soll immer modrig gerochen haben.
In dem ersten Winter, den sie dort verbracht hat, habe das Wasser nach der Schneeschmelze gar bis hoch zur Türschwelle gestanden.
"Der alte Kasten hatte ständig nasse und ich immer kalte Füße", schimpfte meine Mutter noch Jahre später.
Dazu kam die erste Schwangerschaft.
"... für mich war dieser elende Krieg fast ein Segen. Ich konnte endlich weg aus dem grauslichen Kasten."
Als Kind habe ich nicht verstanden, warum ein Krieg ein Segen gewesen sein sollte. Wie auch. Als ich auf die Welt kam, war der, Gottlob, schon längst Vergangenheit.
Aber damals?
Seit dem Jahr 1618 hatten die unterschiedlichsten Truppen an vielen Orten im Kampf miteinander gelegen.
Kein Mensch konnte mehr sagen, warum oder wie es angefangen hatte. Das interessierte auch zu meiner Zeit niemanden mehr.
Ich weiß nur, dass meine Eltern noch in dem Jahr, in dem meine Schwester geboren wurde, also 1641, ihre Sachen aufgeladen haben und mit dem Fuhrwerk nach Groß Stöckheim gefahren sind.
Zu der Zeit hatten die wer-auch-immer-Truppen schon damit begonnen, einen alten Staudamm über die Oker wieder zu reparieren, um die Festung Wolfenbüttel unter Wasser zu setzen und auf diese Weise zur Aufgabe zu zwingen.
Es war klar, dass unser Grundstück als eines der ersten absaufen würde, so nah, wie es an der Oker lag.
Mein Vater hatte dem Herzog seine Situation vor Augen geführt.
Das tief gelegene einsame Grundstück, die noch junge Magd und die schwangere Frau und keine Möglichkeit weit und breit, Hilfe zu holen, wenn erst einmal alles überschwemmt ist.
Unser Herzog hat das schließlich verstanden und angeordnet, dass die Familie des Scharfrichters auf einen verlassenen Hof in Groß Stöckheim umsiedelt, denn verlassene Höfe gab es inzwischen genügend dort. Dafür hatten der Ewige Krieg, wie er bei uns genannt wurde, und die Pestepidemien schon gesorgt.
Die verbliebenen Einwohner werden nicht gerade begeistert über die Neubürger gewesen sein, andererseits war es ihnen wohl schon ziemlich gleichgültig. Sie hatten auch andere Sorgen, als sich darüber aufzuregen, dass jetzt mitten im Dorf die Henkersfamilie lebte.
Sie mussten versuchen, mit dem Wenigen, das der Krieg noch übrig gelassen hatte, ihr Leben zu fristen, und das mehr schlecht als recht.
Zu der Zeit dauerte der schon über 20 Jahre und ein Ende war überhaupt nicht absehbar.
Natürlich wurde nicht täglich und an jedem Ort gekämpft, aber die Auswirkungen, die bekamen alle zu spüren.
Marodierende Söldnerheere überfielen die Dörfer, kleinere Schlachten hier und da vernichteten die Saat auf den Feldern, Krankheiten verbreiteten sich und Epidemien rafften die Menschen wie Fliegen hin.
Viele Dörfer waren damals fast menschenleer und die Wenigen, die noch in ihren Häusern waren, hatten kein Material, um Schäden zu reparieren.
Es wurde auch immer schwieriger, Nahrung zu beschaffen.
Zu viele Ernten waren vernichtet und zu viele Schlachttiere fortgeführt worden, um die Soldaten durchzufüttern.
Um nicht zu verhungern, waren die Groß-Stöckheimer sogar bereit, für einen täglichen Kanten Brot und zwei Löffel Schmalz an dem Damm mitzubauen, obwohl sie sich damit doch ihr eigenes Verderben gruben. Aber sie hatten keine Wahl.
Im Juni 1641 waren sie damit fertig und der Damm, den man später aus irgend einem Grunde den „schwedischen“ nannte, wurde geschlossen. Es dauerte auch gar nicht lange, da war das Wasser so hoch aufgestaut, dass nicht nur die ganze Gegend überschwemmt war.
Auch in der Festung soll das Wasser bis zu einem Meter hoch gestanden haben. Noch bis nach Halchter im Süden waren die Höfe abgesoffen.
"Ach Herrjee, das waren Zeiten", sagte die Nachbarin immer, wenn sie in unserer Küche saß und die beiden Frauen bei diesem Thema angekommen waren.
"Was soll nur aus uns werden. Wo soll das alles noch hinführen! Die Männer im Feld, die Kinder auf dem Friedhof und wir hier zurückgelassen in diesem Elend. Und kein Mensch weiß, wozu das alles gut sein soll."
Mit dem Schürzenzipfel wischte sie sich die Tränen aus den Augen und schniefte ganz fürchterlich.
Das war dann der Moment, in dem meine Mutter beschloss, dass unbedingt eine Tröstung vonnöten war, wo man doch diese schrecklichen Zeiten nicht ertragen hätte, wären da nicht so gute Nachbarinnen gewesen und eine gute Nachbarschaft sei doch immer auch einen guten Schluck wert.
Zum dünnen Bier, das bereits in dicken Tonbechern serviert worden war, wurde noch ein kleines Fläschchen „Medizin“ herbeigeholt.
Bei der handelte es sich um eine dunkelbraune zähe Flüssigkeit, die meine Mutter aus den grünen Schalen der unreifen welschen Nüsse, wie wir sie nannten, herstellte.
Wie diese Nüsse in unseren Garten in Groß Stöckheim gelangt waren, das wusste niemand mehr. Wahrscheinlich hatten Soldaten sie in ihren Ranzen eingeschleppt.
Sie wurden jedenfalls klein geschnitten und mehrere Tage in die Sonne gelegt, bis sie richtig unappetitlich braun wurden.
Dann kamen sie zusammen mit verschiedenen Kräutern, Honig und Branntwein in große Gefäße, die anschließend für mindestens ein Jahr in die Vorratskammer wanderten.
Das Gebräu, welches dort vor hin reifte und schließlich in Glasfläschchen abgefüllt wurde, vertrieb nicht nur Magengrimmen und Völlegefühl, sondern war auch bestens geeignet, Schwermut zu bekämpfen und je mehr die Nachbarin davon verabreicht bekam, desto fröhlicher wurde sie, bis sie irgendwann in bester Laune nach Hause wankte.
Gott sei Dank hatte meine Mutter viele dieser kleinen Flaschen, die gegen zwei Groschen bei ihr zu erstehen waren.
Einige davon sind erhalten geblieben und stehen heute als Zierde hinter den Scheiben meines neuen Schrankes.
Das Mittel verkaufte sich sehr gut und jeden Tag kamen Frauen aus der Nachbarschaft, um sich mit der Arznei zu versorgen.
Ich selber musste als kleiner Junge immer den Frauen die Tür öffnen und sie höflich mit einem Diener begrüßen.
Dann gingen sie zusammen mit meiner Mutter in das Hinterzimmer, wo diese all ihre Töpfe, Flaschen und Zutaten aufbewahrte.
Was sich hinter der verschlossenen Tür tat, wusste niemand.
Meine Mutter hatte allein einen Schlüssel und riegelte immer sorgfältig ab, wenn sie den Raum verließ.
Über ihre Kundinnen und deren Bedürfnisse verlor sie niemals ein einziges Wort.
Die Frauen wussten das zu schätzen und kamen auch aus den umliegenden Dörfern zu ihr, außer in der Zeit der großen Überschwemmung, denn da war kein Durchkommen mehr, weil das ganze Land unter Wasser stand.
Drei Monate hatte es gedauert, bis man den Damm wieder öffnete und das Wasser endlich wieder abfließen konnte, damals, im September 1641.
Aber bis der Erdboden wieder trocken und nutzbar wurde, dauerte es Ewigkeiten.
Und dann mussten die Stöckheimer zu allem Unglück auch noch feststellen, dass ihre Viehweiden jetzt jenseits der Oker lagen.
Das stelle man sich vor!
Bislang war der Ort umgeben gewesen von Wiesen, die sich bis hinab in die großen Okerschleifen geschmiegt hatten, und nun waren diese mit einem Mal nicht mehr erreichbar!
Wie konnte das geschehen?
Nun, die gewaltigen Wassermassen waren nach dem Dammdurchbruch nicht brav in dem alten Okerbett abgeflossen, sondern hatten sich einen neuen Weg gesucht, indem sie sich in dem ehemaligen Auebach ein neues Bett gegraben und den zur neuen Oker gemacht hatten.
Der Bach war zuvor ein kleines, unbedeutendes Rinnsal gewesen, das am Dorfrand entlang floss und aus diesem unscheinbaren Gewässer war nun ein recht breiter Fluss geworden und die Schäferwiesen lagen dahinter.
Wie sollten jetzt die Bauern zu ihren Weiden kommen!
Sie versuchten es zunächst mit Brettern und Bohlen, aus denen sie sich einen Steg über den Fluss bauten, aber die Angelegenheit war so wackelig und anfällig, dass immer wieder Unfälle passierten.
Mal fiel ein Schaf in die Oker, dann ein Kind und ein anderes Mal sogar ein erwachsener Reiter.
Sobald das Wasser stieg, war die ganze "Brücke" in den Fluten verschwunden. Dazu war das gesamte Land sumpfig und nur sehr mühsam zu begehen.
Nur die höher gelegenen Gebiete oben am Itschenkamp waren verschont geblieben, allerdings gehörten die schon nicht mehr zum Groß Stöckheimer Gebiet.
Dort oben bestellten die Bauern vom Vorwerk, dem Rothen Amt, die Felder, wo sie Getreide und Gemüse anbauten.
Meine Mutter hatte durch den Verkauf ihrer vielen Mittelchen zum Glück das Geld, dort für die Familie Gemüse zu kaufen, aber das ging den wenigsten Stöckheimerinnen so und viele schafften es nicht, ihre Kinder durch diese Zeit zu bringen.
Ziemlich genau zwei Jahre später kam mein Bruder Henrich auf die Welt, im Jahr 1643, als wohl endlich auch die letzten Truppen abgezogen waren.
Meine Mutter erzählte jedenfalls, dass sie den ganzen Winter über Angst gehabt hatte, weil sie doch schwanger war und man nie wusste, wer sich in der Gegend herumtrieb.
Im März war es dann so weit.
Mein Bruder kam wohlbehalten auf die Welt und mein Vater schnallte, wie schon nach der Geburt meiner Schwester, die Holzschlurren unter die Schuhe, stapfte durch die nassen Wiesen bis hoch zum Itschenkamp und von dort zum Trinitatistor, das es damals noch gab, in die Stadt, suchte feinsten Stoff aus, brachte den zu der alten Alberta, der Näherin in unserem Dorf und ließ ein feines neues Kleid für meine Mutter fertigen.
So machte er es bei jedem seiner Kinder und obwohl es im Dorf keine Gelegenheit gab, die schönen Kleider zu tragen, freute sich meine Mutter, wenn sie sich herausputzen und wenigstens der Verwandtschaft ihren Wohlstand vorführen konnte.
Und mein Vater freute sich über sein junges, gut geratenes Weib, das in den feinen Kleidern ausgesprochen etwas hergemacht haben muss.
Mit den nächsten Kindern hatten meine Eltern nicht so viel Glück.
Sie starben schnell hintereinander kurz nach der Geburt, was zu der Zeit wegen der vielen Epidemien gepaart mit schlechter Ernährung an der Tagesordnung war.
Der Krieg ging derweil dem Ende zu, hier und da schlichen noch die letzten Versprengten in der Gegend herum und machten die Wege unsicher, die großen Schlachten waren geschlagen und am Ende wusste doch niemand so recht, wie alles begonnen und wofür es gut gewesen war.
1645, sagt man, seien aus unserer Gegend die letzten Soldaten abgezogen und ein Jahr danach, am 11. Juni 1646, kam ich zur Welt.
Ich, David Voss, genannt der Jüngere.