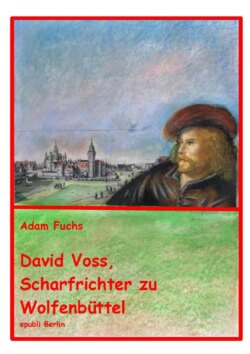Читать книгу David Voss - Scharfrichter zu Wolfenbüttel - Adam Fuchs - Страница 7
ОглавлениеButterblumensuppe
"Voss Sohn", trug der Pfarrer in das Kirchenbuch ein.
Später einmal hatte ich mich getraut, meine Mutter zu fragen, warum ich nicht mit einem Namen eingetragen worden war.
"Ach Kind", hatte sie geantwortet.
"Als ihr Zwei auf die Welt kamt, da hat niemand einen Pfifferling für euch gegeben. So kleine Wesen und so dünn und schwach. Nicht einmal saugen konntet ihr, so dass die Amme versucht hat, euch mit einem Tuch Honigmilch einzuflößen.
Der Pfarrer hat mir weismachen wollen, der liebe Gott wollte euch wiederhaben.
"Dem werde ich was erzählen, dem lieben Gott“, habe ich damals bei mir gedacht.
Wozu gibt es Mittel und Tränke, wenn ich nicht versuche, meine eigenen Kinder durchzubringen. Aber du siehst ja, wir mussten teilen, der Herrgott und ich.“
Ich war also nicht allein auf die Welt gekommen.
Mein namenloser Zwillingsbruder schaffte es noch gerade so über den Winter und verschwand in den letzten Märztagen wieder von dieser Welt.
"Vielleicht war es besser so", murmelte meine Mutter, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam.
„Es hätte nicht für Zwei gereicht.“
Ich war jedenfalls im März noch am Leben, im April auch noch und im Mai hatte mein Vater den Eindruck, als dürfe ich nun doch bleiben.
Er war jetzt sechsundfünfzig Jahre alt und nicht mehr gesund.
Die harten Jahre hatten auch ihm zugesetzt und von Zeit zu Zeit fragte er sich wohl, wie lange er es noch machen würde.
Für das Scharfrichteramt war er zu der Zeit schon längst zu schwach.
Er konnte das schwere Richtschwert nicht mehr führen und hatte Angst, dass er bei der nächsten Hinrichtung den Delinquenten mehr verletzt als richtet, was eine große Schande gewesen wäre und eine Menge Scherereien nach sich gezogen hätte.
Er hatte sich darum zurückgezogen und das Recht, sein Amt auszuüben, dem Christoph Förster aus Schöningen für dreihundert Taler verkauft, um sich nur noch der Behandlung von Verletzten zu widmen.
Meine Eltern konnten inzwischen geruhsam von dem Geld leben, das meine Mutter durch den Verkauf ihrer Arzneien erwirtschaftete und mein Vater als Arzt.
Ja, richtig, als Arzt.
Als Henker konnte er nicht nur Menschen vom Leben zum Tode befördern, sondern er hatte auch dafür zu sorgen, dass die zuvor Gefolterten bis zu ihrer endgültigen Aburteilung einigermaßen wieder hergestellt waren.
Und für den Fall, dass sie freigesprochen wurden, mussten sie wieder arbeitsfähig gemacht werden.
Er kannte sich also aus mit Knochenbrüchen, Verrenkungen, inneren Verletzungen und solchen Sachen.
Er wusste, wie man heilte, ohne mit albernem Zauber und hilflosen Aderlässen die Leiden der Menschen noch zu verschlimmern.
Nach dem überstandenen Krieg gab es viele Verletzungen, die behandelt werden mussten und meine Mutter kannte als Henkerstochter natürlich alle Kräuter und sonstigen Mittel, die gegen Gebrechen jeder Art helfen.
Die allerbeste Wirkung übrigens erzielte sie mit Salben, die auf der Grundlage von Menschenfett hergestellt wurden.
Nichts konnte eine Verstauchung oder ein verrenktes Bein mit großflächigen Hämatomen besser auskurieren, als eine Salbe aus Menschenfett und Arnikablüten.
Die getrockneten Blüten kaufte sie von einem Händler aus dem Gebirge, denn bei uns wachsen diese Pflanzen nicht.
Das Fett dagegen bekam sie von den Gerichteten.
Es wurde sehr sorgfältig aufbewahrt und sehr teuer verkauft.
Auf diese Weise hatten meine Eltern ihr Auskommen und konnten friedlich und in gutem Einvernehmen mit den Dorfbewohnern ihr Dasein fristen.
Sogar eine eigene Bank in der Kirche hatten sie. Ganz hinten zwar, aber dennoch eine eigene Bank.
Dafür spendeten sie natürlich auch fleißig für den Wiederaufbau des tüchtig ramponierten Gotteshauses, das schließlich sogar einen neuen Turm erhielt und nicht länger nur das flache Dach trug, das den Bau notdürftig abdichten und trocken halten sollte.
Als mein Vater nun im Mai feststellte, dass sein zweiter Sohn möglicherweise doch überleben würde, er selber aber vielleicht nicht mehr lange für seine Familie sorgen könnte, beschloss er, sein Haus zu bestellen.
Er ging zum Pfarrer und meldete meine Taufe an.
Genau wie heute mein Enkel wurde auch ich im Mai in der Apostelkirche zu Groß Stöckheim getauft, damals, im Jahre unseres Herrn 1647.
Meine Mutter erzählte gern, es sei ein wunderschöner, strahlender Maisonntag gewesen.
Die Glocken hätten von der Marienkirche in der Festung her so fröhlich geläutet wie schon lange nicht mehr.
Die umliegenden Wiesen und Felder fingen an, sich zu erholen und es duftete nach jungen Blättern und Wiesenblumen.
Auch die Menschen seien an diesem Tag fröhlich gewesen wie schon lange nicht mehr.
Die Mädchen hätten sich Girlanden von den Frühlingsblumen auf den Wiesen geflochten und sie zum Kirchgang auf dem Kopf getragen.
Die ganze Gemeinde, so weit sie noch vorhanden war, soll bei meiner Taufe anwesend gewesen sein.
Ja, das war anders als heute.
Damals waren alle eng zusammengerückt und man freute sich am Glück der Nachbarn.
Das ganze Dorf hatte sich nach dem Kirchgang in einer Scheune versammelt, die Knechte hatten Tische und Bänke aufgestellt und die Mägde Körbe mit Brot und Schinken hereingeschleppt.
Für die Männer gab es zur Feier des Tages Branntwein und für die Frauen ein Getränk, das meine Mutter extra für diesen Anlass aus Löwenzahnblüten hergestellt hatte.
Dazu hatte sie jeden Tag die Dorfkinder auf die Wiesen geschickt, wo in der Mittagssonne der Löwenzahn seine dicken gelben duftenden Blüten ganz weit öffnet, welche in Körbe gesammelt und zu ihr gebracht wurden. Dafür bekamen die Kinder eine Scheibe frisch gebackenes Brot mit dick Butter und Sirup darauf.
Von den Blütenköpfen wurden die gelben Blätter abgezupft und die Kelche weggeworfen. Die Blättchen wurden dann mit Wasser und Zucker so lange gekocht, bis eine zähe Masse entstand.
Den Zucker bezog meine Mutter von einem Apotheker in Braunschweig, dem sie dafür feine Handschuhe lieferte.
Sie machte sich gerne lustig über diesen „verqueren Kerl“, wie sie ihn bezeichnete, der wohl ziemlich klein geraten war und „hässliche knotige Pfötchen“ gehabt haben soll.
Seine Apotheke, so berichtete sie, lag am Altstadtmarkt, von dem sie immer ganz besonders schwärmte.
Die Handschuhe wurden aus Hundehaut genäht, die ja bekanntlich wasserdicht ist, da Hunde keine Schweißdrüsen besitzen.
Die Lieferung von Handschuhen war und ist eine der Pflichtabgaben für den Herzog, die ein jeder Henker zu leisten hat.
Aber ein oder zwei Paare im Jahr fielen schon einmal für den „zierlichen Apothekergecken“ in Braunschweig ab, wofür er dann den begehrten Zucker lieferte.
Aus der Zuckermasse wurden einerseits Lutschpastillen hergestellt, die den Kindern gegen Husten verabreicht wurden.
Der andere Teil wurde versetzt mit Branntwein und für einige Zeit in die Sonne gestellt.
So entstand ein bittersüßes, klebriges Getränk, das den Erwachsenen als Tinktur gegen Husten verabreicht wurde.
Und den Damen als Getränk bei der Tauffeier.
Dazu wurde die "Medizin" mit reichlich Branntwein verlängert, um sie trinkbarer zu machen.
Bei uns hießen die gelben Blüten "Butterblumen" ihrer Farbe wegen, weshalb das daraus entstandene Getränk "Butterblumensuppe" genannt wurde.
Meine jetzige Frau hat das Rezept von meiner Schwester anlässlich unserer Hochzeit in einem kleinen, fein geschriebenen Buch übergeben bekommen und ich nehme an, dass man in der Küche bereits probiert, ob der "Liqueur", wie sie das Gesöff heute vornehm nennt, die richtige Konsistenz hat.
Meine Tauffeier soll nach langer Zeit die erste und für lange Zeit die letzte, ganz wunderbare Feier gewesen sein, wurde erzählt.
Mein Vater ließ mich auf seinen Namen "David" taufen.
Er war, wie gesagt, nicht mehr gesund und hatte Sorge, dass die Meisterei aus der Familie kam, wenn meine Mutter plötzlich allein dastehen würde. Darum machte er einen ungewöhnlichen Schritt und ging zu seinem Herzog.
Der hatte eine große Zuneigung zu meinem Vater, hatte der ihm doch schon verschiedentliche Male aus großem Malheur geholfen.
Der Herzog liebte das kräftige Essen und nicht immer bekam es ihm gut. Ihn plagte die Gicht und seine Ärzte verschrieben ihm Klistiere und andere Ekeligkeiten.
Mein Vater dagegen verschrieb ihm Kuren und ließ ihn darben und von Brot und klarem Wasser leben.
Die Tatsache, dass er schon nach kurzer Zeit wieder fast ohne Schmerzen laufen konnte, machte ihn zu einem dankbaren Patienten.
Die Tatsache, dass mein Vater ein gebildeter Mann war, mit dem man über viele Dinge plaudern konnte, ohne dass davon etwas an fremde Ohren gelangte, ließ ihn zu einem guten Freund werden.
Manch einer mag es bei unserem Berufsstand nicht vermuten, aber auch Henker können gebildet sein und mein Vater war nicht nur ein sehr belesener, sondern auch ein sehr freidenkender Mann, der gern Gegebenes in Frage stellte oder Unmögliches als möglich annahm.
Meine Mutter dagegen hatte immer ihre große Mühe, zu verstehen, was er meinte und hielt ihn oftmals für "etwas wirr im Kopf mit seinen Ideen".
Allerdings rechnete sie es seinem Alter zu, dass er nicht mehr so recht geradeaus denken konnte, wie sie es nannte.
So erzählte sie gern ihrer Nachbarin, dass ihr Mann eines Tages am Tisch berichtet habe, er habe mit dem Herzog darüber sinniert, ob nicht die Abortgruben aufgegeben werden sollten zugunsten eines Kanals, der die Abwässer offen oder geschlossen aus der Stadt transportieren würde. Auf diese Weise würde man den Gestank der Gruben hinter den Häusern vermindern und möglicherweise auch Krankheiten, die aus diesen Gruben entstehen könnten.
"Also, das müsst Ihr Euch vorstellen, liebste Gise, was der Mann da geredet hat.
Welche Krankheiten sollen bitteschön aus den Abortgruben hervorkriechen? Jeder hat doch Abortgruben und immer schon gehabt.
Hat man schon mal gehört, dass dort eine Krankheit herausgekommen sein soll? Solch ein Unsinn!
Höchstens, dass mal wieder eine liderliche Mutter nicht darauf geachtet hat, was ihre Kinder tun und treiben und eines dann in die Grube gefallen ist. Aber das ist doch keine Krankheit!
Wo kämen wir denn hin, wenn unsere Scheiße auf Kanälen durch die Stadt getragen werden würde.
Jeder Nachbar könnte gleich sehen, was man am Vortage gegessen und anschließend in den Kanal entleert hat.
Und was denkt ein Mann eigentlich, wie er seine Familie ernähren möchte.
Schließlich bekommt der Henker gutes Geld von den Bewohnern für das Leeren der Gruben. Was sagt Ihr nur, kann man denn so unverständig sein?"
Ein anderes Mal berichtete mein Vater, der Herzog denke darüber nach, alle Kinder für eine Zeit lang in eine Schule zu schicken, so dass am Ende jeder Mensch lesen und schreiben könne.
Und eine weiterführende Schule einzurichten, die für Kinder aus allen Schichten, sei es hoch oder niedrig, zugänglich sein würde.
"Ja hat man so etwas schon gehört!“, ereiferte sich darüber meine Mutter.
„Man stelle sich mal vor, unsere Trine würde in eine solche Schule gehen! Das wäre ja zum Lachen! Und dann kommt sie nach Hause und fängt an, mit ihrem Anverlobten herumzudisputieren und den Ehevertrag, den der Herr Advokat aufgesetzt hat, zu bekritteln.
Am Ende verlangt sie gar, sie müsse den Vertrag mit ihrem Namen unterzeichnen und ihr Verlobter auch!
Und wer soll in der Zeit, in der die Magd in der Schule hockt, ihre Arbeit machen? Soll am Ende gar ich, die Meisterin, mit dem Eimer zum Brunnen laufen und die Böden schrubben, während das gnädig Frollein Dienstmagd in der Schule weilt?? Vielleicht möchte sie anschließend noch gern meine Rechnungsbücher und Bestelllisten überprüfen, ob sich darin nicht ein Fehler findet?
Und dann noch eine "weiterführende Schule“ für Jedermann!
Am Ende sitzt gar der Sohn des Henkers neben dem des Herzogs!“
Was hatte der Mann nur immer für Ideen.
"Er war schon ein wenig verquer, euer Vater", pflegte sie zu sagen, wobei sie mich manches Mal mit einem seltsamen Blick bedachte, so dass ich das Gefühl hatte, sie hielte mich auch nicht für besonders helle im Kopf.
Zumindest kam es mir gelegentlich so vor, als würde ich misstrauisch beäugt werden, wenn ich etwas fragte, was zu fragen für unnötig gehalten wurde.
Seitdem mein Vater sich mehr und mehr vom seinem Amt zurückgezogen hatte, hatte er sich auf das Lesen verlegt.
Wo auch immer er an Bücher gelangte, beschaffte er sie.
Bücher entwickelten sich zu seiner wahren Leidenschaft.
Meine Mutter konnte damit nichts anfangen.
Sie konnte lesen, natürlich.
Aber sie konnte es zum Hausgebrauch.
Lesen um des Vergnügens willen war ihr im höchsten Maße suspekt.
In der Zeit könnte man auch etwas Nützliches tun, war ihre Ansage und um das schöne Geld tat es ihr auch Leid.
Als ich später selber anfing, heimlich in den Büchern zu stöbern und meine Mutter mich dabei erwischte, fragte sie fast jedes Mal:
"Hast du nichts um die Hand? Kann ich dir irgendwie Arbeit verschaffen?"
Ich habe von meinem Vater aber nicht nur seinen Namen und die Leidenschaft für das Lesen geerbt, sondern auch die Büchersammlung. In meinem neuen Haus habe ich mir den Luxus zweier Bücherschränke geleistet.
Vom Tischler extra angefertigt mit Regalen so tief wie ein Buch breit ist und mit schönen Türen, die große Glasscheiben haben, damit die wertvollen und schön gestalteten Einbände auch gut zur Geltung kommen.
Der junge Mann brauchte allerdings ein paar Erklärungen, bis er verstand, was ich haben wollte.
Einen Schrank baut man für gewöhnlich, um dort Geschirr oder Wäsche unterzubringen.
Extra für Bücher einen Schrank mit besonderen Maßen zu fertigen, der für nichts Anderes mehr nützlich sein würde, überstieg seine Vorstellungskraft.
Und zwei große Schranktüren mit Glasscheiben. "Bitte bedenkt die Kosten", hatte er gewimmert.
Selbstverständlich hatte ich die Kosten bedacht und auch gleich eine Zeichnung angefertigt, nach der der Tischler arbeiten sollte.
Die beiden Schränke sind sehr präsentabel geworden und stehen im kleinen Salon, wobei ich jetzt schon sehr gespannt bin, was die lieben Verwandten nachher zu sagen haben werden.
Durch die vielfältigen Verbindungen, die mein Vater über seine sehr große Verwandtschaft im ganzen braunschweigischen und hannöverschen Land unterhielt, war es ihm möglich, immer wieder Exemplare einer besonders schönen Schrift zu erwerben.
Die Schränke waren kaum geliefert, da habe ich die Bände auch sogleich eingeräumt und freue mich seither über den Anblick der ordentlich aufgereihten Ledereinfassungen.
Zu meinem großen Glück sind die Bücher nach dem Tod meines Vaters nicht zum Anheizen des Herdes verwendet worden, wie es gelegentlich vorkommt.
Aber auch nur, weil sie zunächst in Kisten verpackt und dann vergessen wurden. Wer weiß, was sonst aus ihnen geworden wäre.
Als im Jahre 1635 also der jüngere August als Herzog nach Wolfenbüttel kam, stellten die beiden Männer bald fest, dass sie in diesem Punkt die selbe Leidenschaft pflegten.
Recht schnell entwickelten sich daraus regelmäßige lebhafte Gespräche über die Zustände der Zeit, der Festung, der Welt und über Ideen, die beide in ihren Köpfen ausgebrütet hatten.
Ein Thema allerdings gab es, das durfte niemals angeschnitten werden:
Die massenhaften Hexenverbrennungen.
Herzog August war ungefähr 10 Jahre älter als mein Vater und aus Hitzacker zu uns gekommen. Dort hatte er sich einen Namen als "Hexenjäger" gemacht, weil er unerbittlich alles hatte verfolgen lassen, was als Hexe angezeigt oder denunziert worden war, unabhängig von Geschlecht, Rang oder Namen.
Mein Vater war, wie ich schon erwähnt habe, als junger Mann in Lemgo beim alten Meisner in die Lehre gegangen und auch in Lemgo nahm man die Verfolgung der mit dem Teufel im Bunde Stehenden sehr ernst, wobei besonders der damalige Bürgermeister Stute sehr sehr eifrig in seinem Tun gewesen sein soll.
Entsprechend hatte auch der Scharfrichter gut zu tun mit dem Torquieren und Richten der Verurteilten.
Mein Vater musste sehr häufig helfen, die Weiber auf die eisernen Stühle zu binden oder in die Pressen zu zwingen.
Meine Mutter hat gern erzählt, dass er wahrscheinlich damals Schaden genommen hat bei dem sich ständig wiederholenden Anblick der schreienden, blutenden und später brennenden Weiber und dem Gestank, der von den Scheiterhaufen kam, weswegen diese auch so weit weg wie nur möglich vor der Stadt aufgebaut wurden.
Man sollte annehmen, dass ein angehender Scharfrichter von Natur aus ein hartes Herz hat und sich von solcherlei Umständen nicht beeindrucken lässt.
Aber so ist es nicht und ich kann das verstehen, geht es mir doch genau so, weshalb ich gern von meinem älteren Bruder Heinrich als ein „Weichei“ bezeichnet werde.
Mein Vater war ein junger Mann damals, wahrscheinlich schon sehr früh empfindsam und eher dem Wissen als dem Schlachten zugeneigt.
Doch außer Scharfrichter zu werden hatte er keine Wahl. Wer aus einer Scharfrichterfamilie stammt, dem steht kein anderer Broterwerb zur Verfügung.
Er muss sehr gelitten haben unter den Umständen, was ihn aber nicht davor bewahrte, ebenfalls das Schwert in die Hand zu nehmen.
Ich glaube heute, er war froh, als er sein Amt verkaufen und sich nur noch seinen Büchern und der Medizin widmen konnte.
Wahrscheinlich wäre er ein besserer Arzt denn ein Henker geworden, was ich natürlich nur vermuten kann, da ich ihn ja nicht wirklich kennengelernt habe.
Ich weiß nur, dass er sich, wie meine Mutter behauptete, so gut es ging gedrückt hat vor Exekutionen weiblicher Missetäter. Wenn so etwas anstand, hätte er gerne über Land zu tun gehabt und seinen Gesellen die Arbeit überlassen.
Als dann später der Hexenjäger auf den Hexentöter traf, wollte sich mein Vater das gute Einvernehmen nicht durch Gespräche über dieses unselige Thema verderben.
Es gab ja auch genügend andere Dinge, über die er mit dem gebildeten und ideenreichen Herzog plaudern konnte.
Mein Vater erzählte ihm also von der Geburt seines zweiten Sohnes, von der Taufe und auch davon, dass sein eigener Gesundheitszustand nicht mehr der Beste sei und er seine Söhne versorgt sehen möchte.
Wenn es auch sehr ungewöhnlich erscheinen möge, so bitte er doch darum, die Meisterei des Herzogtums seinem nach ihm benannten Sohn David als Erbe eintragen zu dürfen.
Das war in der Tat ein ungewöhnlicher Wunsch, wurde doch das Amt gewöhnlich von einem Bewerber gegen gutes Geld erworben.
Der Herzog bat sich Bedenkzeit aus.
Erst zwei Monate später ließ er meinen Vater wieder zu sich rufen, teilte ihm mit, er habe über das Ansinnen nachgedacht und sei zu folgendem Entschluss gekommen:
Er werde ihm, David Voss dem Älteren, amtlich bestallter Nachrichter zu Wolfenbüttel, gestatten, dieses Amt seinem Sohn, David Voss dem Jüngeren, als Erbe zu übertragen unter der Bedingung, dass das Haus des herzöglichen Nachrichters an alter Stelle vor dem Herzogtore, auf dem Grundstück am Juliusdamm, hart an der Oker gelegen und auf Groß Stöckheimer Gebiet, alsbald wieder aufgerichtet und die Meisterei wieder nach dort verlegt werde.
Mit dieser Bedingung erklärte mein Vater sich einverstanden, war das Haus in Groß Stöckheim sowieso schon etwas in die Jahre gekommen und für einen Abdeckereibetrieb nicht geeignet, da es viel zu dicht an den Nachbarshäusern lag.
Der Herzog ließ die Urkunde aufsetzen, mit der ich als Erbe in das Amt meines Vaters eingesetzt wurde, sobald ich das Alter erreicht und meine Lehrzeit absolviert hätte.
Die Anordnung für den Wiederaufbau des Hauses wurde angefügt und die Urkunde gesiegelt.
Danach widmeten sich die beiden Männer ihren Gesprächen, ihren Erinnerungen, ihrem Pfeifchen und ihrem Port.