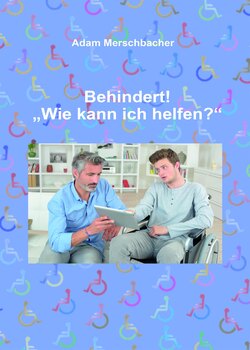Читать книгу Behindert! "Wie kann ich helfen"? - Adam Merschbacher - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Wie kann ich helfen“?
„Es gibt bei Menschen mit Behinderung die Unterscheidung, dass sich die einen hervorragend über ihre zustehenden Rechte auskennen und die Anderen nichts über mögliche Erleichterungen wissen und sich schämen, um Hilfe zu bitten. Das muss jetzt vorbei sein!“
Adam Merschbacher
Ein Behinderter oder eine Behinderte ist nun mal behindert und kein Mensch mit „besonderen Anforderungen“. Also nennen wir künftig einfach das Kind beim Namen.
Natürlich gibt es auch Mehrfachbehinderte. Aber deshalb unterstellt man einem Körperbehinderten nicht zwangsläufig ein geistiges Handicap. Eine Behinderte mit Sprachfehler, darf deshalb jederzeit einen Marathon mitlaufen. Ein Blinder kann wunderschöne Arien singen und eine junge Frau mit Down-Syndrom (Trisomie 21) ist häufig musikalisch begabt, liebevoll, zärtlich und hat vereinzelt ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl.
Diese Vorurteile beruhen meist auf Unwissenheit und bauen eine zusätzliche Hemmschwelle im Umgang zu Behinderten auf. Genauso könnte man eine Rollstuhlfahrerin treffen, die so stolz auf ihre Selbständigkeit ist, dass sie alle Helfer beim Einsteigen in den Bus, mit den Worten „gehen sie weg, ich kann das schon alleine“ vor den Kopf stößt, so dass keiner dieser hilfsbereiten Leute auch nur einen Finger krümmt, wenn das nächste Mal eine Behinderte nach einem MS-Schub den Handlauf ihres Rollstuhls nicht mehr greifen kann, wegschauen ohne zu helfen.
Wir waren die letzten Gäste beim „Griechen“. Der Kellner verabschiedete sich von mir mit Handschlag. und beugte sich zum Rollstuhl herunter und sagte „Kali Nichta, gute Besserung“.
Danke! Das war ganz bestimmt lieb gemeint, passt aber bei einem MS-Geschädigten nicht so richtig zum Krankheitsbild. Doch woher sollte der Kellner in Gottes Namen etwas über mich oder gar über meine Behinderung wissen. Er nimmt lediglich wahr, dass jemand vor ihm im Rollstuhl sitzt.
Mehr Anteilnahme oder Interesse, darf keinesfalls erwartet werden und wäre wohl auch übertrieben, ungewohnt und nicht der Situation angepasst. Dem Kellner tat ich in seiner Wertvorstellung einfach nur leid, dass ich in seinen Augen so eingeschränkt war.
Damit sind wir auch schon mitten im Thema dieses Buches. Wie gehen Gesunde, Behinderte und Betroffene miteinander um. Was kann man vom anderen oder von sich selbst ehrlich erwarten und realistisch, also nicht blauäugig, voraussetzen?
Natürlich verabschiedet man sich von einem querschnittsgelähmten gerade nicht mit den Worten, sofern man es auch noch weiß „Gute Besserung“ und auch nicht mit „Schau mal her“ von einem Blinden oder „weißt du noch“ von einem Demenzkranken. Aber das entsetzt die Betroffenen unter normalen Umständen nicht, da solche Aussagen an der Tagesordnung sind und meist nicht böse gemeint sind. Es sind auch nicht die Worte, die verletzen, sondern es ist die Gleichgültigkeit und Ignoranz, wenn man Probleme und Schwierigkeiten bemerkt, bzw. bemerken könnte. Der Humor, den Behinderte selbst an den Tag legen, täuscht häufig einen falschen Gemütszustand vor, wenn der Querschnittsgelähmte flunkert „wenn das so weiter geht, stehe ich auf und gehe fort“ oder eine Blinde droht „noch einmal, dann schau ich dich nie wieder an“.
Dabei wäre der Umgang miteinander so unkompliziert und einfach. Fällt ein Rollstuhlfahrer beim Aufstehen (Transfer) hin, eine Blinde stolpert über einen überstehenden Gullydeckel oder es blickt ein junger Mann mit Bewegungsstörung apathisch auf seine spastischen Füße, dann wäre die Frage passend „wie kann ich helfen“?
Das ist das ganze Geheimnis, mehr ist nicht zu sagen. Der oder die Gestürzte sagt schon was zu tun ist, da dies vermutlich nicht zum ersten Mal geschehen ist und man ja selbst am besten weiß, wodurch geholfen werden kann. Auf keinen Fall darf man einfach willkürlich handeln und auf diese Weise unnötigen Schaden oder eine Verletzung verursachen. Helfen ohne vorher zu fragen ist keine Hilfe, sondern Belästigung. Niemand möchte gerne ungefragt irgendwo hingeschoben oder über die Straße geführt werden. Im Alltag benötigen behinderte Menschen manchmal die eine oder andere Hilfe oder Unterstützung von Nichtbehinderten.
Im Jahre 2016 waren in Deutschland 7,6 Millionen Menschen schwerbehindert, was annähernd 10 % der Bevölkerung betrifft. Davon erhielten knapp 895.000 Personen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem sechsten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) wofür 16,5 Milliarden € netto aufgewendet wurden (statistisches Bundesamt). Die Staaten in Europa versuchen sich in Sachen Behinderten-Gleichbehandlung und Leistungen einander anzunähern. Es ist jedoch noch ein eklatanter Unterschied, ob man in Deutschland oder in einem weniger organisierten Nachbarland behindert ist.
„Schau mal Mama, wie der Mann aussieht“ das Kind deutet mit dem Finger auf den körperlich behinderten jungen Mann in der U-Bahn, den gerade eine Spastik entstellt. Die Erklärung der Mutter lautet „komm, das ist ein Betrunkener“.
Der Mann ist keineswegs betrunken, er ist nur einfach gerade krankheitsbedingt auffällig. Doch was oder wie soll das kleine Kind einen angemessenen Umgang mit Behinderten lernen, wenn seine Mutter es selbst versäumt hat, richtiges Verhalten im Umgang mit Menschen mit Handicap an den Tag zu legen.
Am liebsten würde man da antworten „ich wäre lieber stock besoffen, als querschnittsgelähmt“.
Wie schnell, kann es einen von heute auf morgen selbst treffen. Es kann ein Unfall sein, eine Krankheit oder eine falsche Krankenhausbehandlung bei einem leichten Eingriff. Man könnte genauso schnell plötzlich Pflegeperson seines Kindes, des Ehegatten oder eines nahen Angehörigen werden. In der Regel war es in der Lebensplanung nicht vorgesehen und in der Vergangenheit wurde man auch nicht speziell für so eine Situation geschult und vorbereitet.
Absolut peinlich wird es, wenn man körperlich Behinderte für zwangsläufig geistig beschränkt hält und sie in Ausländerdeutsch „Du mich verstehen“ oder kindlich „kannst Du mir zeigen, was Du wollen“ anspricht. Die Steigerung davon ist eine Unterhaltung, in der man über einen in der dritten Person spricht, als wäre man ein beigestelltes Möbelstück. Im Unterricht sagte eine Lehrerin zu einer neben einem Autisten sitzenden Schülerin „sag Heinz, dass wir Morgen die Schulaufgabe schreiben“. Heinz hatte weder einen Hörfehler, noch war er unsichtbar. In Amerika ist es sehr gefährlich, wenn Gehörlose mit der Polizei unbewusst in einen Konflikt kommen, wenn der Polizist einen von hinten mit den Worten auffordert „Stehen bleiben!“. Die Nichtbeachtung könnte falsch ausgelegt werden und fatale Folgen haben, wie beispielsweise eine Verhaftung oder sogar einen Schuss.
Äußerlich entstellte Personen und auffällig gestikulierende werden gern in Restaurants auf Nebentische (Katzentische) geleitet, in Flugzeuge auf die letzten Plätze befördert sowie in Hotels in das abgelegenste Zimmer verfrachtet, damit ihr Aussehen andere Fluggäste und Besucher nicht stört. Ein Stephen Hawking wurde vermutlich überall freundlichst hofiert. Sieht man dagegen nur aus, wie Hawking ausgesehen hat, ist der letzte Platz unmittelbar neben der Toilette bereits reserviert.
Völliges Unverständnis und Desinteresse werden erkennbar, wenn Blinden vom Gericht ein Gebärdendolmetscher zur Seite gestellt wird.
Gesunde haben oft Berührungsängste mit Behinderten und Kontaktschwierigkeiten aus Angst, etwas falsch zu machen. Aber keine Angst, man muss sich auch nicht von Bekannten zurückziehen, wenn darunter Behinderte sind, mit der Rechtfertigung, man wisse nicht wie man damit umgehen und worüber man sprechen soll. Die Gespräche können sehr interessant sein und besonderes ist auch nicht zu beachten. Vielleicht genügt schon eine einfache Unterstützung am Buffet oder mal das Fenster im verrauchten Zimmer zu öffnen. Das ist es dann meist schon.
Ob Kind, Mann oder Frau, körperlich oder geistig leicht- bis schwerbehindert, Behinderte sind Menschen mit meist sehr empfindlicherer Sensibilität, Ängsten und oft größeren Sorgen und Depressionen als Gesunde und den daraus resultierenden Alltagsproblemen.
Ich gebe gerne zu, Behinderte können, wie jeder andere Mensch auch, „Arschlöcher, Vollidioten und Drecksäcke“ sein. Diese darf man auch entsprechend ignorieren und den Umgang auf ein nötiges Minimum reduzieren. Leider haben Pflegekräfte, Angehörige und medizinische Betreuer nicht immer die Möglichkeit der Ablehnung von „Stinkstiefeln“. Diese haben aber auch gelernt, damit professionell umzugehen, zumindest die meisten.
Alle Menschen kommen mit einer Würde und einem sehr starken Lebenswillen auf die Welt. Die Würde, die uns von außen widerfährt, ist laut Grundgesetz unantastbar. Daran hält sich jedoch nicht jeder auf der Straße. Es gibt darüber hinaus auch noch eine persönliche, individuelle Würde. Diese wird im Laufe eines Lebens entweder gefestigt und dann Selbstbewusstsein genannt oder auf vielfältige Weise demoralisiert und moralisch zerstört.
Zu keinem Thema gibt es mehr „Witze“, als über Behinderte und vom Leben benachteiligte Menschen. Lustig vielleicht, wenn man davon selbst nicht betroffen ist. Deshalb lachen auch nur „gesunde“ und sehr einfältige Menschen über Behindertenwitze.
Gefestigte Personen haben damit eigentlich auch keine Probleme, aber leider sind diese in der Minderheit und der Witzeerzähler kann die beiden Wesenstypen nicht unterscheiden. Die häufig gehörte Floskel, dass die besten Behindertenwitze von Behinderten selbst stammen, ist ein Irrglaube, sofern diese Aussage lapidar von Nichtbehinderten kommt. Nur weil diese, meist aus Verlegenheit, darüber lachen, sagt es nichts über die Kränkung, Beleidigung oder Demütigung aus, die sie erfahren. Wenn Witze von Behinderten untereinander zum Besten gegeben werden, dann ist das etwas anderes.
Jemand gilt als behindert, wenn nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) eine Schädigung der körperlichen Funktionen, der geistigen Fähigkeiten oder der Psyche (seelische Gesundheit), über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich, von mindestens 6 Monaten vorliegt und damit das Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Bei der Beeinträchtigung kann es sich um angeborene, krankheitsbedingte, überwindbare oder dauernde Einschränkungen handeln.
Art und Schwere der Behinderung, sowie deren Ursache sind zwar für den Betroffenen wichtig, aber nicht wesentlich aussagefähig für andere nicht betroffene Mitmenschen, die mit dem Thema und der Behinderung nicht vertraut sind und kein Grundwissen dazu besitzen.
Im Internet findet man Kontaktportale für Personen mit Behinderung. Da verbindet sich dann, wie ein Psychologe unlängst meinte, „Not mit Elend“. Das sehe ich völlig anders. Warum sollen sich nicht zwei gleich- oder unterschiedlich Behinderte ergänzen? Aber auch Gesunde können sich mit Behinderten zusammentun. Nach meiner persönlichen Meinung ist hier alles möglich und „fast alles“ erlaubt.
Ob das Leben eines Behinderten trotz dessen Behinderung Spaß und Freude bereitet, hängt in erster Linie von der persönlichen Lebenseinstellung, dem sozialen Umfeld, der Pflegesituation und einer eventuell funktionierenden Partnerschaft ab. Die Behinderungsart und der Grad der Behinderung spielen dabei nicht die Hauptrolle. Im Gegenteil! Häufig sind gerade die Betroffensten und sehr schwer behinderten, die am demütigsten und verständnisvollsten Menschen. Wer ständig jammert, nach Mitleid heischt und jedem sein „Los“ mitteilt, den wünscht man sich sonst wohin, aber nicht in seine ständige Umgebung.
Auch gesunde Menschen haben Probleme. Da können Fußballprofis nachts nicht schlafen, wenn im gleichen Verein, ein Mitspieler 300.000 € im Monat verdient und man selbst nur 290.000 €. Oder der Nachbar fährt einen neuen BMW und man kommt selbst mit einem 10 Jahre alten PKW daher. Es sind zwar völlig andere Sorgen, aber auch sie sind real vorhanden und können psychisch krank machen.
„Ziemlich beste Freunde“. Wer hat den Film nicht gesehen? Wie eine Entwicklung von einem völlig illusionslosen Senegalesen nach einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme durch das Arbeitsamt zu einem unkonventionellen Pfleger für einen Tetraplegiker (Querschnittsgelähmten) wird, der diesem zwar steinreichen, aber isoliert dahin vegetierenden Philippe neuen Lebensmut und für sich selbst eine ganz neue Perspektive hervorbrachte, dies zeigt dieser Film in ganz vielen Einzelepisoden. Wirklich sehenswert!
Nach meiner ganz persönlichen Meinung ist ein Teil der Behinderten gut versorgt in Deutschland. Der andere Teil ist nicht gut, bis sehr schlecht versorgt. Die Ursache ist hauptsächlich Unwissenheit über Möglichkeiten der Unterstützung und der angebotenen Hilfsleistungen, auf die sogar rechtliche Ansprüche bestehen würden.
Dazu habe ich sehr viel recherchiert, da vieles auch für mich neu war, sich verändert hat und in mehreren Kapiteln in diesem Buch beschrieben wird. Wir dürfen aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht überstrapazieren, damit das Erreichte erhalten bleibt. Das stellte ich am Entwurf für das sogenannte Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz von Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) fest. Im Kern geht es darum, Geld für die Krankenkassen und die Sozialkassen einzusparen. Diese daraus folgende existenzielle Angst treibt derzeit viele Pflegebedürftige und ihre Familien in Deutschland um. Angehörige und Interessensgemeinschaften sind daraufhin auf die Barrikaden gegangen und haben damit ein Umdenken erreicht.
Da sollten Patienten beispielsweise mit ALS, jener Nervenkrankheit auf die vor fünf Jahren die „Ice Bucket Challenge“ aufmerksam machte, laut dem neuen Gesetz, das Jens Spahn plante, wohl gezwungen werden, ihr Zuhause zu verlassen und in ein Pflegeheim umzuziehen. Ziel des Gesetzes ist, die Pflege Schwerstkranker zu reformieren. Denn in der Intensivpflegebranche läuft derzeit einiges schief. Die gesetzlichen Krankenkassen geben pro Jahr mehr als zwei Milliarden Euro aus, um jene Patienten im Land zu versorgen, die rund um die Uhr Pflege benötigen und nicht in einem Pflegeheim leben, sondern zu Hause oder in einer „Wohngemeinschaft“. Es ist sicherlich richtig, dass einige schwarze Schafe aus den ambulanten Pflegediensten hier ihr „Schindluder“ treiben. Will man dieses Problem auf dem Rücken und der Lebensqualität von Schwerstbehinderten lösen, dann macht es sich die Politik einfach nur zu leicht.
Deshalb war der Appell an das Gesundheitsministerium so wichtig, noch einmal darüber nachzudenken und nachzurechnen, wie hoch die Einsparungen tatsächlich sind, da der Aufwand in Pflegeheimen – sofern ausreichend Personal abgestellt wird – nicht sehr viel geringer sein kann, da das Pflegeheim ein vielfaches an Lohnkosten erwirtschaften muss, ohnehin kein Personal findet und die Herauslösung von gepflegten Personen aus der vertrauten Umgebung einfach nur menschenunwürdig und brutal ist. Sehr viel einfacher wäre es, die Qualifikation und Abrechnungsmethoden dieser ambulanten Pflegekräfte intensiver zu überprüfen und Anforderungen den Umständen nach neu und konkret zu definieren. Der Gesetzgeber müsste nur einmal die Betroffenen fragen, mit welchem Lebenswillen und Glücksempfinden sie sich zu Hause, trotz schwerster Krankheit und Einschränkung dennoch sehr wohl fühlen.
Was die Akzeptanz von Behinderten anbetrifft, so können wir Behinderten sehr viel dazu beitragen, indem wir nicht bei jeder Kleinigkeit auf unsere Rechte bestehen, wenn es auch anders ginge. Jeder Nichtbehinderte wird sich künftig weniger hilfsbereit zeigen, wenn man für seine angebotene Hilfe vor den Kopf gestoßen wird oder schlechte Erfahrungen mit Menschen mit Handicap macht. Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Toleranzgrenze untereinander äußerst gering ist. Da kommt es sogar zur Rivalität und Aussagen unter Behinderten, wie z. B.: „Ich bin aber mehr behindert als du“. Da kann ich nur sagen „Gratuliere“.
Speziell unter Jugendlichen werden Behinderte oft verächtlich mit Bezeichnungen bedacht, die verletzen und ausgrenzen. Auch wenn es nicht so böse gemeint ist, bitte keine Namen verwenden, wie „Krüppel“, „Spastiker“, „Freak“, „Fruchtzwerg“, „Mongo“, „Trottel“, „Schwachsinnig“, „Dummkopf“, „Missgeburt“, „Abnormal“, „Spasti oder Spacko“, „Wasserkopf“ oder „Blöd“.
Es gibt durchaus auch andere Namen, die man verwenden kann, wie „Mensch mit Handicap“, „behindert“, „gehörlos oder gehörgeschädigt“, „Invalide“, „Autist“, „Mensch mit Beeinträchtigung“ oder „blind“.
Aber es kommt nicht allein auf die Bezeichnung an. Sehr viel wichtiger sind die Absicht und der Zusammenhang, zu dem etwas gesagt wird. Während ein „Du bist doch Behindert“ eine Beleidigung sein kann, wenn man die Worte eines körperbehinderten kommentiert, so kann „Bist du auch ein Krüppel?“ eine Anerkennung sein, wenn er oder sie zum Beispiel Mitglied im „Münchner Crüppel Cabaret“ ist. In München hat die Wiesenwirtin Katharina Inselkammer ein Lokal mit besonderen Menschen eröffnet. Sie hat einen ganz neuen Versuch mit dem Projekt „Kunst-Werk-Küche“ gewagt. Das ist nicht irgendeine gastronomische Unternehmung. "Meine Mitarbeiter sind zu 30 Prozent besondere Menschen", sagt Katharina Inselkammer. Das würden zwar möglicherweise viele Wirte auch von ihrer Belegschaft sagen, aber was Inselkammer angeht, so muss man wissen, dass sie den Begriff "besondere Menschen" verwendet für Menschen, die mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen leben. "Ich will beweisen, dass man in einem bunten Team genauso gut arbeiten und erfolgreich wirtschaften kann wie sonst auch", sagt sie, "dazu braucht es keine Gemeinnützigkeit." Hut ab, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Katharina hier häufig an ihre Grenzen stößt. Umso bewundernswerterer ist dieses Projekt und vor allem Franziska Inselkammer.
Nicht die Bezeichnung beleidigt, sondern das, was damit gemeint ist, entscheidet über Aussage oder Beleidigung. Was wird in der Sprache nicht alles umschrieben. Da werden „Ausländer“ zu „Menschen mit Migrationshintergrund“ und „Hilfsarbeiter“ zu „Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen“.
Blickt man in der Geschichte zurück, so gab es je nach Epoche sehr viel schlechtere Zeiten für Behinderte.
In der römischen Antike war das familiäre Umfeld einzig und allein entscheidend, ob Behinderte in der Familie unterstützt wurden oder betteln gehen mussten. Im Zweifelsfall wurden sie getötet oder einfach nur ausgesetzt. Aber so ging es auch unehelichen Kindern und weiblichen Menschen.
Im Mittelalter wurde mit Verbreitung des Christentums nach dem Prinzip der „Nächstenliebe“ eine gesetzlich geregelte „Armenpflege“ eingeführt. Dennoch wurden Behinderungen allgemein als „Strafe Gottes“ und auch sittliche Verfehlung “moral insanity“ bzw. „Teufelsbesessenheit“ gesehen. Mit dieser Rechtfertigung wurden behinderte Menschen, selbst innerhalb der Familie verstoßen oder als „Jahrmarktattraktion“ vorgeführt.
In der Neuzeit war die Hoch-Zeit der Irrenanstalten. Aufgrund verbreiteter Landflucht brachen Familienbanden auseinander und behinderte Familienmitglieder wurden in staatlichen Einrichtungen versorgt. Während Kriegsverletzte wieder als Arbeitskräfte eingesetzt wurden, brachte man die behinderten Menschen in „Anstalten der sogenannten Irren-, Krüppel- und Gebrechensfürsorge“ unter. In Preußen (1891) verhinderte die Armengesetzgebung noch die berufliche Rehabilitation und medizinische Versorgung behinderter Menschen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis etwa 1933 kümmerte man sich in der Medizin, insbesondere Psychiatrie, nun zunehmend um die medizinische Versorgung von behinderten Menschen. Gleichzeitig befasste sich die sogenannte „Krüppelpädagogik“ mit den Ursachen von Krankheit und Behinderung von Kindern und Jugendlichen. Diese durften nun getrennt von nicht behinderten Kindern auch zur Schule gehen. Der „Selbsthilfebund für Körperbehinderte“ setzte sich 1917 gegen den „Krüppel-Begriff“ und für die Verwendung der Bezeichnung „Körperbehinderung“ ein.
Der Nationalsozialismus (1933 bis 1945) sorgte dafür, dass behinderte, sowie arme und kranke, Menschen in Heimen und Krankenhäusern zu Versuchsobjekten degradiert und dort im Zuge des „Euthanasieprogramms“ zu Hunderttausenden sterilisiert und getötet wurden. In den 30er-Jahren erschien der Begriff „Erbkrankheit“ im Erbgesundheitsgesetz.
Im Nachkriegsdeutschland wurde die Zwangssterilisationen für Menschen mit Behinderungen abgeschafft (aber erst 2007 als grundgesetzwidrig anerkannt) Im Nürnberger Ärzteprozess (1946-47) wurden einige wenige Ärztinnen und Ärzte, hauptsächlich aus Konzentrationslagern, wegen des „Euthanasieprogramms“ verurteilt. Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ (1948) berücksichtigte behinderte Menschen dennoch nicht und erst 1990 wurden Kinder mit Behinderungen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen miteinbezogen.
Da in der DDR möglichst alle Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integriert wurden, so auch Menschen mit Behinderungen. Für Kinder, die erst auf Sonderschulen lernten, konnten dort auf Regelschulen wechseln. Alle anderen kamen in Pflegeheimen unter, damit die Eltern arbeiten konnten. Dem gegenüber förderte die BRD vor allem kriegs- und arbeitsverletzte Menschen und beschäftigte behinderte Menschen in Werkstätten, Sonderschulen und Berufsförderwerken.
Selbsthilfeorganisationen wie die „Aktion Sorgenkind“ (heute „Aktion Mensch“) sammelten in den 60er-Jahren Spenden für bessere Bildungsbedingungen. Zehn Jahre später entstand dann nach Vorbildern aus den USA und Großbritannien die Behindertenbewegung oder „Krüppelbewegung“. Diese wies mit dem provokanten Wort „Krüppel“ auf die Stigmatisierung behinderter Menschen als Mitleidsobjekte hin und erreichte letztlich, dass im Jahre 1994 das Verbot der Benachteiligung aufgrund von Behinderung im Grundgesetz verankert wurde.
Ab 1994 folgten weitere Gesetzesänderungen, die Menschen mit Behinderungen mehr Rechte einräumten (z. B. im Baurecht oder in Bezug auf die Rente). Außerdem wurde das Sonderschulsystem durch Förderzentren ergänzt. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten (bzw. „mit geistiger Behinderung“) vereinigten sich für ein selbstbestimmtes Leben im Netzwerk „Mensch zuerst“.
Seither setzte sich allmählich eine neue Perspektive durch. Es ist vor allem die Gesellschaft, die Menschen behindert. Die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sollte in Deutschland ab 2002 das Bundesgleichstellungsgesetz gesetzlich gewährleisten, auf internationaler Ebene gilt seit 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention. Mit dem Begriff Inklusion wird die menschliche Vielfalt gefördert, indem Menschen mit Behinderung genauso wie andere Menschen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen haben und dort auch willkommen sind.
Wer behindert ist, ob körperlich oder geistig, sollte sich entweder umfangreich orientieren und informieren oder jemanden ganz freundlich suchen und um Hilfe/Unterstützung bitten.
Niemand trifft eine Schuld für unsere Behinderungen und keiner oder keine können medizinisch wirklich helfen, zumindest in den meisten Fällen. Deshalb ist es auch so einfach mit uns Behinderten klar zu kommen. Deshalb stehen keine Schuldzuweisungen und auch keine falschen Hoffnungen zwischen uns. Das gilt in der Regel für die Mehrzahl der Behinderten. Das ist Fakt und es ist gut so.