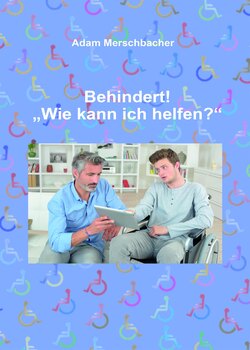Читать книгу Behindert! "Wie kann ich helfen"? - Adam Merschbacher - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Behinderung ist keine Krankheit
Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.
Ludwig Börne (1786-1837),
Eine Behinderung ist keine Krankheit, wenngleich auch Behinderte krank werden können. Das differenzierende Merkmal einer Krankheit ist die Heilungsmöglichkeit. Deshalb können auch Behinderte krank und somit krankgeschrieben werden und eine Blindarmentzündung, Grippe oder Darmkrebs bekommen.
Andererseits kann man mit einer Krankheit auch sehr eingeschränkt sein, ohne behindert zu sein. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn nach einem Beinbruch der Fuß im Gips eingeschalt ist und man sich zwangsläufig nur mit Krücken fortbewegen kann.
EuGH urteilt zur Abgrenzung von Behinderung und Krankheit
EuGH, Urt. v. 11.04.2013 – C-335/11, C-337/11
Eine heilbare oder unheilbare Krankheit, die eine physische, geistige oder psychische Einschränkung mit sich bringt, kann einer Behinderung gleichzustellen sein. Die Verkürzung der Arbeitszeit kann als eine Vorkehrungsmaßnahme angesehen werden, die ein Arbeitgeber ergreifen muss, damit Menschen mit Behinderung arbeiten können.
In seinem Urteil hat der Gerichtshof zunächst klargestellt, dass der Begriff "Behinderung" dahin auszulegen ist, dass er einen Zustand einschließt, der durch eine ärztlich diagnostizierte heilbare oder unheilbare Krankheit verursacht wird, wenn diese Krankheit eine Einschränkung mit sich bringt, die insbesondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren den Betreffenden an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, hindern können, und wenn diese Einschränkung von langer Dauer ist. Der Gerichtshof führt aus, dass der Begriff "Behinderung", anders als die Arbeitgeber in diesen beiden Rechtssachen geltend machen, nicht unbedingt den vollständigen Ausschluss von der Arbeit oder vom Berufsleben impliziert. Ferner hängt die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung nicht von der Art der zu treffenden Vorkehrungsmaßnahmen, wie z. B. der Verwendung besonderer Hilfsmittel, ab. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob bei den Arbeitnehmerinnen im vorliegenden Fall Behinderungen vorlagen.
Man hat die unzähligen Erscheinungen von Behinderungen nach ihren Arten von Einschränkungen eingeordnet, die das Denk-, Lern-, Sprach-, Verhaltens- oder Wahrnehmungsvermögen beeinträchtigen. Die offizielle und rechtsgültige Definition für Deutschland liefert § 2 Absatz 1 des Neunten Sozialgesetzbuchs (SGB IX), worin Menschen als behindert gelten, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Auf welche Leistungen die Betroffenen ab welchem Grad der Behinderung in diesem Fall Anspruch haben, regelt ebenfalls das Neunte Sozialgesetzbuch
Die Arten von Behinderungen lassen sich in folgende Gruppen einteilen:
• Körperliche Behinderungen, z. B. motorische Einschränkungen, Beeinträchtigungen der Seh-, Hör- und Sprachfähigkeit, chronische Krankheiten
• Geistige Behinderungen, z. B. Lernbehinderungen, gestörte kognitive Fähigkeiten, stark unterdurchschnittliche Intelligenz
• Seelische Behinderungen, z. B. Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Suchtkrankheiten, Psychosen
Sowohl die Schwere von Behinderungen als auch deren Ursachen sind völlig unterschiedlich. Einige bestehen von Geburt an, andere werden erst durch einen Unfall oder eine Krankheit im Laufe des Lebens „erworben“. Gerade im hohen Lebensalter kommen viele Faktoren zusammen, die den Betroffenen auf mehrfache Art und Weise einschränken können. Ein abschreckendes Beispiel ist das von Michael Schumacher, dem erfolgreichsten Formel-1-Piloten, der in seinen Rennen Kopf und Kragen riskiert hat, wobei nie schwere Unfälle geschahen. Im Dezember 2013 zog er sich bei einem Skiunfall schwerste Kopfverletzungen zu und befindet sich seither in medizinischer Rehabilitation. Niemand kann sich daher sicher sein, wann und ob ihn ein solch schweres Schicksal trifft. Zu den unterstützenden Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen gehören entsprechende Therapien, medizinische Behandlungen und die Pflege und Betreuung von Behinderten, die nicht mehr alleine zurechtkommen. Dabei besteht in den verschiedenen Therapien meist nur der bescheidene Anspruch den augenblicklichen Zustand zu erhalten und einer Verschlechterung vorzubeugen.
Der Unterschied zwischen Behinderung und Schwerbehinderung besteht nach dem Sozialgesetzbuch IX darin, dass man behindert ist, wenn man einen GdB von 20, 30 oder 40 hat (§ 69 Abs. 1 SGB IX).
Als schwerbehindert bezeichnet man jemanden, mit mindestens einem GdB von 50 (§ 2 Abs. 2 SGB IX).
Wer eine Behinderung mit einem Grad von 30 oder 40 hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen einem Schwerbehinderten gleichgestellt werden (§ 2 Abs. 3 SGB IX).
Man bezeichnet in der Umgangssprache den Grad der Behinderung (GdB) überwiegend mit dem Faktor "Prozent". Der GdB wird ausschließlich in 10er-Graden festgestellt.
Zur Unterscheidung hat man in der "Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung" (VersMedV) viele Krankheiten mit dem jeweiligen GdB aufgeführt:
GdS-Tabelle
Den GdB findet man unter Anlage zu § 2 VersMedV. (Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes, vom 10. Dezember 2008) Hier eine Inhalts-Übersicht:
Teil A: Allgemeine Grundsätze
1. Schädigungsfolgen
2. Grad der Schädigungsfolgen (GdS), Grad der Behinderung (GdB)
3. Gesamt GdS
4. Hilflosigkeit
5. Besonderheiten der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen
6. Blindheit und hochgradige Sehbehinderung
7. Wesentliche Änderung der Verhältnisse
Teil B: GdS-Tabelle
1. Allgemeine Hinweise zur GdS-Tabelle
2. Kopf und Gesicht
3. Nervensystem und Psyche
4. Sehorgan
5. Hör- und Gleichgewichtsorgan
6. Nase
7. Mundhöhle, Rachenraum und obere Luftwege
8. Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen
9. Herz und Kreislauf
10. Verdauungsorgane
11. Brüche (Hernien)
12. Harnorgane
13. Männliche Geschlechtsorgane
14. Weibliche Geschlechtsorgane
15. Stoffwechsel, innere Sekretion
16. Blut, blutbildende Organe, Immunsystem
17. Haut
18. Haltungs- und Bewegungsorgane, rheumatische Krankheiten
Teil C: Begutachtung im sozialen Entschädigungsrecht
1. Ursachenbegriff
2. Tatsachen zur Beurteilung des ursächlichen Zusammenhangs
3. Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs
4. Kannversorgung
5. Mittelbare Schädigungsfolgen
6. Absichtlich herbeigeführte Schädigungen
7. Anerkennung im Sinne der Entstehung und Anerkennung im Sinne der Verschlimmerung
8. Arten der Verschlimmerung
9. Fehlen einer fachgerechten Behandlung
10. Folgen von diagnostischen Eingriffen, vorbeugenden und therapeutischen Maßnahmen
11. Ursächlicher Zusammenhang zwischen Schädigung und Tod
12. Vorschaden. Nachschaden, Folgeschaden
13. Voraussetzungen für die Pflegezulage, Pflegezulagenstufen
Teil D: Merkzeichen
1. Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr (Merkzeichen G)
2. Berechtigung für eine ständige Begleitung (Merkzeichen B)
3. (aufgehoben)
4. Gehörlosigkeit (Merkzeichen Gl)
Weitere Merkzeichen sind
- Außergewöhnliche Gehbehinderung (Merkzeichen aG)
- Hilflosigkeit (Merkzeichen H)
- Blindheit (Merkzeichen Bl)
- Ermäßigung von der Rundfunkbeitragspflicht (Merkzeichen RF)
Diese Vorgaben sind das „Gebetbuch“ für die Beurteilung und Anerkennung von Behinderten. Einige Krankheiten geben eine ungefähre Einstufungsmöglichkeit vor, wie:
| Stottern | GdB |
| leicht | 0-10 |
| mittelgradig, situationsunabhängig | 20 |
| schwer, auffällige Mitbewegungen | 30-40 |
| mit unverständlicher Sprache | 50 |
Lymphödem
an einer Gliedmaße
| ohne wesentliche Funktionsbehinderung, Erfordernis einer Kompressionsbandage | 0-10 |
| mit stärkerer Umfangsvermehrung (mehr als 3 cm) je nach Funktionseinschränkung | 20-40 |
| mit erheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit der betroffenen Gliedmaße, je nach Ausmaß | 50-70 |
| bei Gebrauchsunfähigkeit der ganzen Gliedmaße | 80 |
Andere Krankheiten lassen sich überhaupt nicht einordnen, wie z. B.
Akute Leukämien
Im ersten Jahr nach Diagnosestellung (Erstdiagnose oder Rezidiv; insbesondere während der Induktionstherapie, Konsolidierungstherapie, Erhaltungstherapie) beträgt der GdS 100.
Nach dem ersten Jahr
• bei unvollständiger klinischer Remission: Der GdS beträgt weiterhin 100,
• bei kompletter klinischer Remission unabhängig von der durchgeführten Therapie: Der GdS beträgt 80 für die Dauer von drei Jahren (Heilungsbewährung).
Danach ist der GdS nach den verbliebenen Auswirkungen (insbesondere chronische Müdigkeit, Sterilität, Neuropathien, Beeinträchtigung der Entwicklung und kognitiver Funktionen) zu bewerten.
Multiple Sklerose
Der GdS richtet sich vor allem nach den zerebralen und spinalen Ausfallserscheinungen. Zusätzlich ist die aus dem klinischen Verlauf sich ergebende Krankheitsaktivität zu berücksichtigen (von 0-100 ist alles möglich).
Den Grad der Behinderung und damit auch die Schwerbehinderung stellt je nach Bundesland das örtlich für Dich zuständige Versorgungsamt, Amt für soziale Angelegenheiten, das Amt für Familie und Soziales oder das Amt für Versorgung fest. Welche Behörde für Dich zuständig ist, erfährst Du bei Deiner Gemeinde oder Stadtverwaltung.
Die Entscheidung des Versorgungsamtes beruht auf der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV).
Besprich am besten schon im Vorfeld des Verfahrens mit den behandelnden Ärzten oder Deinem Hausarzt, welche Funktionsbeeinträchtigungen Du geltend machen kannst und welche Unterlagen Du dafür benötigst.
Neben persönlichen Daten und Fragen zum Krankenversicherungsverhältnis musst Du alle Ärzte angeben, die Dich behandelt haben und/oder noch behandeln. Selbst Krankenhausaufenthalte sind aufzuführen. Hast Du aktuelle Unterlagen über Deinen Gesundheitszustand (z.B. Entlassungsberichte eines Krankenhauses oder Röntgenbilder), füge diese bei. Das beschleunigt das Verfahren.
• Der wichtigste Teil ist die Angabe zur körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung, die Du geltend machen willst. Du wirst danach gefragt, ob die Beeinträchtigung
• angeboren,
• durch einen Unfall oder
• durch eine Erkrankung entstanden ist.
Als Antragsteller bist Du zur Mitwirkung verpflichtet. Das heißt, Du musst alle Informationen liefern, die Dir bekannt sind, und Dich eventuell einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Kommst Du dem nicht nach, musst Du mit einer vollständigen oder teilweisen Ablehnung rechnen.
Im Normalfall stellt das Amt dann den Grad der Behinderung und die Merkzeichen fest (z.B. aG für außergewöhnlich gehbehindert oder Bl für blind). Der zuständige Bearbeiter prüft, ob alle erforderlichen Befunde eingegangen sind.
Die Unterlagen werden von sozialmedizinisch ausgebildeten Ärzten begutachtet. Die festgestellten Gesundheitsstörungen werden einzeln einem Einzelgrad der Behinderung zugeordnet. Anschließend wird daraus ein Gesamtgrad der Behinderung gebildet.
Danach werden die Unterlagen dem ärztlichen Dienst zugeleitet. Dieser entscheidet, ob eine Einstufung bereits anhand der vorliegenden Befunde möglich ist, oder ob Du darüber hinaus noch untersucht werden musst. Daraufhin folgt ein rechtsmittelfähiger Bescheid, auf den innerhalb eines Monats ab Bescheid-Eingang ein Widerspruch eingelegt werden kann.
Den Widerspruch kannst Du zunächst formal ohne Begründung beim Versorgungsamt abgeben. Wichtig ist, dass Du im Widerspruchsschreiben Akteneinsicht beantragst. So kannst Du den Widerspruch im nächsten Schritt gezielt begründen.
Schicke Deinen formalen Widerspruch möglichst zeitnah nach Empfang des Bescheides – also vor Ablauf der Monatsfrist – an das Versorgungsamt. Nach Eingang der geforderten Aktenkopien hast Du in der Regel vier Wochen Zeit, Deinen Widerspruch zu begründen.
Wird Deinem Widerspruch stattgegeben, nimmt das Versorgungsamt eine Neubewertung Deines Falles vor. Einigst Du Dich nicht mit dem Versorgungsamt, bleibt nur noch die Klage beim Sozialgericht. Die Klage musst Du innerhalb eines Monats nach Erhalt des Widerspruchsbescheids einreichen.
Personen mit einem GdB von mindestens 30
können auf Antrag schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden. Nach dem Gesetz soll eine Gleichstellung dann vorgenommen werden, wenn jemand aufgrund seiner Behinderung ohne die Gleichstellung keinen geeigneten Arbeitsplatz bekommen oder behalten kann. Es muss aber ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegen. Das heißt, auch Personen, bei denen nur ein Grad der Behinderung von 30 oder 40 festgestellt wurde, können so von einzelnen Vorteilen einer anerkannten Schwerbehinderung profitieren. Geregelt ist die Gleichstellung in § 2 Abs. 3 SGB IX i.V.m. § 68 Abs. 2 und 3 SGB IX.
Die Gleichstellung musst Du bei der für Dich zuständigen Agentur für Arbeit beantragen. Hierzu brauchst Du den Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes oder einen anderen Bescheid, aus dem hervorgeht, in welchem Maße Du in Deiner Erwerbsfähigkeit gemindert bist.
Gleichgestellte Menschen genießen den gleichen besonderen Kündigungsschutz wie schwerbehinderte Menschen. Auch der Arbeitgeber profitiert davon, denn Gleichgestellte werden bei der Schwerbehindertenquote mitgezählt.
Eine völlige Gleichstellung hat dies aber nicht zur Folge. So gibt es zum Beispiel keine unentgeltliche Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch keinen Anspruch auf Zusatzurlaub, wie ihn Schwerbehinderte haben.
Medikamente, Betreuung, erhöhter Wäschebedarf:
Menschen mit Behinderung haben im Alltag oft höhere Kosten als Menschen ohne Behinderung. Aus diesem Grund wurde der Behindertenpauschbetrag bei der Steuer eingeführt. Dieser Pauschbetrag soll Menschen mit Behinderung beim Steuern sparen helfen. Wie das funktioniert, erkläre ich im Folgenden.
Der Behinderten-Pauschbetrag, manchmal auch umgangssprachlich Behindertenfreibetrag genannt, deckt alle Kosten ab, die typisch für die Behinderung sind und die man regelmäßig hat. Dazu gehören zum Beispiel wie oben schon erwähnt Kosten für Arzneimittel oder für den erhöhten Wäschebedarf.
Einmalige oder besondere Aufwendungen beispielsweise für eine Kur, Krankheit oder eine Haushaltshilfe können zusätzlich zum Pauschbetrag als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Außergewöhnliche Belastungen kannst Du nur in Deiner Steuererklärung angeben, wenn die Kosten höher sind als die zumutbaren Belastungen.
Die Höhe des Behinderten-Pauschbetrags richtet sich nach dem GdB. Es gilt:
| Grad der Behinderung | Behinderten-Pauschbetrag pro Jahr |
| 25 und 30 | 310 Euro |
| 35 und 40 | 430 Euro |
| 45 und 50 | 570 Euro |
| 55 und 60 | 720 Euro |
| 65 und 70 | 890 Euro |
| 75 und 80 | 1.060 Euro |
| 85 und 90 | 1.230 Euro |
| 95 und 100 | 1.420 Euro |
Für Menschen mit einem GdB unter 50 gibt es allerdings eine Einschränkung. Sie bekommen den Behinderten-Pauschbetrag nur in der oben genannten Höhe, wenn eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist:
• Du hast aufgrund der Behinderung einen gesetzlichen Anspruch auf eine Rente, zum Beispiel eine Unfallrente, oder andere laufende Bezüge. Eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zählt nicht dazu.
• Die Behinderung hat zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt oder ist durch eine typische Berufskrankheit entstanden.
Hilflosen und blinden Menschen steht ein höherer Behinderten-Pauschbetrag von 3.700 Euro zu. Im Schwerbehindertenausweis müssen dafür die Merkmale "H" (hilflos) oder "Bl" (blind) eingetragen sein.
Liegt der GdB unter 25, steht Dir kein Behinderten-Pauschbetrag zu. In einem solchen Fall musst Du Deine Kosten als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung eintragen.
Damit Du den Behinderten-Pauschbetrag bekommst, musst Du im Hauptformular Deiner Steuererklärung auf Seite 3 unter den "außergewöhnlichen Belastungen" die Leerfelder ausfüllen. Die Überschriften der Leerfelder zeigen Dir, was Du eintragen sollst. Lege im ersten Jahr Deiner Behinderung eine Kopie des Schwerbehindertenausweises, der Bescheinigung des Versorgungsamts oder des Bescheids der Pflegekasse bei.
Sind Deine regelmäßigen, typischen Kosten höher als der Pauschbetrag, kannst Du sie einzeln als außergewöhnliche Belastungen absetzen. Entscheidest Du Dich für diese Lösung, musst Du alle Rechnungen sammeln und beim Finanzamt einreichen.
Beispiele solcher Aufwendungen sind etwa Umbaumaßnahmen, die in der Wohnung oder in einem Fahrzeug aufgrund der Behinderung entstehen, außerdem Aufwendungen für eine Reisebegleitung im Urlaub, Kosten eines Umzugs, Kosten hauswirtschaftlicher Dienstleistungen sowie Krankheits-, Heilbehandlungs- oder Kurkosten.
Sind Deine typischen Kosten niedriger als der Behindertenpauschbetrag, spielt das übrigens keine Rolle. Dir steht trotzdem der volle Betrag zu – ohne dass Du Nachweise wie Quittungen oder Rechnungen beim Finanzamt einreichen musst.
Auch ein Kind mit Behinderung hat einen Anspruch auf den Behinderten-Pauschbetrag. Nutzt es den Pauschbetrag nicht selbst und bekommst Du Kindergeld für das Kind, kannst Du den Pauschbetrag auch auf Dich übertragen lassen. Und das geht so: Fülle für Deine Steuererklärung in der "Anlage Kind" auf Seite 3 die entsprechenden Zeilen aus. Die Übertragung gilt nur für ein Jahr. Deshalb musst Du diese Angaben jedes Jahr in Deiner Steuererklärung machen.
Der Behinderten-Pauschbetrag gilt in der Regel immer für ein ganzes Jahr. Verändert sich der GdB im Laufe des Jahres, wird Dir immer der Pauschbetrag nach dem höchsten Grad gewährt, den der ärztliche Gutachter im Kalenderjahr festgestellt hat. Ein Beispiel: Werner hat einen GdB 50. Im Laufe des Jahres verbessert sich sein Gesundheitszustand, ein Gutachter stuft ihn herunter auf einen GdB 30. Trotzdem kann Werner in diesem Jahr mit den höheren 570 Euro für den GdB 50 rechnen.
Tritt die Behinderung erst im Dezember ein, steht Dir trotzdem der Pauschbetrag für das volle Jahr zu.
Seit 1975 hat das Finanzamt den Behinderten-Pauschbetrag nicht mehr erhöht. Und das ist auch verfassungskonform, entschied 2007 das Bundesverfassungsgericht. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass es sich beim Behinderten-Pauschbetrag „nur“ um eine Pauschale handele. Wer höhere Kosten habe, könne diese ja einzeln als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung eintragen.
Eine Behinderung oder Schwerbehinderung erschwert in vielen Bereichen das Leben. Je nach Grad der Behinderung hast Du weitere Ansprüche auf verschiedene Rechte und Vergünstigungen.