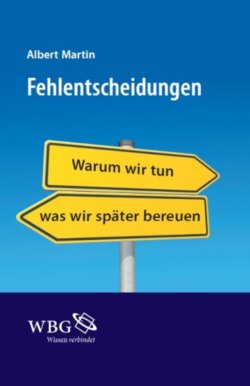Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.3 Erklärung
Оглавление(1) Die einfachste Erklärung für die Base Rate Fallacy verweist auf die eingeschränkte Fähigkeit des Menschen, statistische Zusammenhänge zu verstehen. Wie schwer der Umgang mit der Statistik ist, zeigt sich allein schon darin, dass man ihre Regeln erst mühsam lernen muss, dass viele Studierende in der Statistikklausur schlechte Noten schreiben und nicht selten auch durchfallen. Manche Forscher sehen im Base Rate Fehler daher einen Spezialfall der Schwierigkeiten im Umgang mit Formeln und Zahlen. Ob diese Erklärung hinreicht, kann man allerdings bezweifeln, das eigentliche Problem mit dem Base Rate Fehler scheint eher in der Schwierigkeit zu stecken, die Struktur des dahinterliegenden Problems zu durchschauen. Dafür spricht, dass viele Personen, ungeachtet ihrer durchaus vorhandenen statistischen Kenntnisse, Base Rates ignorieren. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass es generell nicht einfach ist, abstrakte Konzepte auf konkrete Situationen anzuwenden. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Bemühungen, didaktische Konzepte zu entwickeln, die helfen sollen, eben dies besser zu lernen (FONG/KRANTZ/NISBETT 1988; LARRICK/MORGAN/NISBETT 1990).
(2) Für Jonathan Baron liefern die angeführten Fähigkeitsargumente aber nur oberflächliche Erklärungen. Bedeutsamer erscheinen ihm ganz allgemeine Defekte im menschlichen Bemühen, mit Problemen zurechtzukommen. Bezeichnend dafür wäre die Neigung, sich nur unzureichend um die Gewinnung und Nutzung von Informationen zu kümmern. Außerdem lasse man es oft am Nachdruck bei der Suche nach alternativen Lösungsmöglichkeiten fehlen und man bevorzuge gern Lösungen, die auf Anhieb plausibel erscheinen (BARON 2000, S. 148).
(3) Eine attributionstheoretische Erklärung macht geltend, dass Menschen dazu neigen, die Verursachung von Ereignissen vor allem Personen und nicht etwa Situationen zuzuschreiben (diese Neigung wird häufig auch als „fundamentaler Attributionsfehler“ bezeichnet, Ross 1977). Base Rates sind nun geradezu ein Paradebeispiel für die situative Bedingtheit von Geschehnissen und werden daher bei der Ursachenattribution häufig vernachlässigt. Eine Stützung erhält die attributionstheoretische Erklärung durch Experimente, die zeigen, dass der Base Rate Fehler kleiner wird, wenn Base Rates als kausal bedeutsam wahrgenommen werden. Ob es zu dieser Wahrnehmung kommt, hängt nicht zuletzt vom Informationskontext und von der Darstellung des Problems ab (TVERSKY/KAHNEMAN 1980).
(4) Maya Bar-Hillel (1980) liefert zur Erklärung der Base Rate Fallacy eine Irrelevanz-Interpretation. Wenn zwei Aspekte gleichermaßen relevant erscheinen, werden beide bei der endgültigen Abschätzung der Wahrscheinlichkeit auch berücksichtigt. Wenn aber einem der Aspekte mehr Relevanz zugeschrieben wird, wird er die Urteilsfindung dominieren. Wird einer der beiden Aspekte gar als irrelevant eingestuft, dann wird er zur Diagnose auch nicht mehr herangezogen. Das psychologische Vorgehen gleiche – so Bar-Hillel – einem Gerichtsverfahren, in dem Einbringungen, die vom Richter als irrelevant zurückgewiesen werden, zur Urteilsfindung nicht herangezogen werden dürfen. Die Frage, die sich bei dieser Betrachtung sofort stellt, lautet natürlich, welche Merkmale einer Information deren Relevanzeinstufung bestimmen. Nach Bar-Hillel kommt hier vor allem der Spezifität eine zentrale Bedeutung zu: spezifische Informationen würden allgemeinen Informationen vorgezogen, was für viele Probleme auch vernünftig sei, aber eben nicht für die typischen Base Rate Probleme. Verantwortlich für die Base Rate Fallacy ist nach dieser Argumentation die unreflektierte Anwendung der Spezifitätsregel zur Abschätzung der Relevanz.
(5) Kahneman und Tversky erklären die Ergebnisse des Linda-Experiments mit dem Hinweis auf einen statistischen Beurteilungsfehler, die „conjunction fallacy“, d.h. den fehlerhaften Umgang mit logischen „Und“-Verknüpfungen (s.o.). Außerdem zeige sich in der falschen Aufgabenbearbeitung die Wirksamkeit der so genannten „Repräsentativitäts-Heuristik“. Als repräsentativ für ein „Modell“ (eine Personengruppe, bestimmte Ereignisklassen usw.) gilt ein Objekt dann, wenn es die wesentlichen Merkmale aufweist, die man auch dem Modell zuschreibt. So ist in unserer Wahrnehmung beispielsweise ein Rotkehlchen eher ein typischer Vogel als z.B. ein Pfau. Beim Lesen der charakteristischen Züge von Linda gewinnt man nun nicht den Eindruck, es handele sich bei ihr um eine „normale“ Bankangestellte, sondern eben um eine feministische Bankangestellte – eine Wahrnehmung, gegen die statistische Überlegungen kaum ankommen. Wahrscheinlichkeitsüberlegungen kosten einiges an Anstrengungen, die man auch deswegen scheut, weil ja eine naheliegende und scheinbar überzeugende Lösung angeboten wird. Sehr schön wird die Überzeugungskraft der Repräsentativitätsheuristik von Stephen J. Gould beschrieben: „Ich kenne [die richtige Antwort], aber ein kleiner Homunculus in meinem Kopf springt dennoch immer auf und ab und ruft: sie kann einfach keine Bankangestellte sein: lies die Beschreibung!“ (Gould 1991, S. 469). Die Repräsentativitätsüberlegung passt recht gut auf Probleme des Typs „Linda“, für Probleme vom Typ „Taxi“ scheint sie dagegen nicht geeignet (TVERSKY/KAHNEMAN 1982). Allenfalls könnte man argumentieren, dass auch hier der Einzelfall (die Beobachtung eines blauen oder grünen Taxis unter schlechten Lichtverhältnissen) als Repräsentant für die vielen richtigen Beobachtungen steht, die in einer vergleichbaren Situation gemacht wurden (der Beobachter führt zahlreiche Tests durch und hat eine Trefferquote von 80 %, s.o.).
(6) Auf einer eher grundsätzlichen Ebene gehen KAHNEMAN UND FREDERICK (2002) die Frage an, wie es möglich ist, dass eine Denkvereinfachungsregel wie die Repräsentativitätsheuristik das Denken in die Irre führen kann. Ihre Überlegungen lassen sich am besten anhand von Abbildung 1 verdeutlichen.
Abb. 1: Das Zwei-Stufen-Modell der Urteilsbildung
Danach finden Denk- und Urteilsprozesse in zwei voneinander getrennten Systemen statt. Im System 2 herrscht ein mehr oder weniger geordnetes Denken, das die verschiedenen Seiten und Dimensionen eines Problems umgreift und nach einer situationsgerechten und befriedigenden Lösung sucht. Entsprechend aufwändig sind die Denkprozesse, sie brauchen ihre Zeit und sind mitunter auch anstrengend, dafür sind sie flexibel und der kritischen Reflexion zugänglich. Die Prozesse im System 1 verlaufen dagegen schnell, reibungslos und quasi-automatisch, man kann sie allerdings kaum kontrollieren und sie sind dem Lernen nur schwer zugänglich. Das System 2 zeichnet sich durch tendenziell diskursives, das System 1 durch intuitives Denken aus. Intuitives Denken gleicht, was die gedanklichen Prozesse angeht, der Wahrnehmung, inhaltlich gibt es jedoch einen deutlichen Unterschied: Die gedanklichen Vorgänge befassen sich beim intuitiven Denken nicht mit Wahrnehmungsinhalten, sondern mit kognitiven Einheiten, mit Denkkonstrukten und Denkkategorien, die denen im System 2 entsprechen. Aus diesem Grund ist das System 2 auch in der Lage, diese aufzunehmen, zu bearbeiten und zu kanalisieren. Es gibt keine kognitiven Problemlösungen und Entscheidungen, die am System 2 vorbei laufen könnten. Allerdings übt das System 2 seine Kontrollfunktion oft eher „lax“ aus, sodass es nicht selten vorkommt, dass die im System 1 lokalisierten Denkvereinfachungsregeln die Urteils- und Entscheidungsfindung bestimmen.
Intuitive Gedanken sind dadurch bestimmt, dass sie einem – wie Wahrnehmungsinhalte – spontan in den Sinn kommen, woraus sich die Frage ergibt, was dafür verantwortlich ist, dass manche Gedanken sehr einfach, andere dagegen wesentlich schwerer Zugang zum Bewusstsein finden. Die „Zugänglichkeit“ von Informationen wird – so Kahneman und Frederick – vor allem von drei Determinanten bestimmt: der Sichtbarkeit („salience“) von Situationsmerkmalen, der selektiven Aufmerksamkeit und der Reaktionsbereitschaft. Angewandt auf die hier behandelte Frage heißt das: Die Repräsentativitätsheuristik gewinnt immer dann eine bestimmende Kraft, wenn die Aufgabenstellung den Blick auf das „Typische“ einer Situation oder Person lenkt, wenn man auf diese Betrachtung z.B. durch entsprechende Instruktionen eingestimmt wurde und wenn keine deutlichen Hinweise dafür vorliegen, dass man die Situation auch aus einer anderen Perspektive betrachten könnte.
(7) Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, dass jemand ganz bewusst die Base Rates ignoriert, die gegen seine Überzeugungen stehen. Das Eingangszitat des Aleksej Iwanowitsch (der Hauptfigur im Roman „Der Spieler“ von Dostojewski) wäre ein Beispielfall. Man kann natürlich bezweifeln, ob hier tatsächlich ein Base-Rate-„Fehlschluss“ vorliegt. Schließlich werden die „Base Rates“ ja anerkannt und lediglich nicht beachtet. Aber vielleicht liegt auch gar keine Ignoranz, sondern lediglich eine extreme Risikoneigung vor. Diesem Argument lässt sich allerdings entgegenhalten, dass die geäußerte Überzeugung nicht sonderlich ernst gemeint sein kann. Angesichts der gegen ihn stehenden Spielchancen, die ihn zwangsläufig in den Ruin treiben müssen, hat Iwanowitsch wohl doch nicht richtig verstanden, was auf dem Spiel steht – und insoweit die Bedeutung der „Base Rates“ maßlos unterschätzt. Möglicherweise haben wir es aber auch einfach mit der Spielsucht und damit mit einer Krankheit zu tun.