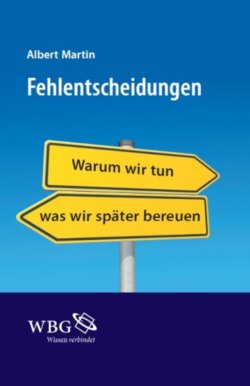Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Auswahl der Defekte
ОглавлениеIm vorliegenden Buch werden 10 + 5 Entscheidungsdefekte ausführlich dargestellt. Zehn dieser Defekte werden in der vorliegenden Druckausgabe behandelt, fünf weitere (das St.-Petersburg-Paradox, das Eskalierende Commitment, Selbstwertdienliche Attributionen, Framing-Effekte und das Gruppendenken) in einer Online-Version, die über die Internetseiten der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft zugänglich sind: unter www.wbg-wissenverbindet.de, hier im Bereich Service ↗ Downloads. Außerdem findet sich auf der genannten Internetseite der WBG eine Übersicht von 250 weiteren Entscheidungsdefekten. Die getroffene Auswahl ist zwangsläufig selektiv und stark von den Vorlieben des Autors geprägt. Wenn man erst einmal damit begonnen hat, die Probleme zu sammeln, die Menschen mit ihren Entscheidungen haben, findet man kein Ende und man sieht sich zwangsläufig mit der Frage konfrontiert, welche Probleme eine intensivere Betrachtung verdienen und wo man Schwerpunkte setzen soll. Am überzeugendsten wäre es wohl, die Defekte, die eine gewisse konzeptionelle Kohärenz aufweisen, jeweils zu thematischen Clustern zusammenzufassen, genau zu klären, in welcher Weise sie zusammenhängen und zu ermitteln, welche theoretischen Schlussfolgerungen sich aus der Analyse dieser Zusammenhänge ergeben. In der Literatur gibt es Bemühungen, in dieser Richtung voranzugehen, insbesondere den Versuch, Verwandtschaften von Entscheidungsdefekten zu ergründen und sie möglichst auf gemeinsame Bestimmungsgründe zurückzuführen. Die hierzu angestellten Überlegungen betreffen aber immer nur wenige Defekte und die herausgearbeiteten begrifflichen und theoretischen Bezugspunkte finden im Übrigen bislang auch keine ungeteilte Zustimmung. Ein weiterer möglicher Systematisierungsansatz orientiert sich an den Phasen eines Entscheidungsprozesses, was aber auch nur bedingt weiterhilft, weil sich die Teilaktivitäten im Entscheidungshandeln weder inhaltlich und schon gar nicht zeitlich säuberlich voneinander trennen lassen. Man kann Entscheidungsdefekte außerdem nach ihrer theoretischen Verankerung anordnen, nach dem Grad der Aufmerksamkeit, den man ihnen in der Fachöffentlichkeit schenkt, oder auch einfach nach den Wissenschaftszweigen, die sich mit ihnen beschäftigen. Gegen entsprechende Klassifizierungsversuche ist nichts einzuwenden. Aber der hiermit erzielbare Erkenntnisgewinn ist nicht sonderlich groß.
Bei der für dieses Buch schließlich getroffenen Auswahl kam es mir vor allem darauf an, zumindest in gewissem Umfang der Vielschichtigkeit des Entscheidungsgeschehens gerecht zu werden und unterschiedliche theoretische Perspektiven zur Geltung zu bringen. Die so genannte verhaltensorientierte Entscheidungsforschung beispielsweise befasst sich vor allem mit Prozessen der Präferenzbildung, mit Risikoerwägungen und mit der Frage, wie Menschen mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Dabei rekurriert sie wie selbstverständlich auf die Konstrukte, die in der Normativen Entscheidungstheorie ganz im Zentrum stehen. Sie stehen auch in den ersten Kapiteln dieses Buches im Vordergrund, in denen es um den oft fehlerbehafteten Umgang mit Wahrscheinlichkeiten geht und um den Irrtum, dass bei einer Entscheidung immer zu beachten sei, wie viel man bereits in die Entscheidungsfindung investiert habe. Auf ein Problem, das in der Geschichte der Entscheidungstheorie eine große Bedeutung gewonnen hat, geht das Kapitel zum „St. Petersburg Paradox“ ein, das als Online-Beitrag zu finden ist. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit Defekten bei der Wahrnehmung und beim Denken, also mit Vorgängen, die eher Themen der Denkpsychologie als der Entscheidungstheorie sind. Gleichwohl lassen sich hier, wie auch bei allen anderen Entscheidungsdefekten, keine eindeutigen Disziplinen-Zuweisungen vornehmen, für jeden Entscheidungsdefekt lassen sich Erklärungen aus sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen finden. Die nächsten Kapitel beschäftigen sich mit der Motivationsseite, also mit der Frage, was unser Handeln antreibt. Die menschlichen Bestrebungen leiten sich, anders als dies manchmal suggeriert wird, nicht aus einem obersten Motiv in logisch und kausal eindeutiger Weise ab, sie lassen sich oft nicht einmal klar umreißen und sind auch nicht sonderlich stabil und bisweilen schlichtweg bizarr und irrational, woraus sich naturgemäß zahlreiche Probleme für eine kohärente Entscheidungsfindung ergeben. Ein sehr grundsätzliches Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „Egoismus“, also mit der Frage, warum egoistische Haltungen zu schlechten Entscheidungen führen, was sich auf den ersten Blick etwas paradox anhört, weil die Entscheidungstheorie ja schlichtweg davon ausgeht, dass Menschen egoistisch sind. Eine weitere Themengruppe befasst sich mit dem Selbstverständnis von „Entscheidern“. Anders als in der klassischen Entscheidungstheorie behauptet, geht es im menschlichen Handeln aber nicht allein um Zwecke, manches macht man nur deswegen, weil alles andere nicht zu einem passen würde und weil das Bild, das man von sich hat, durch ein anderes Verhalten getrübt würde. Auch das eigene Denken wird davon geprägt, wie man sich selbst sieht, manche betrübliche Einsicht erspart man sich lieber, damit man weiter gut mit sich leben kann. Schließlich werden noch zwei Defekte behandelt, die sich aus der sozialen Verfasstheit menschlichen Handelns ergeben und die zeigen, dass Menschen keine isolierten Entscheidungseinheiten sind, die alles um sich herum nur als „Umwelt“ begreifen.
Meine Darstellung der 15 Entscheidungsdefekte erhebt keinen Anspruch auf eine wie immer geartete Repräsentativität. Sie soll zwar einen gewissen Eindruck von der Breite der Fragestellungen liefern, die mit der Entscheidungsfindung verbunden sind, vor allem aber will ich auf einige grundlegende Mechanismen aufmerksam machen, die das menschliche Handeln bestimmen. Die im Onlinekapitel aufgeführten 250 weiteren Defekte verdeutlichen die Breite des Themenspektrums fehlerbehafteter Entscheidungen, es handelt sich dabei aber um keine erschöpfende Auflistung, und sie ist auch nicht unvoreingenommen. Die meisten der angeführten Defekte entstammen der verhaltensorientierten Entscheidungsforschung, der sozialkognitiven und sozialpsychologischen Literatur. Angeführt sind auch einige Abwehrmechanismen aus der tiefenpsychologischen Forschung, die ja nachgerade eine Defizitliteratur ist. Aufgelistet sind auch logische Fehler und Fallen, die sich mit erkenntnistheoretischen Irrtümern und Denkfehlern verknüpfen, und die schon allein deshalb eine genauere Betrachtung verdient hätten, weil sie vielfach mit den Defekten des Alltagsdenkens korrespondieren. Zum großen Teil ausgespart sind die vielfältigen Probleme, die sich bei der wissenschaftlichen Datenerhebung und beim Umgang mit statistischen Verfahren der Datenauswertung ergeben. Nur am Rande angeführt sind Beispiele aus der Kommunikationsforschung, weil diese sich häufig mit eher modischen und wenig tiefgreifenden Themen befasst. Außerdem wird die Literatur zur Spieltheorie wenig berücksichtigt, diese thematisiert vor allem „logisch-strategische“ Aspekte, die wenig Aufschluss über das reale Entscheidungshandeln geben. Eine ausführliche Behandlung verdiente der Umgang mit sozialen Dilemmata, weil sich diese aber weniger auf das individuelle als vielmehr auf das kollektive Entscheiden beziehen, gehe ich hierauf nur vereinzelt ein.