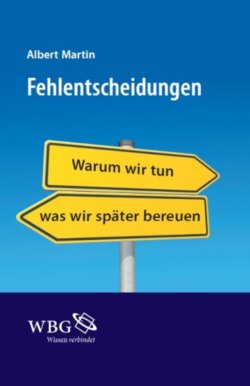Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.5 Studie
ОглавлениеEs gibt zahlreiche empirische Studien über das Sunk-Cost-Denken. Die meisten dieser Studien sind Laborexperimente mit Studierenden, relativ häufig sind die Versuchsteilnehmer aber auch Fach- und Führungskräfte (ARKES/BLUMER 1985; GARLAND 1990; CONLON/GARLAND 1993; SCHAUB 1997; KEIL U.A. 2000). Das typische Design dieser Studien sieht eine Schilderung von Entscheidungsszenarien vor, in denen verschiedene Einflussfaktoren variiert werden. Diesem Schema folgt auch die Studie von ELMER THAMES (1996). Die Aufgabe, die den Teilnehmern gestellt wurde, lautete:
„Stellen Sie sich vor, dass Sie vor zwei Wochen eine Konzertkarte zum Preis von $ 20 gekauft haben. Sie haben sich sehr darum bemüht, an eine Karte zu kommen.“
Die weitere Situationsbeschreibung wurde variiert. Die eine Hälfte der 160 Versuchsteilnehmer erhielt die folgende Fallschilderung:
„Eine Stunde vor Konzertbeginn fällt Ihnen ein, dass Sie das Auto Ihrer Freundin für diesen Abend nicht ausleihen können. Als einzige Möglichkeit, zum Konzert zu kommen, bleibt Ihnen, ein Taxi zu nehmen. Für die Hin- und Rückfahrt kostet das $ __. Es ist zu spät, die Eintrittskarte zurückzugeben oder zu verkaufen.“
Für die andere Hälfte der Versuchsteilnehmer wurde der Fall wie folgt beschrieben:
„Am Vortag des Konzerts stellen Sie fest, dass Sie die Eintrittskarte verloren haben. Später am Tag treffen Sie jemanden, der Ihnen eine Eintrittskarte um $ __ verkaufen würde.“
Diese beiden Bedingungen dienen dazu, den Effekt der „mentalen Buchführung“ (s.o.) zu überprüfen. Im ersten Fall ist zu vermuten, dass die Teilnehmer die zusätzlichen Taxikosten zwar bedauern, aber auf sich nehmen werden, weil der Kauf der Eintrittskarte ja sonst verschwendet wäre. Im zweiten Fall wäre dagegen ein neuer Anlauf notwendig: Bliebe man bei seiner Absicht, dann hätte man die Eintrittskarte ja zweimal gekauft, und es ist sehr die Frage, ob man dazu bereit ist. Rein logisch gesehen entstehen in beiden Fällen dieselben „Zusatzkosten“, entscheidend ist aber nicht die Logik, sondern die Art und Weise, wie die Kosten psychologisch verrechnet werden. Variiert wird in dem skizzierten Experiment nicht nur die mentale Buchführung, sondern auch der Zusatzbetrag, der aufzuwenden wäre, falls man am Konzertbesuch festhalten will: das Taxi (bzw. in gleicher Höhe die neue Karte) kostet jeweils entweder $ 30, $ 40 oder $ 50. Es liegen also 3 × 2 = 6 Versuchsbedingungen vor.
Die Ergebnisse bestätigten die theoretischen Voraussagen. Im Taxi-Fall entscheiden sich deutlich mehr Personen dafür, die Zusatzkosten zu tragen und ins Konzert zu gehen (95 %) als in dem Fall, in dem die Eintrittskarte verloren gegangen war (71 %). Der Neukauf der Karte wird demselben mentalen Konto zugeschlagen, die Taxikosten werden dagegen auf einem anderen mentalen Konto verbucht. Bemerkenswert ist außerdem ein Interaktionseffekt, der sich bei der Analyse der Daten herausstellte. In dem Fall, in dem die zusätzlichen Kosten lediglich $ 10 betrugen, gab es praktisch keinen Unterschied zwischen den beiden Experimentalbedingungen, fast alle Teilnehmer waren bereit, die zusätzliche Ausgabe zu tätigen. Das änderte sich mit zunehmender Kostenhöhe. Waren $ 20 aufzubringen, so mieteten zwar immer noch alle das Taxi, aber nur noch zwei Drittel kauften eine neue Eintrittskarte. Und bei $ 30 Zusatzkosten wollten immer noch 85 % das Taxi nehmen, eine neue Karte wollten allerdings nur noch 48 % der Versuchsteilnehmer kaufen. Anders ausgedrückt: Je höher die Zusatzkosten, desto stärker ist der Sunk-Cost-Effekt.