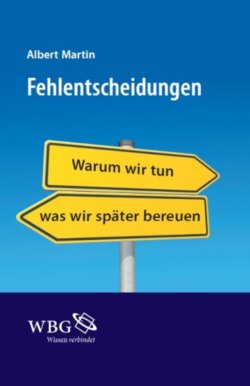Читать книгу Fehlentscheidungen - Albert Martin - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.3 Erklärung
Оглавление(1) Man kann das Sunk-Cost-Denken – wie ja schon die Bezeichnung nahelegt – kostentheoretisch erklären. THALER (1980) erläutert dies an folgendem Beispiel: Eine Familie hat $ 40 für die Eintrittskarten zu einem Basketball-Spiel bezahlt, das in einer 60 Meilen entfernten Stadt ausgetragen wird. Am Tag des Spiels gibt es einen Schneesturm. Die Familie entscheidet sich dennoch zu fahren, wobei sich die Familienmitglieder darüber einig sind, dass sie das nicht tun würden, wenn sie die Karten geschenkt bekommen hätten. Der Kartenpreis gilt den Handelnden als angemessen, sie kaufen sich sozusagen den Genuss, dem Spiel beiwohnen zu können. Fahren sie nun nicht, dann kommt es entsprechend zu einem Verlust von $ 40. In dem Schneesturm-Beispiel würde die Familie nicht fahren, wenn sie die Karten geschenkt bekommen hätte, die (psychischen) Kosten, die ihr durch die Mühsal entstünden, sich durch den Schnee zu kämpfen, sind zu hoch, sie würden durch den Genuss, den der Spielbesuch bereitet, nicht ausgeglichen. Wenn man fährt, erreicht der Nettonutzen (Nutzen des Spielbesuchs minus Wegekosten) keinen positiven Wert und bleibt man zuhause, dann ist der Nettonutzen gleich Null (kein Spiel, kein Weg). Anders stellt sich die Situation dar, wenn man für die Karten bezahlt hat und zuhause bleibt. Dann sinkt der Nettonutzen deutlich in den negativen Bereich (kein Spiel, kein Weg, aber ein hoher entrichteter Preis). In diesem Fall steigt die Neigung, zu fahren, weil man damit ja den entstandenen negativen Nutzen durch den positiven Besuchsnutzen ausgleichen kann. Zwar entstehen in diesem Fall Wegekosten und man bleibt deswegen – in der Summe – im negativen Nutzenbereich (Nutzen des Spielbesuchs minus negativer Preisnutzen minus Wegekosten), solange dieser aber nicht die Höhe des negativen Preisnutzens erreicht, wird man sich zur Fahrt entschließen.
(2) Eine Ergänzung erhält die angeführte Erklärung durch die Prospect Theorie (vgl. den Online-Beitrag zu Framing-Effekten auf www.wbg-wissenverbindet.de). Interessant ist für den vorliegenden Fall nur der Verlustbereich. Hier kommt es gemäß der Prospect-Theorie zu einem konvexen Nutzenverlauf, das heißt mit zunehmendem Verlust wächst der negative Nutzen überproportional. Dabei ist zu beachten, dass ein Verlust von $ 40 nominal zwar doppelt so hoch ist wie ein Verlust von $ 20, wegen des konvexen Nutzenverlaufs, ist der „gefühlte“ negative Nutzen eines Verlusts von $ 40 allerdings deutlich größer, also mehr als doppelt so hoch. Mit zunehmendem Abstand des negativen Preisnutzens von den Wegekosten steigt – wegen der unterstellten Konvexität des negativen Nutzenverlaufs – die Neigung zu fahren, überproportional an.
(3) Die beiden vorangegangenen Erklärungen setzen eine bestimmte Art des Umgangs mit Kosten und Nutzen, also eine bestimmte Art und Weise der „mentalen Buchführung“ voraus. So wird unterstellt, dass es sinnvoll ist, den Kaufpreis, der ja bereits vor einiger Zeit entrichtet wurde, mit dem aktuellen (fehlenden) Nutzengewinn ohne weiteres aufzurechnen. Zum Zeitpunkt des Kartenkaufs wird gewissermaßen ein mentales Konto eröffnet. Der Kartenkauf bringt keinen unmittelbaren Gewinn (es sei denn, man berücksichtigt Dinge wie Besitzerstolz, Vorfreude usw.), dieser entsteht erst bei der Einlösung der Karten am Spieltag. Dann kann das Konto wieder „geschlossen“ werden. Bis dahin ist die Kontobilanz negativ (minus $ 40). Welche Bedeutung hat nun der Schneesturm? Nun: man kann das Konto abschließen. In diesem Fall verwandelt sich die Ausgabe in einen endgültigen Verlust. Das fällt normalerweise leicht und geschieht eigentlich (weil häufig) routinemäßig. Ist der Verlust jedoch hoch oder ist die Situation aus sonst einem Grund besonders auffällig, dann tut man sich dagegen schwer. Das ist bei einem Spiel, auf das man sich lange gefreut hat, sicher der Fall. Entsprechend strebt man danach, den Gefährdungen des Sturms zum Trotz einen Ausgleich des Kontos herbeizuführen. Dies ist aber nur möglich, indem man sich auf den Weg macht. Der Ausgleich gelingt vor allem auch dadurch, dass man die Reisebeschwernisse nicht in die Kontierung einbezieht. Da es sich bei ihnen um keine monetären Kosten handelt, werden sie in einer anderen Kontenklasse verbucht und mit dem ursprünglichen „Geschäftsvorfall“ gar nicht in Verbindung gebracht (HEATH 1995).
Dass auch fälschlich im Bewusstsein gehaltene (also eigentlich „versunkene“) Kosten ihre Verfallzeit haben, dass sie gewissermaßen einer mentalen Kostenrechnung unterliegen, zeigt das folgende Beispiel (THALER 1999): Man hat sich aus dem Urlaub schöne und teure Schuhe mitgebracht. Nun stellt sich heraus, dass sie nicht recht passen, sondern sehr drücken. Davon muss man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, es ist jedenfalls vernünftig sie noch oft anzuziehen um zu sehen, ob sie sich nicht „einlaufen lassen“. Wenn dies nicht fruchtet, sollte man die Schuhe allerdings abschreiben. Tatsächlich wirft man die Schuhe aber normalerweise nicht einfach weg, sondern stellt sie in seinen Schrank, wo sie lange liegen bleiben. Solange die Schuhe noch im Schrank sind, kann man sich der Illusion hingeben, das viele Geld nicht verschwendet zu haben. Oft nach langer Zeit, wird man sie bei irgendeiner Gelegenheit dann doch wegwerfen, ohne dass einen ein allzu großer Schmerz über den Verlust befällt.
(4) Viele psychologische Erklärungen des Sunk-Cost-Denkens stützen sich auf die Überlegung, dass es schwer fällt, Misserfolge anzuerkennen. Gibt man zu, dass man, etwas salopp ausgedrückt, Kosten „versenkt“ hat, dann gesteht man ein, dass etwas schief gelaufen ist, dass ein Projekt gescheitert ist. Das ist mit dem Selbstverständnis nicht immer so ohne weiteres vereinbar. Man betreibt das Projekt also weiter, obwohl es besser wäre, sein Geld und seine Kraft anderen Projekten zuzuwenden.
Einen etwas anderen Akzent setzt das Streben nach Kohärenz. Wenn man ein „missratenes“ Projekt gänzlich neu angehen muss oder wenn man sich einem neuen Projekt zuwenden will, dann verlangt das oft einen Abschied von bisherigen Verhaltensmustern und -gewohnheiten und damit Veränderungen, die einem sehr schwer fallen können. Neben der Weigerung, sich einen neuen Verhaltensstil anzugewöhnen, können auch inhaltliche Gründe die Fortführung wenig effizienter Projekte motivieren, denn schließlich fühlt man sich manchmal einem Projekt innig verbunden und wenn man etwas zu seiner Herzenssache gemacht hat, wird man diese selbst dann nicht aufgeben, wenn sie sich auf ein bitteres Ende hin bewegt.
(5) Unter Umständen resultiert die Verpflichtung, ein unergiebiges Projekt zu Ende zu führen, aber gar nicht aus dem eigenen Selbstverständnis, sondern aus den Erwartungen Dritter. Es gibt also auch soziale Gründe für Sunk-Cost-Verhalten. Ein Commitment gegenüber Dritten kann sogar wirkungsvoller sein als die Verankerung des Verhaltens in eigene Überzeugungen. Insbesondere dann, wenn man soziale Sanktionen zu befürchten hat, wie beispielsweise die Abwahl von einem Amt oder Einbußen in der Reputation. Außerdem macht es sich schlecht, wenn man sich vom Befürworter zum Gegner eines Projekts entwickelt, insbesondere dann, wenn die Bezugsgruppe, der man sich verbunden fühlt, diesen Schwenk (noch) nicht mitgemacht hat. Man kann aber auch aus ethischen Gründen einem Projekt treu bleiben, zum Beispiel weil man die Moral seiner Gefolgsleute nicht untergraben will oder weil einem ein gegebenes Versprechen wichtiger ist als der effiziente Mitteleinsatz.
(6) Erwähnung verdient schließlich noch die dissonanztheoretische Erklärung des Sunk-Cost-Denkens. Kognitive Dissonanz entsteht aus Informationen, Einstellungen und Verhaltensweisen, die miteinander unverträglich sind. Wie ist das in dem obigen Beispiel des verhinderten Spielbesuchs? Man hat für etwas bezahlt (die Eintrittskarten), für das die Gegenleistung (der Besuch des Basketball-Spiels) aussteht. Führt dieser Tatbestand zu kognitiven Dissonanzen? Und würde der Entschluss, sich durch den Schneesturm zu wagen, die Dissonanz reduzieren? Das ist höchst unplausibel. Dass für eine Leistung die Gegenleistung aussteht, dürfte keine Unordnung im Kopf hervorrufen, so etwas gehört zur alltäglichen Erfahrung und gibt keinen Anlass für mentale Beunruhigung. Etwas näher kommt die Analyse dieses Falls durch ARKES und BLUMER. Danach könnten Dissonanzen entstehen, wenn man sich dazu entschließt, auf die Fahrt zum Basketball-Spiel zu verzichten und man sich dabei vergegenwärtigt, was einem damit entgeht. Die Antizipation des Bedauerns könnte einen daher dazu veranlassen, sich dann doch, gewissermaßen zur „Dissonanzvermeidung“, auf den Weg zu machen (ARKES/BLUMER 1985, S. 137). Aber auch diese Argumentation überzeugt nur bedingt, denn schließlich hat man einen guten Grund dafür, nicht zu fahren. Das antizipierte Bedauern kann zwar den Wunsch stimulieren, dem Sturm zu trotzen – das Gefühl des Bedauerns ist aber nicht dasselbe wie das Empfinden kognitiver Dissonanz. Dissonanz entsteht erst, wenn man an dem Geschehen selbst einen Anteil hat, wenn man also beispielsweise nicht führe, obwohl sich „ein wackerer Mensch“ von dem „bisschen Wetter“ nicht beeindrucken ließe. Die Theorie der kognitiven Dissonanz liefert also am ehesten dort wertvolle Erklärungsbeiträge, wo das Sunk-Cost-Verhalten mit der Beurteilung des eigenen Verhaltens verknüpft ist oder wo es zu Widersprüchen mit tief verankerten Einstellungen kommt, also zum Beispiel dann, wenn es das Weiterführen von persönlich verantworteten Projekten geht.
Betrachtet man die angeführten Erklärungsansätze, dann zeigt sich die oben angemahnte Trennung zwischen der Verhaltens- und der denkbezogenen Sunk-Cost-Problematik in einem neuen Licht. Denken und Handeln lassen sich nämlich nicht säuberlich voneinander trennen. Falsches Sunk-Cost-Denken ist einem Menschen nicht „eingebrannt“. Es kristallisiert sich im Zuge des Denkhandelns manchmal heraus, um sich im Zuge anderer Bewusstseinsströme wieder aufzulösen. Bei dem Bestreben, Dissonanzen zu vermeiden und zu bewältigen, bei der Bemühung, sozialen Anforderungen nachzukommen sowie bei der Rechtfertigung der eigenen Projekte vor sich selbst, werden mitunter verfehlte Sunk-Cost-Argumente herangezogen, die man an anderer Stelle irritiert beiseiteschiebt. Solange man noch einem (eigentlich „überholten“) Ziel nachjagt, ist es schlicht vernünftig, versunkene Kosten auferstehen zu lassen. Wenn man sich einem Projekt nicht mehr widmen kann, wird man die entstandenen Kosten begraben.
Die Unschärfe von versunkenen Kosten entsteht auch daraus, dass oft strittig ist, wann man sich von einem Projekt wirklich verabschieden sollte und aus der Unbestimmtheit darüber, ob die getätigten und nun scheinbar nutzlosen Investitionen nicht auch anderen, alternativen Zwecken zugeführt werden können. Die damit gegebenen Deutungsspielräume können einen zwar verunsichern, sie können aber auch genutzt werden, um angesichts von Fehlentscheidungen sein psychologisches Gleichgewicht wiederzuerlangen.