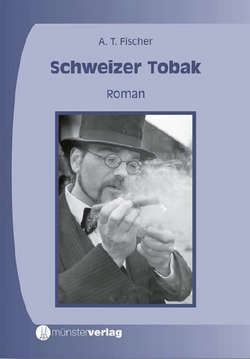Читать книгу Schweizer Tobak - Albert T. Fischer - Страница 10
Maria und Lorenz
ОглавлениеDer Entlebucher Lorenz kam 1933 nach seiner Rekrutenschule auf den Stadelhof. Nur Melchior, der Gemeindeschreiber, der Ammann und der Armen- und Waisenvogt kannten seine Herkunft. Als Sohn einer Serviererin und eines durchziehenden Wandergesellen, der, als die Schwangerschaft der bedauernswerten Magd klar wurde, nicht mehr zu finden war, verbrachte seine ersten Jahre mit seiner Mutter im Wirtshaus und kam danach als Verdingbub zu einem Bauern, einem entfernten Verwandten seiner Mutter und wurde so in einer sehr harten Jugend mit Prügeln, Hunger, Lieblosigkeit und Einsamkeit ein Melker und Knecht. Melchior übernahm ihn als Knecht, weil er sich an seine eigene ärmliche Geschichte erinnerte und dem jungen Mann eine Chance geben wollte.
Seinen Werdegang sah man Lorenz nicht an. Er besass einen einwandfreien Sonntagsanzug, zwei schöne Hemden, einen Hut und gutes Schuhwerk. So ging er jeden Sonntag zur Messe, trank danach im Kreuz ein Bier, gönnte sich eine einfache Zigarre, setzte sich dabei allerdings nicht zu den besitzenden Bauern und führte auch keine grossen Reden. Er benahm sich so, wie die wichtigen Leute im Dorf dies von ihm erwarteten – anständig und bescheiden.
So wirkte er auch auf Mädchen, genauer auf die nicht gerade wohlhabenden, aber durchaus anständigen ledigen jungen Frauen im Dorf, als ansehnliche Erscheinung, mit der man sich zeigen durfte. Nach und nach lernte er sie auch kennen. Die meisten von ihnen arbeiteten bei Brand-Cigars und viele sah er auch am Sonntag in der Kirche.
Als Lorenz sich beim Kirchenchor meldete, um der einen oder anderen der jungen Frauen etwas näher zu kommen, mischte sich Melchior nicht ein, obwohl ihm die Sache nicht wirklich passte. Aber er erinnerte sich an seine eigene Zeit als Jungmann. Der Lorenz hatte eine recht gute Stimme und der Dorflehrer, gleichzeitig Chorleiter und Organist, sah in ihm einen zwar völlig ungebildeten, aber brauchbaren Bariton. Einmal die Woche musste er am Abend zur Probe gehen und jeden Sonntag sang er um neun Uhr zum Hochamt. Gegen Jahresende gab der Chor ein kleines Konzert im Kreuzsaal mit einem anschliessenden Theaterstück und danach war die Bühne frei zum Tanzen. Der Chor wurde für Lorenz zu einer Gelegenheit, mit Maria Körber bekannt und im Lauf der Wochen und Monate ein wenig vertraut zu werden. Als Kind lebte sie zusammen mit ihrer Mutter, einer Wasch- und Putzfrau, und einer jüngeren Schwester in Wirrwil.
Als Kindermädchen bei den jungen Brands, zurück aus der Grossstadt München, die sie nie mochte, verfügte sie zwar über sehr wenig Freizeit, aber die reformierten Brands liessen die katholische Maria selbstverständlich in den Kirchenchor gehen, schärften ihr jedoch ein, sich von Männern fernzuhalten. Bis zu dem Tanzabend im November hatten sie denn auch keine Ahnung, was da lief, denn die Geschichte der beiden war bisher mehr als harmlos gewesen.
Das änderte sich an jenem Abend. Bis in den frühen Morgen, bis Lorenz zurück zu seiner Arbeit gehen musste, blieben sie zusammen, erzählten sich ihr bisheriges Leben und fanden heraus, dass sie beide einsam waren und sich gegenseitig hilfreich sein könnten. Maria hatte sich verliebt und war nicht mehr zu bremsen.
Nur wenige Wochen später war Maria schwanger und damit gab es kein Zurück. In der Fastenzeit konnten die beiden nicht getraut werden, da war der Dorfpfarrer strikt dagegen und als Ostern vorbei war, konnte, wer wollte, schon sehen, wie dringlich die Hochzeit für die beiden geworden war und es gab, auch für jedermann sichtbar, kein weisses Kleid, keinen Kranz und keinen Schleier. Dummes Geschwätz und Gespött gingen durchs Dorf und meistens auf Kosten der werdenden Mutter. Beides erreichte auch den Kirchenchor. Maria wurde von den übrigen Frauen systematisch geschnitten und die Männer verzogen ihre Gesichter in verächtliches Lächeln oder machten gar doppelbödige Bemerkungen. Bei einer Probe verliess Maria weinend das Lokal im Schulhaus und trat aus dem Chor aus. Lorenz zog mit. Dafür war sie ihm dankbar.
Sie fanden im Haus beim Stocker, einem alten Kleinbauern mit zwei Kühen, dem seine Schwester den Haushalt führte, weil seine Frau ein paar Jahre zuvor gestorben war, zwei kleine Zimmer unter dem Dach. So konnte Lorenz seine Arbeit bei Melchior behalten. Maria, die ihre Stelle als Kindermädchen hatte aufgeben müssen, arbeitete jetzt bei den Brand-Cigars in Packerei und Spedition.
Ende September kam Erwin zur Welt und ein Jahr danach Theo, der eigentlich Theodor hiess.
Es wurde eng beim Stocker, aber auch schwierig, ein anderes Dach über dem Kopf zu finden, das die beiden bezahlen und bei dem sie gleichzeitig ihre Stellen behalten konnten. Das Zuwarten lohnte sich. Der Stocker starb und seine Schwester, einzige Erbin, verkaufte Haus und Land an Mama Brand. So konnten die Grampers in die weit grössere Wohnung im gleichen Haus ziehen.
Maria hatte inzwischen auch ihre Fabrikarbeit aufgeben müssen. Sie machte jetzt Heimarbeit. Woche für Woche holte der Lorenz mit Melchiors kleinem Leiterwagen Tabakblätter zum Ausrippen im Nachbardorf bei der Tabak AG. Brand-Cigars setzte zum Ausrippen längst auch Maschinen ein. In der Tabaki, wie viele Leute die Firma auch nannten und bei den meisten anderen, vor allem kleineren Konkurrenten, blieb man bei der Handarbeit und schlachtete diese Feinheit in der Werbung um Kunden aus.
Es war wenig Geld, das Maria mit ihrem Rippenzupfen verdienen konnte. Und mit dem, was Lorenz an Bargeld nach Hause brachte, konnten sie kaum die Wohnung bezahlen. Lorenz bekam seine Mahlzeiten bei Melchior und er brachte auch häufig etwas Fallobst und Gemüse oder Kartoffeln mit nach Hause.
Immerhin, Marias Familie drohte mindestens anfänglich auch im Winter weder Hunger noch Kälte. Die Stube liess sich mit dem aus der Küche befeuerten Kachelofen wärmen. Für Weihnachten brachte der Lorenz jeweils ein Tännchen aus dem Wald, ohne es zu stehlen, so etwas wäre für das ganze Dorf unverzeihlich gewesen, er hatte es jeweils vom Förster erbettelt. Geschenke gab es kaum, aber ein wenig Gebäck, das ihm Melchiors Magd zusteckte.
Das war gut so, denn inzwischen erwartete Maria mit ihren knapp 24 Jahren ihr drittes Kind, Felix. Die Geburt war schwierig, dauerte zu lange und so ganz harmlos war die Sache nicht, aber schliesslich begann der Junge zu atmen und zu schreien.
In dem Jahr, in dem Maria Felix zur Welt brachte, entbrannte der Zweite Weltkrieg. Lorenz musste einrücken. Maria hatte keine Ahnung, wovon sie und ihre Kinder leben sollten. Am Anfang gab es noch keinen Lohnausgleich und Lorenz› Sold reichte gerade, um seine eigenen Bedürfnisse zu decken.
Wenn Lorenz zu kurzem Urlaub nach Hause kam, gab es für wenige Stunden Freude über das Wiedersehen und danach Streit um die schwierigen Verhältnisse. Weihnachten kam, den beiden älteren Buben fehlten Schuhe für den Winter, im Sommer und im Herbst gingen sie barfuss. Lorenz brachte den Buben zu Weihnachten Schuhe. Männer mit kleinen Kindern durften für die Weihnachtstage nach Hause gehen. Lorenz hatte das Geld für die Schuhe beim Melchior ausgeliehen und Maria davon nichts erzählt.
Drei Wochen nach Weihnachten wurde Lorenz überraschend für einen längeren Urlaub entlassen. Er nahm seine Arbeit bei Melchior wieder auf. An Stelle von Bier trank er jetzt Apfelmost. Melchior beobachtete ihn aufmerksam und machte ihm Vorhaltungen, wenn er übertrieb. Es gab Spannungen, hin und wieder beinahe Streit. Lorenz fühlte sich bevormundet, er wurde der Arbeit als Knecht ohnehin überdrüssig.
Es gab für ihn keine Arbeitszeitbeschränkung. Er verliess das Haus vor fünf Uhr früh, um in Melchiors Stall die Kühe zu melken, während dieser das Futter für den Tag mähte oder im Winter das Heu vom Stock aufbereitete. Danach trafen sie sich in der grossen Küche bei der Babs zu Kaffee und Rösti. Brot gab es nur, wenn die gebratenen Kartoffeln nicht reichten. Beim Essen erhielt der Lorenz die Arbeiten für den Tag zugeteilt. Das waren in der Regel die jahreszeitlich anfallenden Feldarbeiten. Um fünf Uhr abends begannen wieder die Arbeiten im Stall, um halb acht kamen wieder Kaffee mit Rösti auf den Tisch, danach bekam jede Kuh ihr Wasser vom Brunnen in einem grossen Eimer hergeschleppt. Das war jeweils Lorenz’ letzte Arbeit.
Verschwitzt und nach Kuhdreck stinkend kam er danach nach Hause, die Kinder waren dann schon im Bett. In der kleinen Küche wusch er sich mehr schlecht als recht und zog sich für die Nacht um. Wenigstens hatten sie fliessendes kaltes Wasser, das gab es in einzelnen abgelegenen Häusern noch immer nicht. Warmes Wasser war ohnehin nur durch den holzbefeuerten Herd zu haben. Für Holz war gesorgt, das konnte der Lorenz beim Melch einfach holen, es war Teil des Lohns.
Aber Letzteres zählte für Lorenz nicht. Er begehrte auf, er wollte mehr Lohn, was Melchior ihm verweigerte und meinte, er überlege ohnehin, ihm zu kündigen. Beinahe ein halbes Jahr hätte er alle Arbeit alleine, mit der Magd oder alten kraftlosen Tagelöhnern machen müssen, während sein Knecht im Militär herumsass und Bier soff.
Der letzte Satz war zu viel gewesen. Lorenz ging in sichtbarem Zorn und mit starken Worten auf die Kündigung ein. Melchior traute seinen Ohren nicht. Er versuchte erfolglos, den fluchenden Mann zu besänftigen. Er wandte sich ab und sagte nur: «Vergiss die Kühe nicht, sie wollen gemolken sein!» Lorenz nahm sich zurück, ging in den Stall und molk auch an diesem Abend Melchiors Kühe. Er suchte sich eine andere Arbeit. Melchior versuchte nicht, ihn umzustimmen, aber sie konnten sich auf Ostern als Abgang einigen. Lorenz war überzeugt, eine Stelle zu finden. Viele junge Männer waren noch immer in der Armee und die Ausländer, die es vor dem Krieg noch gegeben hatte, waren alle weg.
Für Maria war Lorenz› Schritt ein schwerer Schlag. Als es gegen Ende Februar sehr kalt wurde und sie sich sicher war, erneut schwanger zu sein, ging Maria zum Gemeindeschreiber, um sich über mögliche Hilfen zu erkundigen. Ja, es würde eine Lösung geben, eine Art Lohnausgleich, aber viel werde das nicht sein, da der Lorenz wenig verdiente und sein Naturallohn, sie wusste anfänglich nicht, was der Schreiber damit meinte, nicht sehr ins Gewicht falle. Andere Möglichkeiten zu helfen sehe er nicht. Sie sei im Dorf nicht die Einzige, die der Hilfe bedürfe, es gäbe viele Familien, die sich einschränken müssten, die Meisten im Dorf hätten auch nichts zu lachen. Sie erwähnte nichts von Lorenz› Kündigung.
Aber Maria hatte ihren Mann unterschätzt. Er wusste um die kommende Hilfe für Soldatenfamilien. Mit einer Arbeit in der Fabrik würde diese Hilfe bei einem nächsten Aufgebot besser ausfallen, als wenn er bei Melchior arbeitete. Er erklärte Maria mit grimmiger Miene: «Ich werde nicht mehr Knecht, sondern Arbeiter oder gar Angestellter sein!»
Als Maria der Gemeindeschwester von ihrem Zustand erzählte, zeigte die sich entsetzt. Sie könne sich doch nicht einfach so gehen lassen. Die Schwester war selbstverständlich ledig, ein Fräulein, und hatte keine Ahnung. Lorenz hingegen freute sich auf das Kind, bestimmt ein Mädchen!
Im März fand Lorenz bei Grosshändler Stöhr, Bier, Most und Limonaden, eine Stelle, vorläufig als Mann für alles, wie ihm sein neuer Patron jovial erklärte. Der Lohn erschien ihm eher spärlich, doch bei grossem Einsatz würde der wie von selbst klettern, meinte sein Arbeitgeber.
Melchior fand einen wegen einer groben Fussverletzung leicht hinkenden, vom Militär ausgemusterten, aber fleissigen Knecht aus dem Wallis.
Maria bat Lorenz, sich mit Melchior auszusöhnen, immerhin blieben sie Nachbarn, und wer weiss, vielleicht würde man sich wieder brauchen. Melchior zeigte sogar ein gewisses Verständnis und meinte zu Lorenz, er habe nun eine Hilfe, auf die er zählen könne.
Als Melchs Magd zu einem familiären Notfall gerufen wurde, machte sie ihm den Vorschlag, Maria Gramper als Aushilfe zu nehmen. Melchior zögerte einen Augenblick und sagte zu. Maria brauchte nicht lange nachzudenken, sie sah für ihre stets hungrigen Kinder nur Vorteile. Lorenz grollte ein paar Tage. Aber schliesslich gab er nach.
Milch, Brot, Käse, Kartoffeln, Gemüse, ab und zu Geräuchertes aus dem Kamin und Kaffee gab es beim Melch wirklich genug, davon durfte Maria mit nach Hause nehmen.
Im September 1940 musste Lorenz wieder einrücken. Die deutsche Wehrmacht überrannte Belgien und besetzte beinahe ganz Frankreich. Die Schweiz sah sich unmittelbar gefährdet. Ende Oktober kam Franz zur Welt. Maria fürchtete sich, im Winter für ihre Kinder oder gar mit ihnen hungern zu müssen. Zwar waren seit Kriegsbeginn Lebensmittelkarten eingeführt worden, aber ihr fehlte das Geld. Die Hilfe für die Familien der Wehrmänner kam jetzt zwar in Gang, doch hatte sie noch keine Ahnung, was sie erwarten durfte. Von Lorenz› Sold sah sie nie etwas. Der Füsilier steckte irgendwo in der Innerschweiz in den Bergen, im Reduit, wie er ihr erklärte und bekam über Wochen keinen Urlaub und wenn, hatte er sich auf der Heimfahrt mit seinen Kumpeln und etwas Bier in feuchtfröhliche Stimmung gebracht.
Mama Brand stundete den Mietzins weiter, sie liess Maria aber wissen, sich nicht allzu sehr auf ihre Geduld zu stützen. Kurz danach konnte Maria Milch und Brot in der Molkerei und beim Bäcker weiter anschreiben lassen. Die Gemeinde würde dafür aufkommen. Den Bescheid erhielt sie vom Armenvogt
Bis zum Ende des Krieges im Mai 1945 musste Lorenz noch dreimal einrücken und noch zweimal wurde Maria, wenn er auf Urlaub kam, schwanger. Markus kam zur Welt, als Stalingrad fiel und als die Kirchenglocken landauf, landab endlich den Frieden in Europa verkündeten, waren Maria und Lorenz Eltern von sechs Buben, der älteste zehn Jahre und der Jüngste, Peter, einen Monat alt.
1955 wurde Lorenz Gramper zum zwölften Mal Vater. Maria brachte ihr letztes Kind, Julia, zur Welt. Kurze Zeit danach begann Felix, der dritte Sohn, seine Lehre als Zimmermann und der 16-jährige Franz, der um alles in der Welt Bauer werden wollte, kam zu Melch auf den Hof. Er blieb auch nach der Lehre, zum Leidwesen des Knechts, beim Melch. Franz brachte neue Ideen von der Schule, die dem Knecht kaum je passten, dem Melch aber schon. Der Alltag auf dem Hof änderte sich. Franz wurde zu einem harten Arbeiter. Er riet schon während der Ausbildung unter anderem zur Pflanzung von Niederstamm-Obstbäumen. Melch war skeptisch, gab aber dem Drängen nach. Franz drängte auf eine Melkmaschine und setzte auch den Kauf eines Traktors mit modernem Pflug durch. Melch war kein armer Mann, auch nicht geizig, er fürchtete sich aber vor den schwierigen Zeiten, die kommen könnten.
Doch Franz setzte ihm auseinander, der Hof müsse für die Zukunft gerüstet sein, er, der Melch und sein Knecht, der ohnehin schon ein wenig Behinderte, würden älter und der Einsatz moderner Hilfsmittel daher unumgänglich. Ein später möglicher Pächter müsse vermutlich die ganze Arbeit alleine machen.
Franz war durch die Bauernschule nicht nur zu einem modernen Landwirt, sondern auch zu einem hervorragenden Handwerker geworden. In den Wintermonaten gingen sie daran, Franz› Pläne zum Umbau der Scheune umzusetzen, betonierten Fundamente und Böden. Die Balken und Bretter für die neue Holzwand, den grösseren Heuboden und das erweiterte Dach lieferte die Zimmerei, in der der von seiner Wanderschaft zurückgekehrte Zimmermann Felix arbeitete.
Felix half selbst in jeder freien Stunde mit, Melchiors Vieh eine verbesserte Unterkunft zu bieten, wie er es nannte. Dabei fasste er den Entschluss, ein eigenes Haus zu bauen.
In Bremen hatte er am Ende seiner Wanderschaft nach der Lehre als Zimmermann Hannelore geheiratet, die mit ihm in die Schweiz gekommen war. Ein grosses schönes Haus wollte er bauen, ohne eine Ahnung zu haben, wie er dies schaffen würde. Sie würden Kinder haben, er und Hannelore, dachte er, während er half, Melch die Scheune umzubauen. Als die Balken der vergrösserten Scheune aufgerichtet waren und auf dem First am aufgesteckten kleinen Tännchen die bunten Bänder flatterten, erzählte er von seinem Traum, dem eigenen Haus für Hannelore und die kommenden gemeinsamen Kinder.
Zwei Sommer später, als Hannelore schwanger war, bot Melchior dem jungen Paar im Bärenzopf ein Stück für ihn beinahe unbrauchbares Land mit den Grundmauern eines einst abgebrannten Hauses, aber an recht reizvoller Lage an der Grenze zu Wirrwil an, dies als Lohn für die Arbeit an seiner Scheune, zu einem Preis, den die beiden bezahlen konnten. Hannelore war nicht mit leeren Händen gekommen. Auch die Mutter in Bremen wollte den beiden gut und hatte nachgeholfen.
1963 ertrank Melchiors jüngster Sohn Alois mit dem älteren seiner beiden Enkel auf dem See. Dieses Unglück traf ihn bedeutend härter als alles zuvor.
Melch machte im Jahr darauf den 24-jährigen Franz Gramper zum Pächter des Hofs. Wiederum gemeinsam erneuerten und erweiterten sie das Wohnhaus um eine kleine Wohnung.