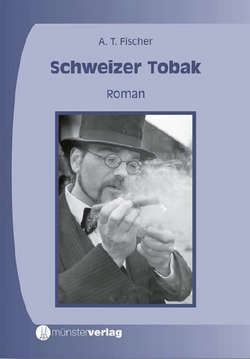Читать книгу Schweizer Tobak - Albert T. Fischer - Страница 15
Erster Besuch bei der alten Dame
ОглавлениеNach seiner Rückkehr aus Toulouse nahm sich André endlich Zeit, Helene, die Schwägerin seiner Mutter und letzte lebende Verwandte der Generation, die seine Kindheit mitgeprägt hatte, zu besuchen. Er wunderte sich, dass sie sich nicht in eine noblere Umgebung zurückgezogen hatte. Seiner Meinung nach waren ihr doch Dorf und Leute hier immer fremd geblieben, es war erstaunlich. Sie wirkte immer etwas abgehoben, eine Dame eben. Vielleicht wollte sie sich damit vor zu grosser Nähe schützen, fiel André ein.
André traf in der Cafeteria des Heimes auf eine mit ihren beinahe 90 Jahren noch immer charmant, humorig und sehr beweglich wirkende ältere Dame, die ihn auf Anhieb erkannte und lautstark begrüsste. Sie sass aufrecht auf ihrem Stuhl, war für ihre Jahre sommerlich lässig, aber sehr geschmackvoll angezogen – das war sie immer schon gewesen, genau so hatte er sie in Erinnerung – und diskret geschminkt, geistig voll da, es war erstaunlich. Sie roch weder nach Zigaretten noch nach zerstäubtem Parfüm, auch nicht nach alt. Zum letzten Mal hatte er sie am Begräbnis seiner Mutter getroffen, jedoch kaum mit ihr gesprochen. Jener Tag war für ihn ohnehin etwas schwierig, Miriam war dagewesen und seine Tochter aus Südfrankreich. Sie hefteten sich an ihn, weil sonst niemand Französisch sprach. Der Tag zog an ihm vorbei wie ein schlechter Traum. Der Pfarrer hatte ihn geärgert, weil er einfältiges Zeug behauptete, von Auferstehung sprach und vom Frieden im Herrn. Solches vermochte ihn nicht zu trösten, das alles hielt er für ebenso kindisch wie die Geschichte vom Osterhasen.
Helene erinnere sich gerne an ihn und seine Geschwister und bedauerte den Tod seiner Mutter Irma. «Wir verbrachten die letzten Jahre beinahe miteinander hier im Heim, auf dem gleichen Boden!» Sie fand es schade, seinem Vater nie begegnet zu sein, obwohl dieser vor dem Krieg ab und zu aus geschäftlichen Gründen in die Schweiz gekommen war, in der Zeit, als sie mit 18 bei Mama Brand ihr Haushaltslehrjahr hinter sich gebracht hatte.
«Haushalten können war damals neben vielem anderem eine unausweichliche Vorbereitung der Mädchen auf die späteren Pflichten», spöttelte sie, und weiter: «Wer bei den Brands putzen, kochen und betten lernte, fühlte sich bereits als etwas Besseres. Nicht alle konnten den Status halten, aber das ist Gott sei Dank passé, unglaublich, diese Veränderung! Als ich ein Mädchen war, schienen die Pflichten der Frauen in Stein gemeisselt. Allerdings hat mich das Leben von Anfang an verwöhnt.»
Sie erzählte: «Meinen Mann, deinen Onkel Ernst, lernte ich nicht bei den Brands, sondern in Neuenburg kennen. Wir heirateten 1939 bei Kriegsausbruch, weil er zu seiner Truppe einrücken musste, er war Oberleutnant bei der Gebirgsinfanterie, worauf ich sehr stolz war. Er wurde aber bald entlassen, weil ihm sein Rücken zu schaffen machte. Ich fürchtete immer, man würde ihn in eine andere Waffengattung stecken, aber wir hatten Glück, nicht nur damals. Unser ganzes Leben war ein gutes, bisweilen wunderbares Leben, wenn man etwas so Egoistisches sagen darf. Ernst und ich machten vor allem in späteren Jahren grosse Reisen, hatten immer genügend Geld, glaubten an den Fortschritt und waren überzeugt, einmal in nicht allzu ferner Zukunft würden alle Menschen so wie wir leben können.»
Inzwischen habe sie viel dazugelernt und wisse, wie privilegiert sie gewesen sei und wie sehr sie dadurch verwöhnt worden war. «Ich bin jeden Tag dankbar dafür und hoffe nach wie vor, dass es die Menschheit einmal schaffen wird, allen ein anständiges und würdiges Leben zu ermöglichen.»
Damit hatte sie endgültig gezeigt, dass sie nicht die Absicht hatte, sich über ihr Schicksal zu beklagen, doch André war sich da nicht so sicher. Während sie erzählte, las er Züge in ihrem Gesicht, die auch die andere Seite dieser Frau durchblicken liessen. Ihre Lippen wirkten schmal und hart, es gab Falten, die auf eine gewisse Nachdenklichkeit, wenn nicht Bitterkeit schliessen liessen. Vieles über Helene hatte ihm seine Mutter erzählt, anderes hatte er als Junge mitbekommen.
Als André noch ein Kleinkind gewesen war, in den ersten Jahren nach dem Krieg, hoffte Helene mit über 30 Jahren noch immer, eigene Kinder haben zu können. Sie war damals schon seit sieben Jahren mit Ernst verheiratet, lebte mit ihm in Kreuzach am Heimberg an seiner östlichen Flanke in ihrem kurz nach ihrer Hochzeit erbauten, sehr schönen und grosszügigen Haus, mit bei gutem Wetter beinahe atemberaubender Sicht auf See und Alpen. Wie Marcel Brand und seine Frau hatten sie sich den Ort, etwas weiter vom Dorf entfernt als jene, sorgfältig ausgesucht.
Andrés Geschwister waren nach ihrer Ankunft in ihrer neuen Heimat mit Tante Helene sehr schnell vertraut geworden. Allerdings war der Weg zu ihrem Haus für Elisabeth und Konrad beschwerlich, auch später mit dem Fahrrad, welches sie bergwärts schieben mussten. Schon kurz nach dem Krieg, als die Holzvergaser endlich überlebt waren und Benzin auch für Privatleute erhältlich wurde, kauften Ernst und Helene ein amerikanisches Auto. Sie war über Jahre eine der ersten Frauen im kleinen Dorf, die einen Führerschein besassen.
Vieles verdanke sie ihrem verstorbenen Mann, seinem Onkel Ernst, fuhr sie fort.
«Du musst allerdings wissen, in seinen letzten Jahren war er ziemlich sauer. Er hatte sein Leben lang zu viel geraucht. Zehn Lebensjahre hat ihn das gekostet, hat er gesagt. Vermutlich ist das so, aber es gab auch andere Gründe. Er sass sein Leben lang zu viel herum, hat zu viel gearbeitet und liess sich dabei stressen. Heute weiss man, wie verheerend diese Lebensweise sein kann. Damals hat man nicht daran gedacht, sondern war froh, sich ein gutes Leben leisten zu können.»
Sie schwieg einen Moment und fuhr dann fort: «Jetzt lebe ich schon 25 Jahre allein. Nach Ernsts Tod habe ich mir ein neues Leben gesucht. Ich verliess das Dorf, zog ins Tessin, begann, mich für die Geschichte meiner Familie zu interessieren und landete zuletzt bei der Geschichte vom Tabak, diesem unseligen Kraut, das auf der ganzen Welt so viel Unglück verbreitet und schon immer verbreitet hat.
In meinen ersten Jahren, in denen ich mit Ernst oben am Berg in unserem schönen Haus über dem See wohnte und ungeduldig wie vergeblich darauf hoffte, ein Kind zu haben, hatte ich unbegrenzt viel Zeit zum Lesen, Briefe schreiben, Freundinnen besuchen und zu empfangen. Doch, ich tat auch Nützlicheres, vor allem in den Kriegsjahren, ich strickte Pullover, Mützen, Handschuhe und Socken für Soldaten und minderbemittelte Familien. Viel Zeit habe ich damit verbracht, den Krieg am Radio zu verfolgen. Wir hatten einen Empfänger für Kurzwellen und ich habe Stunden unter dem Kopfhörer verbracht. Ich hörte vornehmlich die Sendungen der BBC, aber auch solche aus dem deutschen Reich, wie das damals hiess. Nach dem Krieg haben Ernst und ich durch das Rote Kreuz vermittelte Flüchtlingskinder in den Ferien aufgenommen. Sie kamen meistens für drei, vier Wochen aus Frankreich, aber auch aus Deutschland.
In all diesen Jahren rauchte ich Zigaretten. Das war schick, aber im Dorf verpönt. Frauen rauchten nicht, vor allem nicht öffentlich. Das tat ich nur, wenn ich im Auto durchs Dorf fuhr, vielleicht als Provokation. Ich glaube, ich war damals im Dorf im Gegensatz zu Ernst nicht beliebt, aber in gewisser Weise respektiert.
Ich fand Rauchen einfach wunderbar. Ernst sah man kaum je ohne Zigarre. Er war damals seit einiger Zeit Direktor bei den Brands, machte etwas Politik im Dorf und wurde schon bald zum Ammann gewählt. Alles war perfekt. Nur Kinder bekamen wir keine.
Ich glaube, meine Mutter Anna, vermutlich hast du sie nicht mehr gekannt, litt darunter noch mehr als ich. Hunderte von kleinen Schreihälsen hatte sie als Hebamme an die Luft gebracht, aber ausgerechnet mir konnte sie nicht helfen.
Kein eigenes Kind zu haben wurde für mich vor allem in den Jahren nach dem Krieg zu einer beinahe täglichen Last, die mich ab und zu auf absurde Ideen brachte. Auf meinem beinahe täglichen Marsch mit den Hunden kam ich fast ausnahmslos am Haus der Grampers mit ihren vielen Kindern vorbei, von denen ich wusste, dass sie auf die Hilfe der Gemeinde angewiesen waren. Sie waren längst nicht die einzigen. Die Familien mit den meisten Kindern waren immer die ärmsten. Ich begann zu ahnen, dass es umgekehrt war: die Ärmsten bekamen die meisten Kinder. So war es, man musste arm sein, um Kinder zu bekommen …
Ernst lachte mich deswegen aus und meinte, er wolle nicht arm werden, um Kinder zu haben, dann lieber keine. Für eine Antwort darauf war ich noch nicht reif genug. Wir konnten einfach keine Kinder bekommen und ich bin heute überzeugt, es war sein Unvermögen. Ich wage es noch heute kaum zu sagen, weil ich ihn noch immer nicht wirklich verletzen will. Er allerdings hatte keine Skrupel, hin und wieder zu versuchen, mir die Verantwortung für unsere Kinderlosigkeit zuzuschieben. Damals war eine medizinische Klarstellung nicht möglich und er sah sich zu Recht als potenten Mann.» Letzteres sagte die beinahe 90-Jährige mit sichtlichem Vergnügen, stellte André fest.
«Nun, wir lebten vom Tabak, wie die meisten unserer Gegend. Wer es gewagt hätte, lauthals öffentlich an dieser guten Sache zu zweifeln, wäre vermutlich in schwere Bedrängnis geraten. Im Gegensatz zu anderen lebten wir sehr gut davon. Meine Mutter war überzeugt, dass meine Raucherei mit der Kinderlosigkeit zu tun hatte. Immer wieder ermahnte sie mich, damit aufzuhören. Ich versuchte es ab und zu, halbherzig. Ich schaffte es einfach nicht. Sie starb im Hitzejahr 1947. Nach ihrem Begräbnis gab ich die Zigaretten auf. Kinder kamen trotzdem keine. Ich wurde rückfällig und gab die Zigaretten endgültig auf, als Ernst starb.
Aber ich begann, einige Bedenken Annas zu hinterfragen und versuchte, ihren Beobachtungen nachzugehen. Immer wieder hatte sie mich an meine Taufpatin Clara Wirth erinnert, ihre gute Freundin, die einst das Elend der Kinderarbeit in der Tabakindustrie erforscht hatte und schon früh von der Schädlichkeit dieses Krautes überzeugt gewesen war.
Ich habe Clara Wirth nur oberflächlich gekannt. Sie kam in meiner Kindheit zwei- oder dreimal zu Besuch, und als ich etwa acht Jahre alt war, verbrachte ich bei ihr in St. Gallen eine Woche Ferien. Ich glaube, sie lebte im Hause ihres Vaters. Ich kann mich an ihn nur sehr vage erinnern. Er hatte ein grosses, verrauchtes Arbeitszimmer mit viel Papier und einem Telefon auf dem Tisch. Das war für mich neu und darum habe ich es nicht vergessen. Die Wände waren voller Bücher. Ich glaube, er war nicht nur Redaktor einer Zeitung, sondern auch Theologe – ein frommer Mann jedenfalls. Clara hatte sich für mich freie Tage gemacht. Sie arbeitete als Stadtratsschreiberin, das war eine sehr wichtige Sache. Sie nahm mich mit in ihr Büro und zeigte mir ihre Schreibmaschine. In dieser Woche sah ich zum ersten Mal den Bodensee! Ich erinnere mich an einen Ausflug an einen kleinen Bergsee, ich vermute, es war der Seealpsee im Appenzellerland. Wir stiegen bestimmt nicht auf den Säntis, ich glaube, es gab noch keine Schwebebahn zum Gipfel.»
Sie lehnte sich ein wenig zurück und erzählte weiter:
«Zum Geburtstag und zu Weihnachten schickte sie mir stets das gleiche Geschenk: Messer, Gabel, Löffel und einen Fünfliber, alles noch in echtem Silber. Später kam Fisch-, Dessert- und Schöpfbesteck dazu. Das alles muss sie damals ein kleines Vermögen gekostet haben. Heute lächelt man darüber, die Menschen haben eben keine Ahnung mehr, wie kostbar diese Dinge waren. Beinahe habe ich es vergessen: Sie schickte mir auch immer wieder Bücher mit einer persönlichen Widmung und einer Zeichnung auf der ersten Seite.
Das Meiste über sie hat mir allerdings meine Mutter erzählt. Anna und Clara waren Freundinnen, sie wurden es während der beiden Jahre, in denen Clara im Schmauchtal für ihre Doktorarbeit recherchierte.
Clara hatte auf meine Mutter enormen Einfluss. Durch sie kam meine Mutter während des Ersten Weltkriegs zum Roten Kreuz und wurde danach Hebamme. Clara stand im Verdacht, eine verkappte Sozialistin zu sein. Dank ihres bekannten Vaters hatte aber niemand den Mut, sie frontal anzugreifen. Sie war offenbar unbestechlich und stellte mit ihrer Arbeit die aus ihrer Sicht Schuldigen an der Not der kleinen Leute, nicht nur in der Tabakindustrie, sondern auch in der Textilindustrie an den Pranger.
Nach meiner Heirat mit Ernst zu Beginn des grossen Krieges wandte sich Anna in Achstadt vor allem den ärmeren Leute, der sogenannten Unterstadt zu. Es gab Dutzende kinderreicher Familien, die Hunger litten, deren Väter irgendwo in den Bergen ihren Dienst taten, deren Frauen keine Arbeit fanden und viele der überforderten Mütter erwarteten ein weiteres hungriges Maul, während in der oberen Stadt begüterte Bürger kostspielige Feiern zum Jubiläum der 650-jährigen Eidgenossenschaft planten. Im gemeinnützigen Frauenverein schlug Anna ein Protesttheater vor, das dieses Elend zum Thema haben sollte.
Sie verrannte sich in die fixe Idee und begann, Hefte mit Notizen und Szenen für ein Theaterstück zu füllen, wohl wissend, dass sie damit keine Chance hatte. Sie wollte sich ihre Wut und die Trauer über die Verhältnisse, an die sie sich aus ihrer Jugend erinnerte und die sie in ihrer Arbeit täglich mit ansehen musste, von der Seele schreiben. Sie verfasste zuletzt ein Drama, das selbstverständlich niemand aufführen wollte, schon gar nicht zum grossen Fest der Eidgenossenschaft.
Als meine Mutter starb, wollte ich ihre Hefte wegwerfen. Ich begann jedoch aus einer gewissen Neugier, darin zu lesen. Zusammen mit Claras Dissertation aus dem Jahre 1912 begann ich zu verstehen, wie verzweifelt viele kleine Leute, nicht nur in ferner Vergangenheit, sondern während und am Ende des Zweiten Weltkrieges um ihr tägliches Brot ringen mussten. Diese erbärmliche Wirklichkeit war mir zuvor nie nahegekommen. Zwar hatte mich meine Mutter nie verwöhnt und wir lebten im Vergleich zu meinem Leben mit Ernst bescheiden. Anna verfügte als Hebamme nur über ein kleines Einkommen, aber sie konnte mir stets das Gefühl vermitteln, wir gehörten zu den Leuten, denen es gut geht. Ich lebte in der Idee, alle Menschen würden in ähnlichen Verhältnissen leben, nur mit dem Unterschied, dass die andern Mädchen einen Vater hatten und meine Mutter arbeiten musste.
Nach allem, was ich aus den Heften meiner Mutter gelesen hatte und von ihren Erzählungen her kannte, liessen mir die Schatten dieser Branche, die Clara Wirth minutiös recherchiert hatte, keine Ruhe. Da gab es Dutzende vermögender Familien, die sich am Elend geplagter Menschen bereichert und es gab unzählige Väter und Mütter, die während rund 100 Jahren die eigenen Kinder ausgebeutet hatten.
Durch Annas Erinnerungen und Notizen kannte ich sehr viele dieser Leute auf beiden Seiten. Vor ein Gericht müsste man sie alle schleppen, schrieb Anna, ihnen vorführen, was sie gefördert hatten oder unwidersprochen geschehen liessen, und sie dafür bestrafen.
Beim Lesen begann ich, mir dieses Gericht vorzustellen, die toten und auch die noch lebenden einstigen Kinder als Opfer, die Fabrikherren, Behörden und Pfaffen als Täter und die irregeleiteten Väter und Mütter als Mitschuldige. Ich begann, an Annas Garn weiterzuspinnen, hielt mich an ihre Schlüsselaussagen und schrieb Szenen.
Anna war überzeugt: Solange die Männer allein das Sagen hätten, würde sich in der Gesellschaft nichts wirklich ändern. Männer wollten immer herrschen, unterdrücken, alles mit Gewalt erzwingen. Darum waren Kinderheime keine Heime, sondern Zuchtanstalten. Männer wollten Kinder zum Gehorsam und zu guten Menschen prügeln, verlassene Kinder für die Fehler der Eltern bestrafen. So war das durch alle Jahrhunderte geschehen und es würde sich nicht ändern, solange sie die Macht dazu hätten. Meine Mutter war eine feurige Anhängerin von Iris Rothen und trat für die Rechte der Frauen überall und jederzeit ein. Männer, die das wussten, versuchten mit allen Mitteln zu verhindern, dass meine Mutter ihren Frauen half, ihr Kind zu entbinden.
Ich war sehr traurig, als sie starb, und versuchte, zu ihrem Andenken weiter zu schreiben. Ernst lachte mich aus und ich fühlte selbst, dass dies aussichtslos war. Eines Tages erzählte er mir von einem Projekt des Tausendsassas Alois Stramm, der an einem «Familienabend» seine Partei feiern und mit ein paar Szenen die Vergangenheit des Dorfes in den letzten hundert Jahren auf die Dorfbühne bringen wollte. Ernst lud ihn mit seiner jüngst angetrauten Frau zum Essen ein, und wir unterhielten uns über seine Pläne. Ich glaubte, er sei wirklich interessiert an einem ehrlichen zeitkritischen Spiegel der Vergangenheit. Er war begeistert und ich machte mich daran, einige Szenen aus meinem Fundus vorzustellen. Das war bodenlos dumm von mir gewesen, wie ich später leider einsehen musste.
Alois wollte eine fröhliche Vergangenheit mit der Aussicht auf eine rosige Zukunft auf die Dorfbühne bringen. Ich aber wollte in einem ersten Akt arme ausgebeutete Kinder, miserable Väter, feige Mütter, stumpfe Aufseher, gierige Fabrikanten, einen korrupten Gemeindeschreiber und einen bigotten Pfaffen vor einem Gericht auftreten lassen. In einem zweiten Bild sollten die Menschen der Zukunft idealistisch und gemeinsam eine bessere Welt schaffen, in der es allen besser ginge.
Keinen Augenblick wäre mir eingefallen, ich hätte sozialistische Thesen übernommen. Aber so kam es bei Alois Stramm an. Ernst gelang es dann, die Situation zu entspannen und mich sozusagen freizureden. Das war mir zwar peinlich, aber ich sah selbst meine aussichtslose Lage ein. Wir durften nicht verteufeln, was uns unser Leben erst ermöglichte. Ernst meinte: ‹Du bist nicht Robin Hood.› Rückblickend erscheint das alles so lächerlich, aber damals fühlte ich mich sehr gedemütigt.
Seither habe ich nichts mehr geschrieben. Als Elsa zu uns kam, war ich an all diesen Themen kaum mehr interessiert. Ich habe aber alles aufbewahrt, Claras Dissertation und die Hefte meiner Mutter, ihr Bühnenspiel und mein eigenes Zugemüse. Oft habe ich mir vorgenommen, mich davon zu trennen und brachte es doch nicht über mich, weil ich durch die Schreiberei zu einem neuen Ich gefunden habe. Ich war ja so naiv und gleichzeitig überheblich! Meine Mutter hatte sich wirklich immer um einfache Leute gekümmert, aber sie tat es von oben nach unten. Von ihr habe ich gelernt, zu jenen zu gehören, die Ratschläge erteilen, Anweisungen geben, keinen Widerspruch dulden. Ich hatte das übersehen und gewöhnte mich sehr schnell in meinem behaglichen Alltag mit Ernst an das gute, etwas abgehobene Leben der sogenannten besseren Leute. Für mich wurde es selbstverständlich, dies nicht nur anzunehmen, sondern auch zu geniessen.
Das ging weit über das Gewöhnliche hinaus. Nach dem Krieg leistete ich mir Haushaltshilfen, Mädchen aus dem Elsass, aus dem Schwarzwald, Vorarlberg und Südtirol. Ich hatte gar das Gefühl, damit Gutes zu tun, sie lernten, einen vornehmen Haushalt zu führen, bekamen ihr Essen und etwas Taschengeld. Sie hatten meiner Ansicht nach ein gutes Leben. Als wir Elsa adoptierten, war ich doppelt froh um diese Mädchen und verstand überhaupt nicht, warum sie in den 70er Jahren kaum mehr zu bekommen waren, mindestens nicht zu den bisherigen Preisen. Als Elsa in der Stadt studierte, leistete ich mir nur noch eine Putzfrau.
Dann starb Ernst, ich verkaufte das Haus, verliess das Dorf und zog zu Elsas Entsetzen in unsere kleine Zweitwohnung in Ascona. Es war ein durch Jahrzehnte aufgestauter Überdruss, der mich dorthin trieb. Ich hasste das Zigarrendorf.»
André und Helene vertraten sich ein wenig die Füße. André musste das Gehörte erst ein wenig verarbeiten und er staunte, wie vital die alte Dame war, die gleich wieder anhob:
«Zwei Jahre später kam ich zurück. Ich war mir selbst davongerannt, so wie ein Stück weit durch das ganze Leben. Ich hatte bis auf ein wenig Zuwendung an Elsa und euch nichts Brauchbares getan, ich hatte gelebt wie die Made im Speck. Es war vermutlich eine Art innere Enttäuschung, eine enorme Leere, die ich in diesem Haus und in diesem Dorf nicht mehr aushalten konnte. Ich hatte jedoch Ursache und Wirkung verwechselt und bin zurückgekommen, nachdem ich das auch eingesehen hatte, in eine bescheidene Wohnung mit gewöhnlichen Nachbarn. Mit einem Mal war hier alles anders. Leute, die ich bisher schlicht übersehen hatte, grüssten mich, waren freundlich zu mir, wollten wissen, wie es mir geht. Meine Rückkehr war für sie ein spätes Bekenntnis, dass ich doch zu ihnen gehöre. Das war bewegend zu erleben.
Jetzt erst sah und fühlte ich im Dorf mit seiner Landschaft, dem See, der Weitsicht auf den Kranz der Alpen so etwas wie Heimat. Als es Zeit wurde, in ein Heim zu wechseln, drängte mich Elsa zu einer nobleren Bleibe. Aber ich wollte nicht. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und angesehen als Frau Schaller, die Frau des einstigen Direktors und Gemeindeammanns, das ist doch was!»
Der jugendliche Schalk seiner älter gewordenen Tante war für einen Augenblick wieder da. André glaubte, in ihr die frühere Helene wieder gefunden zu haben.
Sie entschuldigte sich für ihren Redeschwall. Wem das Herz voll sei, fliesse bekanntlich der Mund über. Sie freue sich, dass er da sei und nun wollte sie von ihm wissen, warum, wieso und wofür. Sie hörte für sein Gefühl etwas zu aufmerksam zu, sie wollte ihm vermutlich zeigen, wie wichtig sie seinen Besuch fand. Er machte es so kurz wie möglich und kam zum Schluss auf das Thema, das ihn seit seiner Rückkehr am meisten beschäftigte: der erstaunliche Untergang der Tabakindustrie, jener Industrie, die seiner Tante ein so sorgloses Leben bereitet hatte.
Helene gab eine erstaunlich kurze und abgeklärte Antwort. Die Männer in aller Welt rauchten seit dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Zigaretten und immer weniger Zigarren. Die kleinen Betriebe hatten letztlich zu wenig verdient, um sich im Wettbewerb zu halten, einige grössere machten grosse Fehler, schwächelten bei der Entwicklung neuer Ideen, investierten zu wenig in die Werbung, verpassten die Mechanisierung und wurden sehr oft durch die Familienstrukturen in den Ruin getrieben.
Viele der reichen Tabakherren konnten ihr Geld im letzten Augenblick retten. Ihre veralteten, aber oft noch erstaunlich intakten Betriebe wurden von den verbliebenen beiden grossen, Gruber und Brand, aufgekauft. Und diese beiden gehörten inzwischen zu den Grossen der Tabakwelt. Während die Grubers im Schmauchtal mit wenigen Leuten noch irgendwelche Grundprodukte herstellten, wickelten in der alten Fabrik der Brands an die dreihundert Angestellte noch immer in Handarbeit einige auserlesene Zigarren.
Übergangslos fragte Helene nach Andrés Schwester und ergänzte, es sei ein Elend gewesen, dass Konrad unter so mysteriösen Umständen hatte sterben müssen.
Auch Andrés Geschwister waren einst bei Helene ein- und ausgegangen, als ob sie dort zu Hause seien. Immer wieder meinte ihre Mutter, wie schade es wäre, dass Helene keine Kinder bekam. Sie wäre doch eine so gute Mutter geworden. Doch noch heute, wenn er sich daran erinnerte, konnte er an dem Tonfall, in dem sie es gesagt hatte, so etwas wie einen Vorwurf heraushören. Er hatte dies vergessen, doch jetzt kam dieser Ton seiner Mutter zurück und rief ihm Elsa in Erinnerung.
Warum hatte er Elsa vergessen? Und warum hatte Helene nicht gleich zu Beginn von ihr erzählt? Doch als er nach ihr fragte, reagierte sie durchaus lebhaft.
Elsa gehe es sehr gut, sie sei Lehrerin für Musik und Gesang an der Sekundarschule hier, sie hätte auch ein Pensum in der Stadt und leite dort einen Chor. Die inzwischen 51-Jährige lebe allein und komme immer wieder vorbei, um nach ihr zu sehen. Ihr Mann, mit dem sie einen Sohn habe, sei mit 40 an Krebs gestorben. Der Sohn lebe in Zürich, sei ledig und arbeite als Banker, erzählte sie mit unüberhörbarem Stolz.
Sie ermunterte ihn, Elsa zu besuchen. Sie seien immerhin so etwas wie Cousin und Cousine. Er fand das eine gute Idee, denn irgendwie erinnerte er sich an ein durchaus fröhliches bis übermütiges Mädchen mit dunklen, beinahe schwarzen Zöpfen und roten Backen. Als er sie zum letzten Mal gesehen hatte, war sie vielleicht vierzehn gewesen.
Er versprach, sich bei Elsa sehen zu lassen und wiederzukommen und bat Helene darum, einen Blick in all die alten Geschichten, die sie offenbar noch immer aufbewahrte, werfen zu dürfen. Sie war hocherfreut über sein Interesse, er dürfe durchsehen, was immer er wolle, letztlich jedoch gehöre alles Elsa, ob die sich allerdings daraus etwas mache, wisse sie nicht. Der letzte Satz hörte sich leicht bitter an.
André versuchte, sich an Elsa zu erinnern.
Mit Elsa hatte sich das Klima bei Ernst und Helene deutlich verändert, mit einem Mal drehte sich dort alles um die kleine Göre. Er war damals zwölf und fühlte sich bisher von der Tante besser gelitten als von seiner Mutter. Plötzlich war alles anders, ein Schock, eine kalte Dusche für den Hahn im Korb. Elsa war als Dreijährige aus einem Waisenhaus gekommen. Helene und Ernst hatten das Kind zu sich genommen, weil sie die Hoffnung auf ein eigenes Kind längst aufgegeben hatten und endlich auch die zuständigen Behörden daran nicht mehr zweifelten. Später adoptierten sie das Mädchen, ein damals langwieriger Prozess. Als Elsa kam, arbeitet Andrés Schwester in Israel im Kibbuz und sein Bruder war Student, er fuhr jeden Tag mit der Bahn in die Stadt, und seine Mutter verbrachte die Tage in der Fabrik hinter ihren Lohnlisten. Nur Helene war immer dagewesen. Dann kam Elsa.
Trotzdem – er erinnerte sich an Elsa als ein fröhliches, ausgelassenes Mädchen. Manchmal im Sommer holte Helene ihn ab und fuhr mit ihm und Elsa zu einem der Seen, nicht zum Baden, eher in eine Wirtschaft mit Garten am Wasser. Sie fürchtete sich davor, die Kinder in den See zu lassen, sie fand das Wasser schmutzig und oft wurde das Baden in jenen Jahren tatsächlich verboten. Sie bestellte jeweils für beide eine Limonade oder gar eine Eiscreme und wanderte danach ein Stück am See entlang. Meistens hatte sie ein Buch dabei, setzte sich auf eine Bank, bat André, auf Elsa aufzupassen und begann zu lesen – endlos, wie ihm schien. Dem 13- und 14-Jährigen fiel es nicht leicht, die unermüdliche Zappelgöre im Zaun zu halten. Mehr und mehr fand er Ausflüchte, um die Ausflüge mit Elsa zu vermeiden. Schliesslich war er jetzt ein Junge und für anderes vorgesehen.
Durch all die Jahre hatte er das Mädchen mehr oder weniger vergessen und mit ihr viele andere wie Lorenz, seinen Sohn Felix und eigentlich alle seine Mitschüler. Irgendwann würden sie ihm bestimmt begegnen, hoffte er. Elsa aber würde er schon bald aufsuchen. Nur nicht gleich.