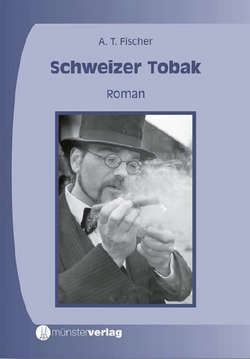Читать книгу Schweizer Tobak - Albert T. Fischer - Страница 17
Die Generalversammlung
ОглавлениеAndrés Entscheid, sich für das grosse Fest zur Einweihung der neuen Schulanlage zu engagieren, fiel Ende Februar kurz nach seinem offiziellen Einstand in den regionalen Segelclub anlässlich der jährlichen Generalversammlung. Im November, als es darum ging, die Schiffe nun wirklich aus dem See zu nehmen, hatte er Glück gehabt. Ein Sekundarschullehrer, der in Pension ging und seine alten Tage mit seiner Frau am Neuenburgersee verbringen wollte, wo er seit langem ein zweites Schiff besaß, verkaufte ihm seine Jolle und André konnte auch den Einstellplatz im Bootshaus übernehmen. Im Frühjahr oder zum Sommeranfang hoffte André, sein Brevet zu machen und er wurde Mitglied im Club der Segler.
Er freute sich darauf, endlich einer Gruppe von Leuten anzugehören, hinter denen er eine gewisse Geistes- oder gar Seelenverwandtschaft vermutete wie Freude am Leben auf dem See, an Sonne und Wind, Grosszügigkeit im Alltag, geistreich und weltoffen, belesen, mit einer gewissen Neigung zur Musse und so weiter. Er erhoffte sich zudem Gesprächspartner für seine Pläne zum grossen Fest.
Die Versammlung fand im «Bären» statt, einer Wirtschaft mit guter Küche, ansehnlichem Keller, Lokalitäten für Gruppen und Vereine und einem genügend grossen Saal. Der Präsident begrüsste die neuen Mitglieder speziell und wünschte ihnen viel Spass auf dem See und bei möglichst vielen geselligen Anlässen.
Zum Schluss der ordentlichen Geschäfte hatte der Präsident jovial und gut gelaunt – alle seine Traktanden und Vorschläge waren glatt über die Bühne gegangen – seine lieben Freunde eingeladen, noch ein paar Stunden zu bleiben und bei einem Glas Wein oder gar einem guten Fischteller einen gemütlichen Abend zu verbringen. Leider müsse er bitten, das Rauchen zu unterlassen, das sei auch für ihn eine Strafe und für die Region ganz besonders, doch es sei nun mal Gesetz und daran müssten sich alle halten. Für ein paar Züge sei im Freien ja noch immer genug frische Luft vorhanden und so gäbe es keinen Grund, die gemütliche Runde vorzeitig zu verlassen.
André sass mit sieben anderen Personen am runden Tisch. Alle kannten sich, André stellte sich vor und die Leute prosteten ihm zu. Sie nahmen das Thema des Präsidenten auf und verbreiteten sich über die idiotische Einschränkung persönlicher Freiheit durch das Rauchverbot. Ausser André verteidigte nur Marietta, von Beruf Krankenschwester – Pflegefachfrau, korrigierte sie ihre mit am Tisch sitzende Mutter – diese Freiheitsberaubung. Sie meinte, am Sinn der Sicherheitsgurte im Auto und am Pariser gegen Aids zweifle auch niemand, warum denn an der Einschränkung gegen das Rauchen? Nach wie vor gäbe es sinnigerweise noch immer kein Gesetz, das den Männern den Pariser zwingend vorschreibe, meinte ein sich besonders witzig findender Tischgenosse und erntete damit tatsächlich die lachende und schenkelklopfende Zustimmung fast der ganzen Runde.
Ungerührt meinte die Pflegerin, 400.000 Eidgenossinnen und Eidgenossen litten gegenwärtig an chronischem Raucherhusten und die Chance, sie später, an einer schlimmen Krankheit leidend, teuer durchpäppeln zu müssen, um sie zuletzt doch richtiggehend krepieren zu sehen, sei ziemlich gross. Nun, für sie und das ganze Krankheitswesen wäre das immerhin Arbeitsbeschaffung, aber sie selbst könne sich ein weniger leidvolles Lebensende vorstellen, ganz zu schweigen von den Kosten, die die Gesellschaft zu tragen habe, dem Schaden und dem Leid, das unzählige Familien, insbesondere den Kindern, zugemutet würde.
Die volle Ladung kam an. Niemand ausser vielleicht den Eltern hätte der zierlich wirkenden Frau eine solche Breitseite zugetraut. Doch die Runde fasste sich schnell. Ja, ja, die Leute würden auch sonst irgendwie leidend sterben, weil sie zu viel assen, sich zu wenig bewegten oder sich zu Tode soffen, was weit schlimmer sei und ganze Familien zerstöre. Die Aufregung sei doch völlig überzogen. Selbstverständlich müsse man mit dem Tabakgenuss umsichtig umgehen, niemand liebe einen Zigarrenraucher beim Mittagessen. Das sei wie mit dem Genuss von Wein, niemand wolle doch bestreiten, dass dieser eine gute Mahlzeit aufwerte. Marietta meinte dazu, das sei nicht das Problem. Beim Wein müssten nicht alle mittrinken und das Wasser aus der Röhre sei damit nicht versaut. Die Luft im Umfeld der Raucher schon. Zudem sei ihr letzthin eine Frau nachgerannt und habe sie unflätig beschimpft, weil sie das Papierchen eines Karamells unbeabsichtigt verloren hatte. Zigarettenstummel aber lägen zu Millionen herum und kein Mensch rege sich darüber auf.
Jetzt war das Mass voll. Selbst ihre Eltern zogen über Marietta her. Sie sei eine Fanatikerin und predige wie eine Sektiererin, wie könne sie nur alle rauchenden Menschen zu Umweltverschmutzern stempeln! Aber so seien sie eben alle, diese anmassenden Besserwisser und Sektierer, die keinen Sinn für die kleinen Freuden im Leben hätten. Es sei doch auch etwas, das Leben zu geniessen, nicht nur immer zu arbeiten und sich nie einem auch nur kleinen Laster hinzugeben. Man sage ja, die Summe aller Laster sei bei allen Menschen gleich, welches denn nun ihr Laster wäre.
Zugegeben, sie liebe es auch, das Leben zu geniessen, sie verstehe aber darunter mehr als das süchtige Inhalieren von stinkendem Rauch, entgegnete sie, und argumentierte: «Mein Laster ist es, dummes Geschwätz, wenn möglich, abzublocken oder mir mindestens nicht anzuhören.» Jedermann sei freundlich eingeladen, mit ihr die lungenkotzenden Schwerkranken zu besuchen und einmal richtig mitzubekommen, wie genussvoll dieses Lebensende sein könne. Wirklich, das seien dann die kleinen Freuden der letzten zwei, drei Jahre.
Marietta stand auf, wünschte allen einen schönen Abend und ging. Jetzt begannen die Eltern, ihre Tochter in Schutz zu nehmen. Sie meine es nicht so böse und sei doch eine liebevolle und einfühlsame Pflegerin. Sie bekomme immer wieder liebe Briefe von Patienten. Wahrscheinlich hätte sie sich hier provoziert gefühlt und es gar nicht so ernst gemeint. Die zwei anderen am Tisch sitzenden Paare beruhigten sich.
André hatte seine Zweifel, aber keine Lust, das Gespräch weiterzuführen, er befürchtete, die Runde auch vorzeitig verlassen zu müssen. Er blieb, bestellte sich ein Glas Wein und einen Teller mit Pommes frites und Schnitzel. Er nahm an der für eine Weile munter plätschernden Unterhaltung teil und erzählte auf ein paar neugierige Fragen hin, dass er Lehrer in Frankreich gewesen und wie er nun neu zum Segler geworden war.
Ohne es zu wollen, führte seine Geschichte in eine Richtung, die er nicht erwartet hatte. Inhalt und Ergebnis wurden ihm erst im Nachhinein, zurück in seinem Haus, richtig bewusst.
Seine Tischgenossen liessen kein gutes Haar an Land und Leuten, die ihn während über 30 Jahren ein mehr oder weniger gutes Leben hatten leben lassen.
Er hielt sich nicht für übertrieben frankophil und hatte sich nie Illusionen über die Probleme der Franzosen, ihrer Nation, die sie noch immer als «gross» erlebten und ihrer Republik gemacht, die nicht immer gefestigt erschien. Dieses Volk liess sich nicht leicht regieren, es ging auf die Strasse, um die Zähne zu zeigen, aber auch, um seinen Stolz vorzuführen, um zu jubeln und zu tanzen.
Auch er hatte die Europäische Union nicht nur als Erfolgsprojekt erlebt, aber gab es dazu eine einigermassen bessere Alternative? War es nicht die einzige Möglichkeit, um aus den sich seit Jahrhunderten mehrfach zerstrittenen und immer wieder blutig bekämpften Feinden Freunde und Partner zu machen? Gab es eine andere Lösung für Europa, um sich gegen die grossen Mächte dieser Welt durchzusetzen oder sich zumindest Gehör zu verschaffen?
Was wussten diese arroganten Schweizer schon von den grässlichen Verletzungen, die unzählige Kriege diesen Völkern und Menschen beigebracht hatten? Was wussten sie über die kulturellen und materiellen Verluste, die beinahe jede Generation hatte hinnehmen müssen? Jetzt versuchte man, sich zusammenzuraufen, gemeinsam eine prosperierende Zukunft in Frieden aufzubauen. Was waren schon die bekannten Unzulänglichkeiten im Hinblick auf die Chancen für die Zukunft! Die Europäische Union war ein Hoffnungsträger für einen friedvollen Kontinent, auf dem keine Diktatoren mehr Platz hatten.
Doch seine Gesprächspartner liessen das alles nicht gelten. Sie reduzierten Frankreich auf eine unfähige Gesellschaft und Europa auf ein nicht funktionierendes, wirtschaftlich nicht steuerbares Gebilde ehrgeiziger Politiker und Bürokraten. Sie wollten darin nur einen undurchsichtigen, Milliarden verschlingenden, über seine Verhältnisse lebenden, unweigerlich dem Untergang bestimmten Moloch sehen.
Es blieb im Gespräch nicht beim einfachen Vergleich unterschiedlicher Traditionen, Mentalitäten und Systeme. Franzosen waren für die Leute am Tisch faul, unzuverlässig, oberflächlich, wurstig und arrogant.
Im Zweiten Weltkrieg rannten sie offenbar einfach feige davon und zogen hinter dem Schild der Amerikaner wieder in ihre Häuser, Dörfer und Städte zurück, zurück zu ihren Cabarets mit den leichten, lasziven Flittchen. Bestenfalls fürs Bett geeignet, lachte eine Frau. Eine andere, aus Basel stammende und mit einem Gemüsehändler verheiratete junge Frau am Tisch meinte, sie kenne die Franzosen, Männlein und Weiblein zur Genüge. Tausende dieser Waggis kämen jeden Morgen, um in Basel zu arbeiten, nicht nur in der Chemie, sondern überall, als Markt- und Putzfrauen, Verkäuferinnen, Coiffeusen, Bau- und Hilfsarbeiter und alle seien ein wenig grobschlächtig und schwer von Begriff, Deppen eben.
Woher kamen alle diese Klischees über die Nation im Westen? André erinnerte sich an einen Aufsatz im Feuilleton einer Zeitung, den er als Student gelesen und seither vergessen hatte. Er wurde damals darauf aufmerksam, weil ihn seine Kommilitonen hänselten, als er zum ersten Mal für drei Monate nach Paris ging, um die dortige Sprache zu üben.
Als der deutsche Kaiser 1914 gegen Frankreich in den Krieg zog, musste er sein Volk hinter sich scharen. Dafür war ihm, zumindest seinen Propagandamachern, kein Aufwand zu gross und keine Verunglimpfung zu schäbig, um ihre schamlose Hetze erfolgreich zu machen. Zeitungen und Plakate waren voll übelster illustrierter Unterstellungen über Jahre. Dieser mörderische Krieg war nicht nur auf dem Schlachtfeld zäh und lang, sondern auch hinsichtlich der Volksverhetzung. Zwar gaben die Franzosen mit gleicher Münze zurück, doch in der weit herum kaiserfreundlichen Deutschschweiz mit ihrem von den Romands ungeliebten, mit Bismarck verschwägerten General Wille, kamen nur die Verunglimpfungen aus dem Reich zum Tragen.
Der Autor jenes Aufsatzes konnte nachweisen, wie sich diese Stimmungsmache in der Bevölkerung über Generationen festgesetzt hatte, und, so fand André, bis ins 21. Jahrhundert nachwirkte, wie die Hetze gegen Juden.
Vielleicht war das ein Erbe der unseligen Zwischenkriegszeit, in der die systematische Verunglimpfung, Verleumdung und Schändung alles Jüdischen zum grössten Verbrechen gegen die Menschlichkeit der modernen Geschichte ausgeartet war. Zwar wurden die Juden in Europa durch alle Zeiten immer wieder behindert, ausgebeutet, verfolgt und getötet, doch erst die gnadenlose Hatz der Nationalsozialisten führte schliesslich im Zweiten Weltkrieg zum Massenmord an Männern, Frauen und Kindern aus ganz SEuropa.
Wer Krieg will, befeuert den Hass durch Hetze. Hass ist ein Feuer, das sich oft an kleinen Unzulänglichkeiten entzündet, im Alltag Nahrung findet, anfänglich in Nischen schmort, im Gespräch in kleinen Gruppen aufglüht, in Vereinen, vermeintlich harmlos, oft launisch, oft mutwillig angefacht, auflodert, aus Misstrauen, aus Angst vor Unbekanntem, Andersartigem, Undurchschaubarem, aber auch aus Neid und Missgunst und das schliesslich ausartet in wütende Tiraden, die sich erst gegen Einzelne, dann gegen Gruppen, Völker und Rassen richten und sich schliesslich zu Kriegen ausweiten.
Die Gier nach Macht oder Reichtum ist die Mutter aller Kriege. Wer den Hass kennt und die Hetze beherrscht, bekommt seinen Krieg.
All diese Zusammenhänge kannte André, doch konnte er sie nicht auf den Punkt bringen. Man würde ihn als Schulmeister disqualifizieren, fürchtete er, vermutlich zu Recht.
Warum, fragte er sich, gelang es ihm nicht, diesem dummen Geschwätz angemessen, inhaltlich korrekt, aber humorvoll und überzeugend zu begegnen? Hatte er durch all die Jahre die Schlagfertigkeit in seiner Muttersprache verloren? Konnte er mit diesen Leuten keinen gemeinsamen Nenner mehr finden? Er war doch zurückgekommen, um wieder in seiner Heimat zu leben, aber das hier war nicht oder nicht mehr seine Heimat. War sie es allenfalls gar nie gewesen? Wo war sie denn dann, seine Heimat?
Die Frage konnte er nur sich selbst stellen, nicht den Leuten, die ihn so furchtbar enttäuschten. Sie würden nur sagen: «Geh doch wieder dorthin, wo du die Menschen so hast, wie du sie haben möchtest! Bist du nur hergekommen, um uns zu sagen, was wir denken sollen, oder um uns zu kritisieren? Du machst dich in unseren Augen zum Verräter, zum Nestbeschmutzer. Du missachtest das Erbe unserer Ahnen!»
Nie hatte er sich in den letzten 30 Jahren Gedanken über die politische Kultur und die Denkweise in diesem Land gemacht, welches er nach wie vor und jetzt erst recht als seine Heimat erleben wollte.
Doch was er sich später am Abend über die Streikkultur der weniger Privilegierten anhören musste, raubte ihm beinahe den Atem. Als er vor Jahrzehnten als Student erstmals nach dem Ende des Algerienkriegs nach Frankreich gekommen war, begann er zu begreifen, worin der Unterschied lag zwischen einem Land, das sich nach zwei Jahrzehnten Krieg aus den Zerstörungen, nicht nur den materiellen, sondern auch gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und geistigen Trümmern herauswinden und teilweise aus schrecklichster unverschuldeter Armut herausarbeiten musste und seiner Schweiz, die durch die Jahrhunderte von vielen Kriegen verschont geblieben war.
Er hatte die Wut der Leute erlebt, die um ihr kleines Auskommen kämpften. Millionen von Francs flossen täglich in die sinnlosen Kriege einer politischen Klasse von Reichen und Mächtigen und einer Kaste von Militärs, während die Menschen in unerträglichen Verhältnissen leben mussten.
Er hatte ein Zimmer in der Wohnung einer damals noch üblichen Concierge, Madame Arnaud, gefunden. Sie wusste alles über die Leute im Haus und immer wieder hämmerte sie ihm ein, wie wichtig für sie das Wort «discrétion» war.
Ihr Mann war früh an der vor allem im Winter oft durch Rauch, Russ und Nebel beinahe undurchdringlich verschmutzten Luft gestorben, erklärte sie ihm. Tausende von Cheminées wurden noch immer mit Kohle befeuert, ihr schwarzer Dreck, der über die Dächer stieg, legte sich als Mischung mit dem Staub der Strasse und dem Schmutz der Fabriken vor allem auf die östlichen Bezirke, in denen neben den Krämern und wenigen Handwerkern mehrheitlich die meist ungebildeten Armen und Unterprivilegierten der Stadt wohnten. Wer konnte, entfloh dieser Gegend, die gekennzeichnet war durch Mangel an Arbeit, Einkommen, Nahrung, Hygiene, aber auch durch verschmutzte Luft, Alkohol, Drogen und zahlreiche Krankheiten und in der Kleinkriminelle, Taschendiebe und Zuhälter, die sich auch der Ausbeutung Halbwüchsiger nicht schämten, ihr Unwesen trieben.
Es gab aber selbst dort Aus- und Aufsteiger. Edith Piaf hatte hier ihre Kindheit verbracht und versuchte, als Mädchen in den Strassen mit ihren kleinen Liedern den Lebensunterhalt zu verdienen und wurde später vor ihrem tragischen Ende zum grossen Star, der Triumphe feierte.
Der Mann der Concierge hatte es geschafft, mit ihr zusammen der üblen Entourage zu entfliehen. Er brachte es zum Hauswart in einem Haus am Rand der Wüste, am Boulevard Voltaire. Doch seine Kindheit liess ihn nicht los. Die Lunge war krank und seine Leber wurde es später auch. Irgendwann begann er zu trinken und überliess die Arbeit zunehmend seiner Frau, dem Mädchen aus der miserablen Nachbarschaft seiner Jugend. Auch sie war, vor allem in den ersten Jahren, glücklich, mit ihm zusammen dem Elend entronnen zu sein. Über Jahre hielten sie das Haus gemeinsam in Ordnung, putzten die Treppen, fingen im Keller die Ratten und Mäuse und achteten aus ihrer kleinen Loge beinahe Tag und Nacht mit der üblichen unaufdringlichen «discrétion» darauf, wer im Hause ein- und ausging. Sie hatten zwei Kinder, brave Kinder, wie Madame immer wieder betonte, die sich, längst irgendwo in der Stadt verheiratet, nie blicken liessen. Sie waren ihrem masslos trinkenden Vater und der unermüdlich schaffenden und lauthals schimpfenden Mutter entflohen.
Nach dem Tod ihres Mannes konnte sie das kleine Glück einer Concierge behalten. Alleine schaffte sie es leichter als zuvor. Selbstverständlich kürzte der Hausbesitzer ihr Gehalt, aber es reichte für sie allein noch immer und sie durfte einen Mieter einziehen lassen. Einen Mann wollte sie nicht mehr, einer hatte ihr genügt, meinte Madame.
In all den Jahren hatte sie viele Leute, meistens Familien, ein. und ausziehen sehen. Als die Sozialisten in den 30er Jahren an die Macht kamen, wurden die Mieten eingefroren und der Wohnungsmarkt reguliert. Opfer des Krieges und kinderreiche Familien wurden bevorzugt. Für viele war das ein Segen gewesen, berichtete sie. Andererseits waren die Besitzer so auch nicht mehr in der Lage, die Häuser zu unterhalten. Treppenhäuser ohne Licht mit knarrenden oder gar gefährlichen Stufen, Wohnungen mit zerschlissenen Tapeten, bröckelndem Putz, tropfenden Hähnen und zerbrochenen Scheiben waren keine Seltenheit. Tausende und Abertausende von Wohnungen hatten weder eine moderne Heizung noch warmes Wasser oder gar ein Badezimmer. Die Anlagen für Strom und Gas wurden vernachlässigt. Letztere wurden da und dort zu gefährlichen Zeitbomben. Mangels Aussicht auf eine erträgliche Rendite wurden viel zu wenig neue Wohnungen gebaut, dabei nahm die Zahl der Einwohner ständig zu. Nicht nur drängten Tausende in der Hoffnung auf Arbeit aus der Provinz in die Stadt, sondern es strömten auch immer mehr Menschen aus Frankreichs ehemaligen Kolonien, meist völlig ungebildete Farbige mit französischem Pass, ins Land.
Familien mit vier oder fünf Kindern in einer Wohnung mit zwei Zimmern waren keine Seltenheit. Für viele Paare wurde das Leben unter diesen Umständen zur Hölle, sagte Madame Arnoud und sie musste es wissen. Frauen und Kinder in Not flüchteten bisweilen in ihre Loge. Wutentbrannte Männer drohten ihr mit Fäusten. Sie erinnerte sich an hässliche Szenen, an Geschrei und Tränen, aber auch an gegenseitige Hilfe, an Krankenpflege, Lebensmittel, Kleider, Geschenke, sogar an bares Geld. Ja, bares Geld war überall Mangelware. Die Löhne waren klein, Anstellungen alles andere als sicher. Wer konnte, versuchte, das kleine Einkommen mit Überstunden oder Schwarzarbeit aufzubessern. Viele Männer hatten einen weiten Weg zur Arbeit mit Metro, Bus oder Zug hin und zurück, sie waren sechs Tage von früh bis spät unterwegs. Nur wenige Frauen fanden ein zusätzliches Einkommen. Es gab noch keine Krippen oder Ganztagsschulen. Zudem fanden die meisten Franzosen, die Frau gehöre an den Herd, Simone Beauvoir zum Trotz.
Das Leben in Paris wurde eng.
Was sollten die lohnabhängigen Leute tun, ausser wütend auf die Strasse zu gehen? Viele glaubten, nach dem Sieg über die Nazis würde sich alles ändern. Doch die Kriege gingen weiter, Stadt und Land wurden ausgezehrt. Die Wunden aus dem Ersten Weltkrieg waren kaum ausgeheilt gewesen. Durch die Misere der kleinen Leute fanden die Sozialisten und Kommunisten schon damals ihre Anhänger.
Immer wieder zogen unzufriedene wütende Pariser durch den Boulevard Voltaire von der Place de la République zur Place de la Nation. Sie kämpften für bessere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, mehr Ferientage, besseren Schutz und sichere Renten. Immer wieder prophezeiten die Patrons den Konkurs der Nation, den Zerfall der Währung und immer wieder war alles nur Umverteilung, zum grossen Teil gerechtfertigt und hinter allem Nachgeben der besitzenden Profiteure stand die Angst vor der Revolution.
Alles, was die kleinen Franzosen erreichten, mussten sie ertrotzen, hatten sie sich erkämpft durch Protest, durch die Empörung, den Aufstand auf der Strasse. Das war so seit der grossen Revolution gewesen, die nicht nur Frankreich, sondern die gesamte Welt verändert hatte. Niemals würden sich die aufgebrachten Menschen dieses Landes die letzte Möglichkeit, ihr Recht zu ertrotzen, aus den Händen winden lassen.
Das alles erzählte damals die 60-jährige Concierge dem jungen Studenten André. Es fiel ihm nicht leicht, die in der Schweiz eingeübten Floskeln über Arbeitsfrieden und die rabiaten Feindbilder des Kommunismus zu relativieren. Madame war Kommunistin, ohne Zweifel. Nicht de Gaulle, der hockte in London, gut beschützt, sie verurteilte ihn deswegen nicht, seine Mission war auch wichtig, aber die Kommunisten hatten ihrer Meinung nach das Land im Untergrund als Résistance gegen die Nazis verteidigt. Proletarier wie der 19-jährige Pierre Georges, nach dem Krieg als Held gefeierter Colonel Fabian, hatten zu Tausenden im Untergrund unter Einsatz ihres Lebens gegen die Nazihorden gekämpft, während die bessere Gesellschaft versuchte, mit dem Feind Geschäfte zu machen, sich ein Heer von Beamten an der Verschleppung der Juden beteiligte und vor den Gräueln der Besatzer die Augen schloss.
Ja, natürlich hatten die Amerikaner den Krieg gewonnen, Frankreich den Franzosen zurückgebracht, aber nicht allein und vor allem nicht dem Lande zuliebe, sondern um ihre Weltherrschaft auszubauen, den Weltkommunismus zu bekämpfen, ihr Coca-Cola zu verkaufen. Hatten die Amerikaner nicht auf ihrem Zug gegen Osten den Rest der noch intakten Infrastruktur und die noch vorhandenen Industrieanlagen Frankreichs zerstört? Das behauptete Madame Arnoud, daran duldete sie keinen Zweifel.
Sie sprach ein für ihre Herkunft erstaunlich gutes Französisch. André liebte es, am Abend in ihrer Loge zu sitzen und ihr zuzuhören. Durch die Jahrzehnte hatte sie eine Unmenge Bücher gelesen. Die Bücher, sagte sie, hätten ihr geholfen, neben dem Trunkenbold zu überleben.
André versuchte nicht, ihre Weltsicht in Frage zu stellen, er fühlte sich als ihr Gast. Die Geschichte Frankreichs war bisher nicht seine Spezialität gewesen. Ihn hatte in der Mittelschule die italienische Renaissance fasziniert und erst nach den Monaten in Paris wechselte er die Richtung.
Zudem hatte Madame Arnaud seit kurzem einen Fernseher, der ständig lief. Vor zwei Jahren erst, erinnerte sie ihn, war der grosse General als erster Mann der Republik zurückgekommen. De Gaulle, obwohl kein Freund der Kommunisten, würde vielleicht dem Volk, so hoffte sie, den Stolz zurückgeben und endlich den Krieg in Algerien beenden. Er werde den Sozialisten und Kommunisten Konzessionen machen, davon war sie überzeugt.
Anfänglich glaubte André, Madame Arnoud sei gewissermassen die Repräsentantin der älteren Generation und gäbe kaum die Stimmung einer Mehrheit wieder. Zunehmend musste er jedoch zur Kenntnis nehmen, wie sehr auch die Kommilitonen an der Sorbonne und anderen Hochschulen einer sozialistischen, wenn nicht gar kommunistischen Weltsicht anhingen. Ideologisch nicht weit entfernt bewegten sich auch die Meinungsmacher des Lehrkörpers. Für André war das alles sehr erstaunlich.
Andererseits erlebte er selbst, unter welch armseligen Verhältnissen viele seiner Kommilitonen lebten. Es gab sie durchaus, die «Fils à papa», die Blousons noir aus vermögenden Familien, doch das war nicht die Regel. Nicht nur im privaten Bereich mangelte es an allen Ecken und Enden. Auch die Einrichtungen in den Hörsälen liessen viele Wünsche offen, sie waren veraltet, ungenügend unterhalten, zum Teil schäbig bis unbrauchbar und vor allem im Winter wurde völlig ungenügend geheizt.
Er hatte bisher in einem Land gelebt, in dem alles, was nur leicht nach «roten Ideen» aussah, aufs Schärfste verurteilt und zurückgewiesen worden war. Wirkliche oder vermeintliche Sympathisanten, die nach Ostdeutschland oder Russland reisten, wurden nach ihrer Rückkehr ausgegrenzt und ab und zu gar verprügelt. Hier in Frankreich und besonders in Paris gab es durchaus beide Lager, die sich auch nichts schenkten, doch stellten die linken Parteien eine einflussreiche und ernst zu nehmende Macht dar, die, auch wenn eine labile Mehrheit sie noch immer ablehnte, in ihrem Kern als patriotisch und rechtschaffen galt. Es gab das Lager der Stalinisten, der Moskauhörigen, aber es gab auch die Ami-Hörigen. Beide waren blind auf einem Auge, meinte Madame Arnoud trocken, wenn André sie auf die blinde Seite ihrer Sicht aufmerksam machte.
In den Kinos wurden Filme aus der Sowjetunion nicht nur gezeigt, sondern öffentlich gepriesen. André ging hin, mit grosser Skepsis, in Erwartung reiner Propaganda und war beinahe irritiert über die völlig unpolitische Handlung der Geschichte, einer Liebe in der riesigen Kornebene der Wolga, wie sie sich in irgendeinem Land hätte zutragen können, eine Art Romeo und Julia auf dem Land, die tragisch endete. André war gerührt, er hätte beinahe geheult und das wegen eines Filmes aus der Sowjetunion.
Viele Jahre später, als er mit Miriam in eine gemeinsame Pariser Wohnung zog, war auch der letzte Krieg längst überwunden, die Denkmäler, Paläste, Kirchen und Häuser der Stadt vom klebrigen Russ befreit. Im Westen der Stadt war ein neues modernes Zentrum entstanden. Die Caravelle, der zweistrahlige Jet, war zu einem grossen Geschäft geworden. Frankreich war wieder da, wie es sich Madame Arnoud gewünscht hatte.
Noch mehr aber musste sie sich 1968 über den Aufstand der französischen Jugend gefreut haben. Was die eigentlich wollte, wusste niemand so genau, aber sie zertrümmerte festgefahrene Strukturen, befreite sich aus der Enge straffer Gewohnheiten und der Zucht autoritärer Würdenträger in allen Bereichen. Neue und bessere Luft sollte in die Hörsäle, Amtsstuben und Fabriken strömen.
Viele der Aufrührer, vor allem im Bereich der studierenden Jugend, übernahmen Ideen der Befreiung aus Amerika. Dort richteten sie sich gegen die intolerante Sturheit der festgefahrenen etablierten Kasten, die Rassendiskriminierung. Sie sahen in ihnen den Verrat der Ideen von John F. Kennedy und als Folge den schwachsinnigen Krieg in Vietnam.
Im Elyséepalast hielt Pompidou Hof. Doch der Alltag der lohnabhängigen Menschen blieb nach wie vor ein sehr bescheidener. André und Miriam lebten in einem älteren Haus im 18. Arrondissement. Ihre Wohnung mit zwei Zimmern und einer kleinen Küche ohne Bad und Terrasse lag im sechsten von acht Stockwerken ohne Aufzug. Sie waren jung, Treppensteigen war gesund, mit einem Bébé war es schon ein wenig beschwerlicher, für ältere Leute eine Qual. Um ihrem Bedürfnis nach Sauberkeit zu folgen, besuchten sie zweimal die Woche die öffentlichen Duschen, wie beinahe alle Leute im Quartier.
Sie kamen damit zurecht, aber für ihn war das alles sehr eng. Ab und zu verwünschte er dieses «Loch», wie er es nannte. Als dann die erste Tochter zur Welt kam, wurde alles noch schwieriger, nicht nur wegen der Enge, sondern auch, weil Miriam nur noch wenig arbeiten konnte und er selbst bisher keine feste Anstellung gefunden hatte. An einen Umzug war jetzt noch weniger zu denken als zuvor. Wenn Miriams Eltern nicht immer wieder geholfen hätten, wäre das Leben sehr schwierig geworden. Nie bat er seine Mutter oder seine Geschwister um Hilfe. Sie hätten ihm mit Sicherheit vorgeschlagen, die Zelte in Paris abzubrechen und mit seiner kleinen Familie in die Schweiz zurückzukehren. Das wollte Miriam nicht und das wollte er nicht. Die beiden hatten darüber nicht wirklich Streit, aber ihre Beziehung nahm Schaden. Es blieb nichts übrig für ihre kulturellen Ansprüche und auch nicht für die Pflege ihrer bisherigen Freundschaften. André befürchtete so etwas wie einen sozialen Abstieg. Er hielt sich und seine Situation für bedauernswert.
Die manchmal beinahe zerbrechlich wirkende Miriam fand sich damit besser ab. Sie war weniger verwöhnt, obwohl sie ihre Jugend ausserhalb der Stadt mit mehr Freiraum verbracht hatte. Sie lernte entgegen gängiger Klischees über die Einwohner dieser Stadt die Leute von nebenan kennen, wusste, wer über und unter ihnen wohnte. Sie wurde gewahr, wovon die Leute lebten und welche grösseren und kleineren Sorgen sie allenfalls haben mochten. Natürlich wusste sie vieles nicht genau, sie wollte es auch nicht absichtlich ergründen.
Unter ihnen wohnte Madame Janvier, eine ältere Dame, deren Mann auf dem Schlachtfeld von Verdun im Ersten Weltkrieg gefallen war. Sie waren ein Jahr verheiratet gewesen, als er – für ein paar Tage oder höchstens wenige Wochen – eingezogen wurde. Sie sah ihn zum letzten Mal auf dem Bahnsteig des Gare de l’Est, winkte ihm nach und weinte, denn sie erwartete ihr erstes Bébé. Schon damals lebte sie im gleichen Haus, erhielt als Soldatenwitwe mit Kind eine Rente und arbeitete als Verkäuferin in der Samaritaine, während ihre eigene bereits betagte Mutter, im Gegensatz zum Vater von der grossen Grippe verschont, zu ihr zog und das Mädchen hütete.
Die ersten Jahre nach dem Krieg waren in der Erinnerung von Mutter und Tochter trotz aller Trauer gute Jahre gewesen. Irgendwelche geerbte Aktien trugen mit ihren Dividenden zum Unterhalt bei. Doch mit dem Zusammenbruch der Banken und dem Zerfall der Währung in den 30er Jahren waren die Aktien nicht einmal mehr ihr Papier wert, die ohnehin nicht üppige Rente verkam zur Lächerlichkeit. Die Samaritaine entliess einen grossen Teil der Angestellten, nicht zuletzt jene, die durch eine Rente privilegiert waren. Auch das alltägliche bescheidene Essen wurde zum Luxus. Die Grossmutter starb nicht nur an ihrem Alter, sondern einer zermürbenden depressiven Verzweiflung. Madame Janvier und das inzwischen pubertierende Mädchen blieben ohne grosse Hoffnung auf ein besseres Leben zurück.
Trotz des angeblich gewonnenen Krieges, den die Franzosen nicht angezettelt hatten, breiteten sich in Frankreich Armut und Not aus. Die Sozialisten kamen an die Macht, verstaatlichten die Industrie und versuchten mit ihren Methoden, die Verhältnisse zu verbessern. Die Mieten wurden eingefroren. Dank ihres Status› als Kriegswitwe und ihrer Tochter konnte Madame Janvier in der Wohnung bleiben. Ihre Rente wurde aufgebessert und sie fand wieder Arbeit. Die Tochter wurde Verkäuferin in einer Apotheke und verliebte sich in einen jungen Mann aus dem Quartier. Sie waren beide 23, als die deutsche Wehrmacht über Frankreich herfiel und seine Armeen vor sich her gegen Westen trieb. Das Land war auf diesen Krieg nicht vorbereitet.
Ja, das war eine Schande, grübelte André in seiner Einsamkeit an diesem Abend nach der Generalversammlung der Segler. Die Erinnerungen trieben weiter.
Madame Janviers Schwiegersohn war in Dünkirchen bei der Übersetzung der französischen Restarmee nach Grossbritannien ertrunken, die Tochter starb während der deutschen Besatzung an Diphtherie. Es gab in dieser Zeit für die Zivilbevölkerung kaum Medikamente. Madame Janvier konnte nach der Befreiung der Stadt in der Wohnung bleiben, weil sie bereit war, Flüchtlinge und Obdachlose aufzunehmen. Auch dafür bekam sie vom Staat eine Unterstützung. Der Staat half überall, wo Not sichtbar wurde und letztlich immer auf Kosten der Währung. Der Franc blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf Talfahrt.
Als die Flüchtlingswelle vorbei war, vermietete Madame Janvier weiterhin ihr zweites Zimmer und fristete so ein einigermassen erträgliches kleines Leben.
Als André und Miriam über ihr einzogen, war sie bereits ziemlich gebrechlich. Die fünf Treppen wurden zur Qual. Man begegnete sich ab und zu im Treppenhaus und Miriam bot ihr an, wenn sie ohnehin Einkäufe machte, ihr den einen oder anderen Gang zu ersparen. Madame andererseits hütete ab und zu ihre erstgeborene Tochter Corinne. Sie wurde mit ihren über achtzig Jahren so etwas wie eine zweite Grossmutter. Der Kleinen erzählte sie Kindergeschichten und den Eltern ihr eigenes Leben. Madame Janvier starb nach einer Gallensteinoperation in einem Erholungsheim in Rambouillet. Sie hatte keine Angehörigen in Paris, Freundinnen und Bekannte aus ihren aktiven Jahren waren längst gestorben. Ausser ein paar Leuten aus dem Haus kam niemand zum Begräbnis auf dem Cimetière de Montmartre. Corinne war sehr traurig, dass es Madame nicht mehr gab und für Miriam war mit ihr das alte Frankreich gestorben. Im neuen Frankreich trank man Cola, ass Pizza und Spaghetti und es gab McDonalds. Anglizismen hatten Einzug gehalten. Aus der Cassecroute war ein Sandwich geworden, aus der Revue eine Show – grässlich.
Zum Begräbnis von Madame Janvier war ebenfalls das Paar von nebenan gekommen. Sie waren etwas älter als André und Miriam und lebten mit ihren drei Kindern schon länger in der Wohnung mit drei Zimmern. Das war für jene Jahre ganz komfortabel. Grössere Wohnungen waren noch immer Mangelware und daher meistens unverhältnismässig teuer.
Der Mann, ein angelernter Elektrozeichner, arbeitete anfänglich als Ingenieur in den Laboren für Nukleartechnik von Châtillon im Süden der Stadt. Den Job verdankte er seiner Dienstzeit als Soldat in Deutschland und Algerien, er liess ihm genügend Zeit für eine Ausbildung zum Elektroingenieur an einer Abend- und Wochenendschule. Nach seinem Abschluss, als das Paar sein erstes Kind erwartete, wechselte er in eine private Installationsfirma, weil er da bis zu sechzig Stunden die Woche arbeiten konnte und durch die Überstunden auf ein weit höheres Einkommen kam.
Was für Jean-Noël und seine Frau so etwas wie Komfort und besseres Leben bedeutete, war für Hunderttausende von Arbeitern die einzige Möglichkeit, um über die Runden zu kommen.
Jean-Noël erzählte von seinen Erfahrungen in der Armee. 24 Monate hatte er dort verbracht, 18 waren in jenen Jahren die obligatorische Dienstzeit, sechs davon in Deutschland, die übrigen in Algerien. Er hatte durch die verlängerte Dienstzeit die kleine Karriere eines Adjutanten geschafft. Nein, er habe niemanden getötet, Glück gehabt, doch einige seiner Kameraden waren umgekommen oder mussten mit der Last, Leben vernichtet zu haben, weiterleben. Bei weitem nicht allen war es gelungen, sich danach im zivilen Leben wieder zurechtzufinden, sich eine materielle Basis zu schaffen, zu heiraten und ein sogenanntes normales Leben zu führen. Es gab Schwerverletzte an Körper, Geist und Seele, viele blieben arbeitslos, waren ge- oder zerbrochen.
Das Paar kam aus dem Limousin und es dauerte eine Weile, bis Jean-Noël sich dazu überwinden konnte, seinen Geburtsort zu nennen, denn das alte Dorf Oradour gab es nicht mehr. Seine Grosseltern, seine Mutter und seine beiden Brüder waren mit allen Einwohnern von einer SS-Truppe in die Kirche getrieben, das Dorf in Trümmer gelegt und die Kirche angezündet worden. Nur Wenige überlebten die grauenhafte Tragödie, weil sie zufällig nicht im Ort waren, als das geschah.
Eine Tante hatte Jean-Noël für ein paar Tage nach Limoges mitgenommen, um seiner Mutter etwas Erholung zu verschaffen. Diese versuchte, sich und ihre drei Buben so gut es ging durchzubringen. Es gab im Ort ausser Hilfeleistungen an Alten und Gebrechlichen, Putzen und Waschen keine Arbeit und kein Einkommen von irgendwoher. Die Grosseltern im gleichen Haus bedurften selbst der Pflege. Aber wenigstens gehörte ihnen das Haus und es gab einen Garten mit etwas Gemüse. Das Leben unter der Besatzung war zermürbend. Jean-Noëls Vater kämpfte in der Résistance. Immer wieder wurde nach ihm gesucht, letztlich wurde er verraten, aufgegriffen, erhängt und später auf einer Gedenktafel als Held gefeiert. Davon konnte man nicht leben. Überall war Armut, war Hunger. Nach der Zerstörung Oradours war Jean-Noël Waise, er hatte auch seine zwei Brüder verloren und konnte bei der Tante in Limoges bleiben.
Nur langsam erholte sich die Wirtschaft im Limousin. Für das berühmte Porzellan aus Limoges gab es wenig Nachfrage. Kaum besserte sich die Lage ein wenig, da zehrte Indochina an der Substanz. Keiner im Volk wollte diesen Krieg gegen die Menschen in Vietnam, Laos und Kambodscha.
Als die französische Armee einbrach, sprangen die Amerikaner ebenso erfolglos in die Bresche. Das etablierte Frankreich versuchte sich inzwischen mit enormem Aufwand auf Kosten der Wohlfahrt im eigenen Land in Nordafrika festzukrallen.
Drei Generationen von Männern und Frauen waren geprägt von diesen auszehrenden Weltkriegen, der Schlächterei in Indochina und zuletzt diesem Befreiungskrieg der Algerier. Sie bekamen ihren Marschbefehl oder trugen im Land die traurigen Folgen. Es war nicht nur vaterländische Pflicht, dem Befehl zu folgen, sondern Verrat, es nicht zu tun. Die Wehrpflicht der Bürger war seit der französischen Revolution für alle Nationen des durch die Jahrhunderte geschundenen Kontinents zur Regel geworden. Nur die Sozialisten und Kommunisten rannten schon seit der Jahrhundertwende dagegen an. Für alle anderen war Krieg eine unvermeidliche Realität, ein grosses Geschäft und für viele die Basis einer kleinen oder grossen Karriere.
Frankreichs Bevölkerung war ausgeblutet, durch die Niederlagen gedemütigt, politisch zermürbt und wirtschaftlich ruiniert, daher strömten Millionen französischer Bürgerinnen und Bürger in die kommunistische Partei. Nur so glaubten sie, zu ihrem Recht und zu einem erträglichen Leben zu finden. Viele waren keine wirklichen Kommunisten, schon gar nicht von Moskaus Gnaden.
Gewalt war das letzte Mittel, meistens entzündete sie sich an Hitzköpfen, Fanatikern oder auch nur Radaubrüdern. Das war in der Schweiz, beispielsweise in Zürich oder Bern, nicht anders, doch die Grösse des Raumes und die Zahl der Menschen vor allem in Paris waren unvergleichbar, stellte André fest.
Was den verwöhnten und eingebildeten Spiessern des Schmauchtals als unpassend oder gar verwerflich erschien, war für Frankreichs Menschen nach Jahrhunderten der Unterdrückung durch Bonzen und Pfaffen eine hart erkämpfte, stolze und unantastbare Tradition.
Jean-Noëls Frau Veronique war gelernte Krankenschwester. Ihr Vater war beim Überfall der Deutschen an der belgischen Grenze in Gefangenschaft geraten und im Lager an einer Lungenentzündung gestorben. Ihre Mutter und Jean-Noëls Tante waren Nachbarinnen und so kannten sich die beiden schon als Kinder. Nach Jean-Noëls Dienstzeit heirateten sie und zogen nach Paris, weil er dort Arbeit fand und diese zudem weit besser bezahlt war als in der Provinz.
Trotz ihrer drei Kinder hatte Veronique diese Arbeit nie ganz aufgegeben. Sie übernahm noch immer aushilfsweise Nachtwachen und Stellvertretung an Wochenenden im nahen Hôpital Bichat. Jean-Noël hütete derweil die Kinder, fütterte sie, ging mit ihnen auf den Spielplatz im nahen Park und brachte sie abends zu Bett.
Viel anderes gab es nicht ausser einer Gruppe für die Tänze und Lieder des Limousin. Einmal die Woche trafen sie sich, sangen und tanzten. Veronique und Jean-Noël lösten sich ab: Einmal sie, einmal er.
Die beiden sparten. Irgendwann würden sie den Moloch Paris verlassen, nach Limoges ziehen, dort eine Wohnung kaufen oder gar ein Haus bauen und ein Ingenieurbüro für elektrische Anlagen eröffnen.
Obwohl sie eigentlich in verschiedenen Welten lebten, wurden und blieben Veronique und Miriam Freundinnen, auch als das Paar mit ihren Kindern wirklich nach Limoges gezogen war.
Etwa zur gleichen Zeit fanden und kauften auch André und Miriam eine grössere Wohnung mit Terrasse in einem neuen Haus mit Aufzug auf der Buttes Chaumont mit Sicht auf den romantischen Park und die ganze Stadt, nicht weit von den Schulen, in denen sie unterrichteten. Die beiden Mädchen waren jetzt acht und zehn Jahre alt. Der Auszug aus der Enge war eine Erlösung für alle. Dennoch wusste André von den Hunderttausenden, die diesen Komfort nie schafften, obwohl sie jahrein und jahraus ihre ganze Kraft in ihre Arbeit investierten.
André blieb nüchtern, denn auch in der Schweiz gab es schwierige Schicksale. Mit solchen Geschichten, das wusste er, setzte er sich der Lächerlichkeit aus. Es war unmöglich, seine Erfahrung zu übertragen. Die Schmauchtaler würden die hunderttausendfache Wiederholung dieser und ähnlicher Schicksale, die Tragödien in der Geschichte der Grande Nation nie verstehen. Mehr noch, nicht nur dieser Nation, sondern aller europäischen Nationen, dieses endlose Elend permanenter Kriege durch alle Jahrhunderte.
Wie war es möglich, dass die Menschen in diesem kleinen Land der Seen und Berge am gemeinsamen Aufbruch zu einem Kontinent des Friedens, der Demokratie und der Wohlfahrt nicht nur nicht teilnehmen wollten, sondern nur mit Hohn und Spott darüber redeten?
Da rühmten sich die Menschen ihrer vier Kulturen und Sprachen und ignorierten die Chance eines Europas der zwei Dutzend Kulturen und Sprachen. Frankreich hatte in den vergangenen Jahrhunderten die lokalen Idiome der Bretagne, des Elsass’ und von Korsika unterdrückt und erst mit dem Bekenntnis zu den Freiheiten der Union zugelassen. Untergegangen waren auch die Diktaturen von Spanien und Portugal, wurde letztlich auch jene in Serbien zerschmettert durch das immer wieder geschmähte Amerika, aber ohne die Europäische Union wäre dieser Eingriff kaum politisch machbar gewesen. Ausser Serbien hatten alle osteuropäischen Länder mit gemeinsamer Grenze oder Nähe zur Union nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion echte Demokratien eingerichtet. Nicht auszudenken, wenn sich da Diktatoren wie in den meisten anderen Ruinen der kommunistischen Welt etabliert hätten, mit Sicherheit wäre der Balkankrieg nicht der Einzige geblieben!