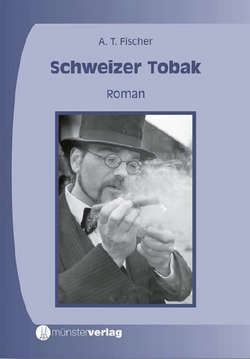Читать книгу Schweizer Tobak - Albert T. Fischer - Страница 13
André Werths Heimat
ОглавлениеAndré war einer jener Studenten, die im feuchtfröhlichen Überschwang die Region mit all ihren vergangenen Tabakfabriken in und um Wirrwil Schmauchtal getauft hatten. Er war wohl der Einzige, der diese Erfindung nicht vergass.
Er selbst war auf den Namen Andreas getauft worden. Der Schweizer Bürger mit süddeutschen Wurzeln, in Wirrwil aufgewachsen, wurde als junger Mann Sekundarschullehrer für Deutsch, Französisch und Geschichte. Während seines Studiums verbrachte er mehrere Monate in Frankreich, um sein Französisch zu vertiefen und alltagstauglich zu machen. Er dachte jedoch nie daran, sein Leben dort zu verbringen, liess sich von da an aber trotzdem André rufen. Er begann seine Zeit als Lehrer in Bern, beinahe unberührt vom Aufbruch der jungen Leute in den späten 60er Jahren. Bern bekam in jenen Jahren einen neuen Bahnhof und im Bundeshaus ärgerten sich die etablierten Politiker über die revoltierende Jugend.
André hatte in der Stadt ein gutes Netzwerk aus Kolleginnen und Kollegen, Freunden und Freundinnen. Sein ohnehin ansehnliches Einkommen rundete er zusätzlich stundenweise in Privatschulen auf. Er hatte ein gutes Leben, trotzdem …
Mit 28 Jahren lernte er in einer seiner Klassen die 18-jährige Französin Miriam kennen, eine junge Musikerin, die einen Jahreskurs am Berner Konservatorium belegte und bei André ihr noch sehr fragiles Deutsch aufbessern wollte. Zu seiner eigenen Bestürzung, wie er später immer wiederholte, glaubte er, ohne sie nicht leben zu können. Er folgte ihr nach Versailles, wo ihre Eltern lebten und weiter nach Paris, wo sie zusammenzogen, fand dort anfänglich an verschiedenen privaten Instituten stundenweise Anstellungen als Deutschlehrer und machte sich damit vertraut, dort zu bleiben. André und Miriam heirateten und bekamen zwei Kinder.
Die Weltstadt lebte in Aufbruchstimmung, der Algerienkrieg war längst überwunden und de Gaulle zog sich nach Colombey-les-deux-Eglises zurück. Paris begann die Zukunft zu planen. Es entstanden das von vielen Franzosen geschmähte Centre Pompidou, im Vorort Défense die französische Version von Lower Manhattan, an Stelle der fehlgeplanten Schlachthöfe Park und Museum der Villette und schliesslich der neue Bahnhof Montparnasse. Zwischen Paris und Marseille wurde die erste TGV-Linie geplant und gebaut.
Im Lauf der Jahre schaffte André den nicht einfachen Zugang zu Pensa in staatlichen Mittel- und Hochschulen, nicht im Hauptfach Germanistik, sondern vorwiegend für angehende Ingenieure, Chemiker, Biologen, Mathematiker, Physiker und so weiter, die sich mit Deutschkenntnissen bessere Start- oder Karrieremöglichkeiten versprachen.
Allerdings blieb Deutsch trotz der von de Gaulle und Adenauer durch den Freundschaftsvertrag vorangetriebenen Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich für die meisten Franzosen eine wenig beliebte Fremdsprache. So musste André über Jahre immer wieder um sein Budget bangen und kämpfen. Andererseits wollte ihm niemand seine Jobs streitig machen. Es gab kaum kompetentere Anwärter für dieses Fach auf seiner Stufe. Immerhin entwickelte sich sein Einkommen zwar nie überwältigend, aber durchaus ansehnlich.
In der Schweiz hätte er weit mehr verdient. Doch Miriam verdiente als Musiklehrerin an einem Lyzeum und mit stundenweise Privatunterricht meist so viel oder gar mehr wie er, trat in wechselnden Orchestern auf und brachte es da und dort gar zur ersten Violinistin mit bescheidener Gage. Sie war überzeugt, in der Schweiz keine Chance zu haben und konnte sich ein Leben in diesem kleinen Land schlicht nicht vorstellen.
Ihre Kinder, die beiden Mädchen Corinne und Nadine, fuhren hin und wieder zur Grossmutter in die Schweiz, lernten jedoch zum Leidwesen des Vaters nur ein sehr oberflächliches Deutsch. Sie fanden die Sprache kompliziert, Papas Vorhaltungen «déplacé» und das Schweizerdeutsch sorgte zusätzlich für Verwirrung, meinten sie, als sie grösser wurden. Andere Kontakte gab es nicht sehr viele. Zwar gab es eine grosse Sympathie von Andrés Mutter Irma Miriam gegenüber, doch mehr als einmal pro Jahr sah man sich nicht.
Um das Jahr 2000 wanderte die ältere Tochter mit ihrem Freund nach Kanada aus und die jüngere heiratete einen Ingenieur, der in Toulouse für den Airbus arbeitete, mit dem sie in den Süden Frankreichs zog.
Ein Jahr danach hatte Miriam ihren Mann endgültig zur Scheidung gedrängt. Die beiden hatten über viele Jahre eine mehr oder weniger liebevolle, später eine eher emotionslose, aber weitgehend spannungsfreie und zuletzt eine ziemlich gleichgültige Ehe geführt, obwohl sie sich, wie er glaubte, nie ganz aufgaben.
Mit dem endgültigen Weggang der Töchter sah Miriam keine Zukunft mehr in dem doch ziemlich oberflächlich gewordenen gemeinsamen Leben, zudem – sie war kaum 50. Zehn Jahre Altersunterschied machten sich für sie mehr und mehr bemerkbar. Sie konnte sich einen Mann, der in wenigen Jahren zu Hause sass, während sie arbeitete, nicht vorstellen. Auf ihr Drängen hin verkaufte er ihr seinen Anteil an der Wohnung und mietete sich eine bescheidene Bleibe. Miriam war zwar nicht reich, aber ihre Eltern hatten der einzigen Tochter ein ansehnliches Erbe hinterlassen. Miriam sah in all dem die Chance zu einem Neuanfang für ihre letzten aktiven Jahre und, so meinte sie etwas herablassend, vielleicht auch für ihn. Er besass jetzt etwas Geld, mit dem er sich ein neues Leben einrichten sollte, fand sie.
2003, ein Jahr nach der offiziellen Scheidung, starb Andrés Mutter in der Schweiz im Schmauchtaler Altenheim. Obwohl sie ihr Haus, in dem sie ihr Leben verbracht hatte, nicht mehr bewohnen konnte, hatte sie sich geweigert, es zu verkaufen. Andrés älterer Bruder Konrad war vor Jahren in Brasilien umgekommen und die kinderlose Schwester Elisabeth, die älteste der drei Geschwister, seit einigen Jahren Witwe, wohnte im Haus in München, in dem sie mit ihrem nach einem schweren Krebsleiden verstorbenen Mann ihr Leben verbracht hatte, sie war am Elternhaus nicht interessiert.
Seit dem Begräbnis seiner Mutter spielte André mit dem Gedanken, seine Jahre als Rentner in der Schweiz zu verbringen. Eigentlich hielt ihn in Paris nichts mehr wirklich zurück. Er hatte viele Kollegen, vielleicht auch Freunde, ihm gefielen die Stadt, das Gefühl von Freiheit und das unermüdlich pulsierende Leben in ihr, doch fühlte er sich nicht als Franzose. Frankreich war nicht seine Heimat. Seine Heimat waren der See und die Dörfer seiner Kindheit.
Am 6. Juni 2004, an seinem 60. Geburtstag, bereiteten ihm seine Studentinnen, Studenten, Kolleginnen und Kollegen einen beinahe rührenden Abschied. Hätte er nicht schon alles in die Wege geleitet, er würde vielleicht gezögert haben, nur wenige Tage danach wegzufahren. Der Leiter des Instituts hielt eine kurze Rede, in der er die Brücke zu den grossen Feierlichkeiten in Erinnerung an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 60 Jahren und seinem Geburtstag schlug und meinte, auch André habe einen grossen Beitrag zur Überwindung der Feindschaft und Vernarbung der Wunden zwischen Deutschland und Frankreich geleistet. André selbst hatte diesen Zufall nie übersehen, ihn aber nie zum Anlass genommen, darüber zu reden.
Er verliess die Stadt nicht ganz ohne Wehmut. Hunderten, eher Tausenden von jungen Leuten hatte er während rund 30 Jahren mit mehr oder weniger Erfolg seine Muttersprache zu vermitteln versucht, ihnen von einer für sie fremden Kultur erzählt, über die elenden Kriege gesprochen, die Deutschland und Frankreich immer wieder entzweit und auch in fast allen Ländern Europas unaufhörlich jeder Generation alles zerstört hatten. Er hatte versucht, ihnen die grosse Idee von Europa als Friedensprojekt verständlich zu machen und sie dafür zu begeistern. Er hatte mit ihnen geistige Streifzüge durch Geschichte, Völker, Bücher, Bilder und Landschaften dieses Kontinents unternommen, während er auch Rechtschreibung, Interpunktion, Grammatik und Semantik vermittelte, unregelmässige Verben und Flexionen paukte, in einem Land, in dem diese Sprache nicht zu den beliebtesten zählte. Zugegeben, er konnte wenig tun, aber das Wenige hatte er getan. Viele dieser jungen Leute schrieben ihm auch nach 20 und mehr Jahren Grusskarten zu Weihnachten und Neujahr.
Andererseits wurde ihm durch die Trennung und Scheidung von Miriam erst bewusst, wie wenig Menschen in diesem Land zu seinen Freunden zählten. Es gab Dutzende wunderbarer Kollegen und Kolleginnen, gute Bekannte im Haus, in dem sie durch all die Jahre gelebt hatten, doch Letztere waren alle keine Freunde, mindestens nicht seine Freunde, wenn schon, standen sie eher Miriam nahe. Das war für ihn eine bisweilen traurige Einsicht, und sie beförderte seine Idee, das Land zu verlassen. Vielleicht war es auch seine noch immer spürbare Fremdheit gewesen, die Miriam letztlich bewogen hatte, die Scheidung zu suchen.
Es half ihm nichts, wenn Miriam ihm vorhielt, sein Fremdsein sei allein seine Schuld, er hätte sich eben um Freundschaften zu wenig bemüht. Er konnte dies nicht nachvollziehen. Für ihn gab es, vermutlich durch seine Herkunft und letztlich trotz aller flüssigen Beherrschung auch durch die Sprache so etwas wie einen Graben. Dieser Graben trat immer wieder hervor, wenn von Deutschland oder von Europa die Rede war. Es half nichts, wenn er hin und wieder darauf hinwies, Schweizer zu sein. Die jungen Leute hatten ohnehin die Idee, «la Suisse» sei etwas Französisches und die Deutschschweiz so etwas wie ein Anhängsel, ein Unikum – négligeable. Er liebte Frankreich, vor allem Paris und seine Menschen, und wurde dennoch kein Franzose. Er kannte die Geschichte der Aufklärung und der französischen Revolution durch sein Studium besser und vertiefter als mehr oder weniger alle Leute seiner täglichen Umwelt, dennoch oder gerade deswegen blieben die Menschen dieses Landes – ausser seinen Studenten – auf einer durchaus respektvollen, von ihm jedoch oft bedauerten Distanz.
Ausser seinen vielen Büchern, ein paar Bildern und wenigen Dingen, die ihm durch die Jahrzehnte teuer geworden waren, liess er alles hinter sich. Die Möbel übernahmen die neuen, noch jungen Mieter seiner letzten bescheidenen Bleibe.
Er zog in das Haus, das seine Grosseltern gekauft hatten, als sie 1938 aus Deutschland zurück in die Schweiz kamen. André konnte sich im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht an seinen Grossvater erinnern, der im März 1945 kurz vor Hitlers Untergang gestorben war. Da war er neun Monate alt gewesen. Auch von seinem Vater wusste André nur, dass dieser kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner in München durch ein sogenanntes Volksgericht zum Tode verurteilt und unmittelbar danach erschossen wurde. Als Jugendlicher hatte ihn all das nur am Rand interessiert. Doch jetzt hatte ihn eine gewisse Neugier erfasst und er begann, Fotos aus seiner Jugend und seiner damaligen Umgebung zu suchen.
Mit seinen Geschwistern hatte André, seit er in Frankreich lebte, wenig Kontakt gehabt. Als er noch zur Schule ging, arbeitete seine neun Jahre ältere Schwester in den 50er Jahren als begeisterte Freundin Israels in einem Kibbuz. Dort lernte sie einen jungen deutschen Archäologen kennen, der als Idealist im Hinblick auf die schreckliche deutsche Vergangenheit etwas zur Versöhnung mit den Juden tun wollte. Sie lebte in den Zeiten Gamal Abdel Nassers vor dem «Krieg der sieben Tage» in Kairo, und später, inzwischen verheiratet, in Deutschland in der Nähe von München, nicht weit von dem Ort, an dem ihre Eltern gewohnt hatten, als sie klein gewesen war. Sie war lange den Spuren ihres Vaters nachgegangen, hatte sich darüber aber nie verbreitet. Das nicht nur, weil sie niemand danach gefragt, sondern auch, weil ihre Mutter bis zu ihrem Tod mit ihrer Geschichte gehadert hatte. Sie sollte ihren Frieden finden, fand Elisabeth.
Während André seinen «grossen» Bruder in gewisser Weise bewunderte, hatte er zu seiner Schwester damals eher ein gespaltenes Verhältnis gehabt. Sie behandelte ihn wie Mutter und Grossmutter, dabei war sie doch nur die Schwester. Ihretwegen musste er die Schuhe ausziehen, die Hände waschen, Klavier spielen, Schulaufgaben machen, er durfte am Tisch das Messer nicht in den Mund nehmen, nicht mit vollem Mund reden, hinter dem Hühnerstall kein Feuer machen und so weiter … Nicht einmal kühles Wasser aus Brunnenröhren durfte er trinken, ohne dass sie ihn kritisierte.
Dabei hatte sie angeblich in der Schule immer die besten Noten gehabt, war ins Gymnasium gegangen, konnte Orgel spielen und war doch so unaussprechlich dumm!
Später revidierte er sein Urteil stark, aber wirklich kennen gelernt hatte er seine Schwester nie, wie er Miriam sagte. «Vielleicht war sie wie du und ich habe dich als Zeichen der Versöhnung geheiratet», verstieg er sich Miriam gegenüber. Miriam fand die Idee nicht lustig.
Konrad, Andrés um sieben Jahre älterer Bruder, machte eine Lehre bei einem Tabakhändler auf Staregg. 1963 gab sein Patron, der beinahe 70-jährige Bernard Gruber, sein Geschäft auf. Die Aussichten für die Zukunft erschienen ihm alles andere als rosig, eine Zigarrenfabrik nach der anderen kam in Bedrängnis, und sein Sohn, der mögliche Nachfolger, befand sich in einer psychiatrischen Klinik mit einer schweren, vermutlich unüberwindlichen Schizophrenie. Durch seine Verbindungen sah der mehr und mehr verbitterte und rasch alternde Mann jedoch für Konrad eine einmalige Karrierechance bei einem Tochterunternehmen der British American Tobacco-Gruppe in São Paulo. Konrad lockte das Abenteuer, umso mehr, als das Land mit der neuen Hauptstadt Brasília in aller Munde war.
Er wanderte nach Brasilien aus und kam nur noch selten in die alte Heimat zu Besuch. Er schien dort eine gute Karriere gemacht zu haben. Mit 40 heiratete er eine beinahe 20 Jahre jüngere Brasilianerin, eine Studentin namens Silvia Brandao aus einem altehrwürdigen portugiesischen Geschlecht, wie er schrieb. Er lud seine Geschwister und die Mutter zur Hochzeit ein und bezahlte den Flug. Irma lehnte ab, sie war schon 70 und wollte nicht so weit fliegen. Es war das letzte Mal, dass Elisabeth und André ihren Bruder trafen. André flog ohne die schwangere Miriam hin. Er wäre gerne eine Weile geblieben, um das Land ein wenig kennen zu lernen, doch dies konnte er sich aus mehreren Gründen nicht leisten, auch, weil er Miriam nicht zu lange allein lassen wollte.
Die sprachbegabte Elisabeth hatte im Hinblick auf die Hochzeit in München während Wochen in Privatstunden so viel brasilianisches Portugiesisch wie möglich gelernt und blieb daher durch alle Jahre die Kontaktperson für die Belange der «Brasilianer», doch ein gegenseitiger Besuch kam nie mehr zustande. Einer der Gründe war das unstete Leben, das Elisabeth mit ihrem Mann führte. Immerhin versuchte sie durch Lesen brasilianischer Bücher die Sprache nicht zu verlieren. Schon früh, als ihn in Europa noch kaum jemand kannte, las sie die brasilianischen Ausgaben der Werke von Paulo Coelho.
Das damalige Hochzeitspaar sah gut aus und die grosse Verwandtschaft der Braut freute sich offensichtlich über das Glück ihrer Silvia. Das Leben nahm seinen Gang. Silvia und Konrad bekamen drei Kinder, Eduardo, Ines und Jahre später Sonja. Konrad schickte immer wieder Bilder von ihnen, er kam jedoch nie mehr nach Europa oder gar in die Schweiz. Irma war darüber untröstlich, ihre Enkel nie zu sehen und lehnte trotzdem eine Reise in das ferne Südamerika ab, sie fürchtete sich davor. Sie schickte zu Weihnachten und den Geburtstagen Geschenkpakete, erhielt dafür kurze Dankesbriefe von Konrad, Grüsse von Silvia und immer Bilder der Kinder. Irma machte sich dauernd Sorgen, weil Brasilien immer wieder als Land der Korruption, des Verbrechens und der Armut in den Zeitungen geschildert wurde. Doch beklagte sich Konrad nie, er schrieb auch nicht wirklich Briefe über sein dortiges Leben, aber die Familienbilder liessen selbst für schweizerische Verhältnisse auf einen guten Lebensstandard schliessen.
1989 wurde Konrad angeblich von einem Kriminellen aus der Zigarettenschmugglerszene erschossen. Die Mitteilung – sie erreichte Konrads Mutter erst nach seinem Begräbnis – kam vom Schweizer Konsulat in Brasília und von der brasilianischen Gesandtschaft in Bern. Nähere Informationen waren der knappen Mitteilung nicht zu entnehmen. Erst danach kam auch ein Brief von Silvia in Portugiesisch. Konrad war offenbar im Auto aus nächster Nähe getroffen worden, der Chauffeur war Zigaretten holen gegangen und genau in diesen fünf Minuten kam der Killer, schoss und verschwand. Niemand hatte ihn gesehen, niemand hatte den Schuss gehört und der Chauffeur erlitt einen Schock, als er den Toten hinter der zertrümmerten Scheibe sah. Als Täter konnte er mit Sicherheit ausgeschlossen werden, vielleicht war er Mitgänger, spekulierte Silvia.
Elisabeth wollte mehr erfahren und flog nach São Paulo, um ihre Schwägerin und deren Kinder zu besuchen und den Einzelheiten von Konrads Sterben nachzugehen.
Sie wurde von der Schwägerin und ihrer grossen, beinahe ausnahmslos im gleichen Haus oder in unmittelbarer Nähe wohnenden Sippe freundlich aufgenommen, alle lebten in einer geschlossenen und streng überwachten Siedlung. Sie lernte die inzwischen halbwüchsigen, fröhlichen und gesund wirkenden Kinder Eduardo und Ines sowie die erst dreijährige Sonja kennen. Der Tod Konrads schien keine allzu grossen Spuren hinterlassen zu haben, von Trauer war nicht viel zu spüren. Elisabeth glaubte, bei den Kindern eher so etwas wie Wut über das Verbrechen und über die Unmöglichkeit, darüber etwas in Erfahrung zu bringen, auszumachen. Jeden Tag gäbe es Tote, auch unter den Kindern, manche würden gar von Polizisten erschossen, behauptete der zwölfjährige Eduardo.
Der Lebensunterhalt der Familie war durch eine Rente der Firma fürs Erste einigermassen gesichert, allerdings nicht gegen den beinahe unaufhaltsamen Zerfall der Währung. Silvia und ihre Kinder waren durch die Heirat Schweizer geworden, doch dachte sie keinen Augenblick daran, mit ihren Kindern Brasilien zu verlassen und in die Schweiz zu kommen. Sie sprach ihr Portugiesisch sehr schnell und durchsetzt von vielen lokalen Ausdrücken und so waren die Möglichkeiten der Verständigung mit ihr trotz Elisabeths Kenntnissen der Sprache begrenzt. Eduardo und seine Schwester Ines besuchten eine katholische Schule, sie sprachen bereits ein wenig Englisch, jedoch kaum Deutsch ausser ein paar Scherzwörtern, die ihnen Konrad beigebracht hatte.
Um eine einigermassen ergiebige Unterhaltung über die Situation und Zukunft der Familie zu erreichen, besuchten Elisabeth und Silvia mit den Kindern gemeinsam die Direktrice der Schule, eine Ordensschwester. Dabei sah Elisabeth ein, dass sie sich hier in schwierigem Gelände bewegte. Es machte keinen Sinn, Konrads Verwicklungen nachzugehen, die zu seinem Tode geführt hatten. Im Gegenteil, die fromme Frau riet ihr, sich nur innerhalb von Silvias einigermassen gesichertem Umfeld und nie ohne Schutz durch eine vertrauenswürdige, wenn möglich männliche Begleitung, in der Stadt zu bewegen. Auf die Polizei sei kein Verlass, allfällige Nachforschungen ausserhalb des offiziellen Pfades aussichtslos bis gefährlich. Am meisten würde der Einsatz der schweizerischen Botschaft bringen, doch seien gewisse Stellen überzeugt, dass es enge Verbindungen zwischen der Schweiz, dem weltweiten und speziell dem brasilianischen Zigaretten- und Tabakschmuggel gäbe. Natürlich könnten einflussreiche Leute im Land mehr in Erfahrung bringen, doch gehöre Silvias Familie nicht dazu und jemanden dafür zu gewinnen koste unter Umständen sehr viel Geld.
Von Silvia vernahm Elisabeth schliesslich, wie sehr sie seit wenigen Jahren vermutete, Konrad führe ein durchaus gefährliches Leben. Ganz gefahrlos sei das Leben besonders hier in São Paulo für Leute, die ein wenig über dem Durchschnitt verdienten und lebten, ohnehin nicht. Eine direkte Bedrohung hätte sie jedoch nie ausmachen können. Vielleicht habe er darüber einfach geschwiegen, um sie nicht allzu sehr zu ängstigen. Vielleicht habe er selbst gar nichts befürchtet und sei lediglich Opfer einer Verwechslung geworden. Er wäre niemals unbewaffnet in die Stadt gegangen und hätte sich immer von einem Chauffeur der Firma fahren lassen. Ausserdem sei er ohnehin oft über Wochen im Land herumgereist, um Tabakfarmen und Agenturen zu besuchen und Ernten einzukaufen. Auch dieses Geschäft sei gefährlich, weil sich die Farmer durch die Händler und Konzerne ausgebeutet fühlten. In diesem Kreis habe Konrad Freunde gefunden, so es wirklich Freunde waren, bemerkte sie dazu.
Die Polizei vertrete jedoch hartnäckig die These vom Anschlag durch Schmuggler, weil dabei meistens inzwischen verschwundene Ausländer, Mitglieder einer mafiaähnlichen Organisation, beschuldigt werden konnten und niemand weiter nach einem Täter suchen musste.
Als klar wurde, dass für Silvia und ihre Kinder eine Auswanderung in die Schweiz nicht in Frage käme, fragte Elisabeth sie nach ihren Plänen. Zum ersten Mal lachte Silvia ausgiebig und meinte, sie habe keine Pläne, sie werde einfach in etwa so weiterleben wie bisher und sehen, was die Zukunft bringe. Zum Glück hätten sie und ihre Familie viele Freunde und bräuchten sich daher nicht allzu viele Sorgen zu machen. Und wirklich fühlte sich auch Elisabeth in Silvias Umfeld gut aufgenommen, umarmt, geküsst und eingeladen. Bei allem fühlte sie einen grossen gefühlsbetonten Überschwang an freundschaftlicher Zuneigung. Schliesslich war Silvia bereit, mit ihr die schweizerische Botschaft zu besuchen, um Hilfe bei der Aufklärung der Hintergründe über Konrads gewaltsamen Tod zu erreichen. Sie wurden freundlich empfangen, mussten sich aber mit der leeren Versicherung trösten, man werde alles Menschenmögliche tun, doch seien solche Delikte so alltäglich, dass eine Aufklärung nur in wenigen Einzelfällen gelänge.
Elisabeth flog zurück – ernüchtert.
Irma liess sich alles erzählen und freute sich über die Bilder ihrer Enkel, die Elisabeth ihr brachte. Für Geburtstage und zu Weihnachten schickte sie weiterhin etwas Geld für Silvia und Geschenke für die Kinder und stets bedankte sich Silvia mit einem Brief in Portugiesisch, den sich Irma übersetzen liess.
1996 heiratete Silvia einen Tabakfarmer und zog in die Nähe von Belize. Ihre Kinder, den nun erwachsenen Eduardo und Ines wie auch die zehnjährige Sonja liess sie zurück bei ihrer Familie in São Paulo.
Irma traf diese Änderung hart. Sie befürchtete Schaden vor allem für die Entwicklung Sonjas und auch für die Beziehung der älteren Kinder zu ihrer Mutter, sie sorgte sich um die weitere Ausbildung ihrer Enkel und vermutete schlechte Chancen für deren Zukunft. Irma quälten immer wieder die durch die Medien kolportierten Geschichten über die Strassenkinder Brasiliens und sie bangte nach solchen Informationen oft tagelang um das Leben der zehnjährigen Enkelin. Danach wollte sie jeweils um jeden Preis etwas unternehmen, sie dachte gar an eine bezahlte und gut organisierte Entführung der Jugendlichen in die Schweiz.
Elisabeth nervte nicht nur diese Idee, sondern auch die Tatsache, dass sich ihr Bruder André in Paris aus diesen Geschichten völlig heraushielt. Sie reiste dauernd zwischen München und Wirrwil hin und her und führte am Telefon mit ihrer Mutter endlose Gespräche.
Neben der Sorge um ihre Enkel, besonders um Sonja, entwickelte Irma eine abgrundtiefe Wut gegen deren Mutter. Es half nichts, ihr zu erklären, dass diese Frau kaum 40 Jahre alt war, zu jung, um für den Rest ihrer Jahre ohne Mann zu leben. Irma meinte dazu, sie selbst lebe seit 52 Jahren ohne Mann, wo da das Problem liege? Und wenn schon, dann hätte Silvia wenigstens die Kinder mitnehmen oder sich einen Mann in ihrer Umgebung suchen können! Die 90-Jährige war untröstlich.
Im Herbst 2001 starb Silvia auf ihrer Tabakplantage an Herzversagen. Grossmutter und Konrads Geschwister erhielten diese Nachricht von den drei Enkeln aus São Paulo, Ines hatte den Brief geschrieben. Silvia wurde in der Nähe von Belize begraben. Eduardo reiste hin, er kam aber zum Begräbnis zu spät. Er wollte jedoch mehr über die Umstände ihres Todes erfahren und musste sich mit dem, was Silvias Mann ihm erzählte, zufrieden geben. Silvia starb gemäss eines Arztzeugnisses trotz ihrer erst 44 Jahre an einem Blutgerinnsel mit nachfolgendem Infarkt. Mehr war laut Eduardo nicht herauszufinden. Er war jedoch überzeugt, dass sie dort im Norden wie viele andere Menschen an Überarbeitung, Tabak, Nikotin und an den mit Flugzeugen über die Felder gesprühten Pestiziden starb.
Wie sehr die Kinder um ihre Mutter trauerten, war nicht auszumachen, gewiss wurde nicht jedes der drei Geschwister in gleichem Masse davon betroffen. Am meisten Sorgen machte sich die Grossmutter um die 15-jährige Sonja, doch Elisabeth beruhigte, sie sei in ihrer Sippe und in der Klosterschule gut aufgehoben. Irma kommentierte Silvias Tod mit: «Das ist die Strafe!»
Als Konrad nach Brasilien auswanderte, war André 18 Jahre alt gewesen. Er wohnte als Jüngster, nur unterbrochen durch seinen dreimonatigen Sprachaufenthalt in Frankreich, noch etwas über zwei Jahre alleine bei seiner Mutter und der inzwischen 82-jährigen Grossmutter. Danach studierte er in Bern und kam nur noch selten zu Besuch. Die Geschwister pflegten unter sich kaum Kontakte, wenigstens nicht zu André.
«Ich fühlte mich nie wirklich als Teil einer Familie. Als ich in den ersten Schuljahren war, waren meine Geschwister beinahe erwachsen. Es gab in unserem Haushalt keinen Mann, keinen Vater und meine Geschwister waren für mich weit weg, weit voraus, sie wohnten einfach bei uns und eigentlich bin ich in einer Frauenwelt aufgewachsen», hatte André seiner späteren Frau erzählt.
Nur zu einem Mann entwickelte er so etwas wie ein Verhältnis zwischen Junge und Mann oder gar Vater: zu Lorenz Gramper, dem Strassenwischer aus dem kleinen katholischen Nachbardorf.
Lorenz kam beinahe wöchentlich einmal vorbei, um nach dem grossen Gemüsegarten und den Blumenbeeten zu sehen und den Rasen zu mähen. Irma liebte zwar den Garten, aber nicht die dabei anfallende Arbeit. Der Gramper, so nannte sie ihn, verdiente sich damit ihrer Meinung nach ein gar nicht so kleines Zugeld. Jeweils im Frühling legte er die neuen Beete an, pflanzte das Gemüse, jätete aufkeimendes Unkraut zwischen den Blumen, schnitt die Sträucher, die Beeren, Obstbäume und das Aprikosenspalier an der Hausmauer. Im Herbst erntete er die Äpfel, Birnen und Zwetschgen, räumte die Beete und grub den Gemüsegarten um. Das alles machte er immer nach Feierabend und an Samstagen. André liebte es, ihm dabei zuzusehen und war oft eifrig bemüht, ihm zu helfen. Manchmal, wenn Irma Lorenz sauren Most, Brot, Käse und ab und zu eine Wurst zum Sitzplatz brachte, setzte sich der Kleine zu ihm und freute sich auf die Häppchen, die der Lorenz ihm überliess. Sogar von der rohen Zwiebel, die der Mann über alles liebte, liess er sich etwas geben. Lorenz gab ihm das Gefühl, auch ein Mann zu sein. Den Most verweigerte er dem Knirps.
Von Lorenz lernte André die Namen der Blumen kennen, durch ihn erlebte er, wie die Amseln beim Umgraben auf die frei gewordenen Würmer lauerten, sie aus ihren Löchern zogen und zu den Nestern trugen. Er zeigte ihm die Blattläuse und wie sich die Ameisen darum kümmerten. Er schwärmte vom Rossmist für die Rosen und bedauerte die zarte Gesundheit dieser wunderbaren Blumen. Als sie blühten, liess er ihn die von Sorte zu Sorte unterschiedlichen Düfte riechen. Durch Lorenz erlebte André, wie die Katze Mäuse fing und danach mit ihnen ihr grausames Spielchen spielte.
Anfänglich kam Lorenz auch zum Holzspalten, doch das war inzwischen vorbei. Nun wurde das Haus mit einer Ölfeuerung geheizt. Lorenz hatte im Garten die grosse Grube für den Öltank ausgehoben und dabei an einem gewaltigen Durst gelitten.
Dabei bemerkte André zum ersten Mal in seinem Leben, wie sich ein Mensch veränderte, wenn er über den Durst trank. Lorenz redete langsamer, er lallte ein wenig mit der Zunge und die Worte verloren hin und wieder den Zusammenhang. Nein, betrunken war Lorenz in seiner Gegenwart nie, nur ein wenig angesäuselt, so nannte seine Mutter den Zustand jeweils nachsichtig lächelnd.
Natürlich lernte André auch einige von Lorenz’ vielen Kindern kennen, vor allem die etwa gleichaltrigen Jungen Felix, Franz, Markus und Peter. Freundschaften wurden daraus nicht, denn die Gramperbuben gingen in Kreuzach zur Schule.
Hin und wieder kam Felix mit seinem Vater, um da und dort in der Naturwiese seine Mausefallen in die Erde zu stecken. Das war Felix’ grosses Geschäft und er wusste sehr viel über diese angeblich schädlichen Nager. Felix erzählte auch von seinen Kaninchen und lud André ein, sie zu besuchen. Er ging hin und bekam ein Junges geschenkt. Das gab zu Hause einen Aufruhr! Zuletzt kaufte ihm die Mutter einen Kaninchenkasten und die Grossmutter passte auf, dass er den niedlichen Hüpfer ordentlich fütterte. Doch das arme Tierchen lebte auch so nicht lange. André liess es gelegentlich im Garten herumrennen. Einer von Tante Helenes beiden riesigen, aber sonst friedfertigen Hunden brachte dem lustig hoppelnden Häschen mit einem einzigen Biss ein bitteres Ende.
André bedauerte es, keinen Vater zu haben wie Lorenz einer war, und er beklagte sich darüber auch bei seiner Mutter. Bislang hatte sie das eher geahnt, als dass sie um das Manko ihres Jüngsten wusste. Sie konnte das nicht ändern. In diesen Jahren liess sie André vermehrt zu ihrem Bruder Ernst und ihrer noch immer kinderlosen Schwägerin Helene gehen. Sie hoffte, Ernst könne für den Jungen auch so etwas wie Vaterersatz werden. Zwar gewann André eine gewisse Nähe zu seiner Tante, doch der meistens in seinem Arbeitszimmer oder auf der Terrasse grosse Zigarren rauchende Ernst blieb für ihn irgendwie unnahbar, eher eine Autorität, die ihm imponierte, aber die er auch seiner Stimme und seiner schieren Grösse wegen ein wenig fürchtete.
In seiner Erinnerung mochte er Tante Helene ganz gern. Sie verwöhnte ihn mit Schokolade und im Sommer mit selbst gemachter Eiscreme. Andererseits fand er das Leben in ihrem Haus eher langweilig. Bei ihr drehte sich alles um ihre Bücher, Schallplatten und Kochrezepte. Sie schrieb dauernd Briefe, offenbar an Freundinnen auf der ganzen Welt – Brieffreundinnen seien das, Frauen, die sie seit ihrer Mädchenzeit kannte, ohne sie jemals gesehen zu haben, und sie rauchte endlos Zigaretten, das mochte er nicht. Sie versprühte immer wieder Parfüm, das mochte er auch nicht, aber im Grossen und Ganzen konnte er sie trotzdem ganz gut leiden.
Sie liebte seiner Ansicht nach besonders ihre beiden riesigen Hunde, zwei schwarze, langhaarige und ausserordentlich friedfertige Neufundländer, die sie in ihrem Garten frei herumrennen liess und denen sie im Keller einen grossen Raum als Stall eingerichtet hatte. Jeden Tag und beinahe bei jedem Wetter ging sie mit den beiden Tieren in den Wald. Ab und zu kam sie mit ihnen zu Besuch und liess die für ihn bärenähnlichen Wesen auch in Andrés Garten herumtollen. Dass einer der beiden das Kaninchen zu Tode biss, erschreckte den Jungen.
Wie in all den Jahren, wenn er, selten genug und meistens nur für wenige Stunden, seine Mutter besucht hatte, fand er das Haus und seine Lage schlicht einzigartig. Über dem See am Heimberg mit freier Sicht auf die Alpen, nicht weit vom Wald und doch ganz nahe im Zentrum des inzwischen beinahe zur weiträumigen Siedlung gewachsenen Dorfes, fühlte er so etwas wie nach Hause gekommen zu sein. Hier konnte er Heimat erleben, Frieden, Heilung von den Verletzungen, die er und vermutlich auch Miriam sich, wenn nicht aus Bosheit oder Absicht, sondern allein durch Unvermögen oder Ungenügen gegenseitig bei ihrer Trennung und Scheidung zugefügt hatten.
Zwar konnte er die Veränderungen der vergangenen 50 Jahre nicht übersehen, denn wo einst Wiese, Äcker und Obstbäume gewesen waren, standen neu ordentlich in Zeilen oder wild zerstreut Dutzende niedlicher Einfamilienhäuschen, doch die wesentlichen Merkmale aus seiner Kindheit ragten in seinen Augen noch immer heraus: Drüben der spitze Kirchturm der katholischen Kirche von Kreuzach mit der Fabrik von Brand-Cigars, sozusagen über ihm an der sanften Flanke zum Heimberg die Schlossruine Staregg mit den unübersehbaren Gebäuden der Star-Tabak und zwischen dem Haus und dem See das Dorf Wirrwil mit dem hervorstechenden alten Schulhaus und der reformierten Kirche. Unübersehbar waren auch die von Norden nach Süden verlaufenden Schienen der Eisenbahn und die Hauptstrasse.
Was André vergeblich suchte, war der Kreuzbach, der die beiden Dörfer so eindeutig getrennt hatte. Offensichtlich war er in der Zwischenzeit in Röhren gefasst, zugeschüttet und darüber eine Strasse zur Erschliessung der neuen Häuser gebaut worden. Der gefasste Bach mündete nicht mehr direkt in den See, er übernahm jetzt die Abwässer der beiden Dörfer und führte sie zur Reinigungsanlage.
André hatte bei einer Nachbarin die Schlüssel geholt, die drei Jahre lang ab und an nach dem Haus geschaut hatte. Anfänglich war die Mutter noch gelegentlich aus dem Altenheim gekommen, um durch die Räume zu gehen und sich für eine Weile in den Garten zu setzen. Diesen liess sie bis zu ihrem Tod von einem Gärtner einigermassen in Ordnung halten. Einer Putzfrau gab sie Geld und bat sie, ab und zu den gröbsten Staub zu wischen und die Nachbarin war bereit, hin und wieder eine Kontrollrunde zu machen. Der Dorfelektriker versah einzelne Lampen mit Zeitschaltern, um eventuelle Einbrecher abzuschrecken.
Um keinen Preis wollte Andrés Mutter das Haus vermieten oder verkaufen. Sie ging so damit um, als ob sie eines Tages zurückginge und wieder einziehen wollte. Noch am letzten Jahresende vor ihrem Tod kaufte sie alle Zutaten, um ebenso wie in den letzten 50 Jahren ihr Weihnachtsgebäck zu backen.
In jenem Winter erkrankte sie an einer Lungenentzündung, von der sie sich nicht mehr erholte und an deren Folgen sie im Frühling starb. Zum Begräbnis waren neben André, Corinne und Nadine zu seinem Erstaunen auch Miriam und seine Schwester Elisabeth gekommen, aber niemand aus Brasilien, kein Brief, keine Karte, kein Anruf. André und Elisabeth hatten sich danach Vorwürfe gemacht, vielleicht hätten sie Irmas Enkeln den Flug nach Europa bezahlen oder mindestens vorschiessen sollen. Elisabeth entschuldigte sich in einem Brief für die Unterlassung, doch da gab es offenbar kein Problem. Die Enkel meinten, sie hätten die alte Dame nicht gekannt und daher gar nicht daran gedacht, bei der Beerdigung dabei zu sein.
Nach dem Begräbnis hatten André und Elisabeth einen Blick ins Haus geworfen, mehr nicht. Sie waren von der Situation überfordert und warteten die Testamentseröffnung ab. Irma hatte da und dort kleine Legate gemacht und im Übrigen ausdrücklich gewünscht, das Erbe je zu einem Drittel den beiden Geschwistern und den Enkeln in Brasilien zukommen zu lassen.
Dies alles war, als André ins Haus zog, noch nicht endgültig geregelt. Da standen noch immer die Möbel aus seiner Jugend, mit Folien abgedeckt. Doch alles funktionierte, das Licht in den Räumen, der Herd in der Küche, im Keller sprang sogar die Heizung an. Er hätte sich sein Zimmer im kleinen Hotel sparen können. Ganz geheuer war ihm die Sache nicht. Er brauchte Zeit, um hier, wo seine Wurzeln lagen, sein Leben fortzusetzen. So hatte er gedacht, doch alles war viel einfacher.
Nach zwei Tagen gab er das Hotelzimmer auf. Er hatte seine Habseligkeiten beim Spediteur abgerufen und war dann zur Gemeindeverwaltung gegangen. Dort hatte er sich über die moderne Einrichtung der Büros gewundert. Er wurde freundlich empfangen, der Gemeindeschreiber kümmerte sich persönlich um ihn. Er half ihm, einen Anmeldebogen auszufüllen. Sie sprachen über seine Papiere, er wusste nicht, wo sein Heimatschein steckte, seit 30 Jahren hatte er sich nicht darum gekümmert. Er hatte einfach seinen Schweizer Pass. Vermutlich lag der gesuchte Ausweis in der Stadt Bern. Der Gemeindeschreiber meinte, er würde sich darum kümmern. Er wollte auch wissen ob André reformiert oder katholisch sei, eine reine Formsache, es ginge um die Kirchensteuer. André war Atheist, das sagte er dem Mann freimütig und hatte dabei das Gefühl, nicht auf Anhieb verstanden worden zu sein, vielleicht, weil seine Mutter zur reformierten Gemeinde gehört hatte. Doch es kam keine Rückfrage, also war alles klar. Auf dem Zettel stand «Konfessionslos». Zum Abschied bekam André eine hübsche Broschüre, in der die Gemeinde und ihre gute Wohnqualität vorgestellt wurden.
Danach besuchte André den Friedhof neben der Kirche, in der er einst konfirmiert worden war, er betrachtete nicht nur die Urnengräber, wo die Asche seiner Mutter bestattet wurde. Er durchwanderte mehr oder weniger den gesamten Garten, denn so kam ihm die Anlage vor, anders als die grossen Friedhöfe, diese steinernen Nekropolen, der Grossstadt. Er suchte nach Verstorbenen, die er noch aus seiner Jugend kannte. Zu seinem Erstaunen entdeckte er nur wenige. Wo waren denn all die Menschen hingegangen, die er in seiner Kindheit als ältere Leute wahrgenommen hatte? Er hatte das Dorf vor über 40 Jahren verlassen. Die hiesige Regel gewährte den Verstorbenen 25 Jahre Grabruhe, wie ihm eine Frau erklärte, die ihren kürzlich verstorbenen Mann besuchte – genau das hatte sie gesagt.
Irgendwie lag im Dorf alles weit auseinander. Beinahe eine halbe Stunde musste er gehen, um in der Bank ein Konto für seine Bezüge und Zahlungen zu eröffnen. Nachdem er sich auch bei der Post gemeldet hatte, um sicher zu gehen, dass ihn allfällige Briefe erreichen würden, kaufte er sich in einem erstaunlich grossen und modernen Laden einige Lebensmittel, ging zurück ins Haus und begann dort zu leben – allein und ohne Eile.
Er nahm sich vor, ein Fahrrad zu kaufen, damit die Zeit für die Einkäufe zu kürzen und Ausflüge dem See entlang und durch die Landschaft machen zu können.
Die kommenden Tage verbrachte er mit ausgedehnten Wanderungen. Nach und nach erinnerte er sich an all die Wege, die er als Kind und Schüler gegangen war, an die kleinen Streiche, die er mit anderen Buben gespielt hatte.
Es war Sommer, eine wunderbare Zeit. Weit weg von der Bruthitze der Grossstadt fühlte er sich befreit und voller Frieden. An einzelnen Stellen reichte der Wald vom Heimberg bis ans Seeufer. Da setzte er sich in den Schatten und liess seine Augen über die stille Wasserfläche gleiten, freute sich an der leichten Brise, und versuchte, sich an die kleinen Dörfer und Plätze am gegenüberliegenden Ufer zu erinnern.
Seine gesamte Kindheit hatte er mit seiner Mutter, der Grossmutter und den für ihn damals so viel älteren Geschwistern hier über dem sich von Norden nach Süden ausdehnenden See und dem langgezogenen Dorf mit seinen Dutzenden von kleinen und grösseren Fabriken verbracht. Die diesseitigen angrenzenden Dörfer waren damals noch klar auszumachen, insbesondere zwischen Wirrwil und Kreuzach gab es diesen breiten, tiefen Graben, den er bei tiefem Wasserstand verbotenerweise mit anderen Jungen immer wieder durchwatete, nach Kröten oder gar Fröschen absuchte und in dem sie sich ab und zu mit den Buben aus Kreuzach heftig stritten. Die Kreuzacher Buben wirkten auf ihn immer etwas seltsam. Deren Kniehosen waren länger und sie mussten jeden Sonntag zur Kirche gehen. Das wusste er von Felix.
Diese Kirche mit dem schönen Turm hatte den Jungen – damals hatten ihn alle Andreas gerufen – immer wieder angezogen, aber er gehörte nicht dazu, er war nicht katholisch. Die Kirche stand direkt neben der Fabrik, in der seine Mutter arbeitete und er ging daran vorbei, wenn er Tante Helene besuchte. Hin und wieder warf er einen Blick in die ihm seltsam fremde Welt der Katholischen.
Während der Zeit der Sekundarschule hatten er und Felix’ jüngerer Bruder Peter ein Stück weit den gleichen Schulweg. Von ihm liess er sich die ewigen Wahrheiten und Geheimnisse der Papstkirche erklären. Peter glaubte an die Vergebung der Sünden, an die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut seines Erlösers und an Hölle, Fegefeuer und Himmel. Der Junge war so überzeugt, dass André begann, sich ernsthaft um sein eigenes Seelenheil Sorgen zu machen. Doch seine Mutter wies ihm ihren Weg, meinte, er sei ein Reformierter und schickte ihn in den Konfirmandenunterricht. Sie hielt nichts vom katholischen Tingeltangel. Der allmächtige Gott, zu dem man betete, und die Bibel als Anleitung zum anständigen Lebenswandel genügten. Der Pfarrer war nur zur genauen Erklärung des geschriebenen Wortes da und mehr brauche es nicht, sagte die Mutter.
Inzwischen war nicht nur der Bach in Röhren begraben worden, vielleicht war auch der religiöse Graben mehr oder weniger zugeschüttet, und für die unterschiedliche Geschichte interessierten sich die jungen Leute kaum mehr.
Alle wichtigen Leute in Andrés Kindheit waren Reformierte gewesen, auch die Brands, die Fabrikanten, die im katholischen Dorf wohnten und denen die dort einzige, aber sehr bedeutende Fabrik gehörte. Auch Tante Helene und Onkel Ernst wohnten da. Letzterer wurde als Reformierter und Direktor bei den Brands gar Gemeindepräsident. Das war so etwas wie ein Zeugnis katholischer Toleranz, oder hatte das vielleicht etwas mit Geld und Macht zu tun? Andrés Mutter Irma, Ernsts Schwester, verneinte vehement, aber nicht, weil sie an die katholische Toleranz glaubte, sondern an die ausserordentlichen Fähigkeiten ihres Bruders.
André erinnerte sich genau. Als er diese Frage gestellt hatte, war er 16, er hatte seiner Meinung nach zu denken begonnen und besuchte das Gymnasium. Es war die Zeit, in der er viele Bücher las. Neben der ohnehin diktierten Pflichtlektüre interessierte ihn quer-beet jede Richtung, Brecht, Marcuse, Solschenizyn, Hemingway, Dostojewski, Tschechow, und dabei fand er zum Entsetzen seiner Mutter auch Zeit für die ersten Abenteuer mit Mädchen. Dabei war alles harmlos, Getändel und maximal Geschmuse, wenn›s hochkam. Ein uneheliches Kind wäre ein Unglück gewesen, eine Katastrophe, eine Schande, ein Grund, sich das Leben zu nehmen, mindestens für die junge Mutter. Um zu vermeiden, dass sie für diese Ungeheuerlichkeit in die Pflicht genommen würden, flohen junge Männer damals noch in die Fremdenlegion.
Der tief empfundenen Kontrolle seiner Mutter war er erst als Student entgangen. Da hatte er in Bern seine Mansarde. Mit etwas Glück machte er ihr auch da keine Schande. Das war nicht so ganz einfach, es gab keine Pille, kaum Präservative, die jungen Frauen wussten über ihren eigenen Körper kaum Bescheid und er nicht viel mehr.
Seither hatte er ein Leben gelebt und nun stand er wieder da, wo alles begonnen hatte. André lächelte vor sich hin. Zum ersten Mal seit langem.
Hier war er zu Hause, das war seine Heimat, hier wollte er leben, bis die Natur sein Leben irgendwann beenden würde.
Wo waren sie abgeblieben, die Menschen seiner Kindheit? In diesen ersten Tagen hatte er kaum jemanden getroffen, den er als Junge gekannt hatte. Hin und wieder begegnete er einem Gesicht, das ihn berührte, mit Zügen, die ihm nicht ganz fremd erschienen, doch er zögerte jeweils, anzuhalten und sich vorzustellen, nach dem Namen zu fragen. Er musste sich wieder daran gewöhnen, dass sich hier die Leute auf der Strasse grüssten, das hatte er vergessen. Anfänglich fühlte er sich dabei erkannt. Das war ein Irrtum. Eigentlich war es wunderbar, dass sich die Menschen grüssten. Trotzdem, er war ein Fremder geworden, niemand schien ihn zu kennen oder sich an ihn zu erinnern.
Rund 40 Jahre waren vergangen, seit er die Mansarde in Bern bezogen hatte. Kein Wunder kannte ihn hier niemand mehr. Alle, die seine Kindheit geteilt hatten, gingen inzwischen ihre eigenen Wege, hatten Berufe erlernt, geheiratet, waren weggezogen, hatten Kinder bekommen, waren jetzt auch um die 60 Jahre alt und lebten wohl überwiegend in völlig veränderten Strukturen. Die Menschen, die in seiner Jugend Erwachsene gewesen waren, waren jetzt Greise oder verstorben. Die Heimat, in die er zurückgekommen war, war nicht mehr da. Darüber hatte André nicht nachgedacht, als er Paris verliess. Er hätte es wissen müssen.
Die Lehrer, zu denen er in die Schule gegangen war, die damals noch mit dem Meerrohr paukten, gab es nicht mehr. Der Pfarrer, der ihn konfirmiert und auch vorwitzigen Mädchen Kopfnüsse verpasst hatte, war längst gestorben. Der Schulabwart, der einst den Schülern die Ohren langzog, wenn sie die Schuhe auf dem Teppich nicht sauber machten, war vor vielen Jahren in seinem Auto von der Killerbahn – so nannte man die an der Strasse entlangfahrende Eisenbahn – zerdrückt worden.
Jetzt wollte er sich die Zeit nehmen und seine Kindheit neu entdecken, sich auch jenen Dingen widmen, die er bisher übersehen hatte. Aus lauter Verlegenheit hatte er sich vorläufig in seinem einstigen Zimmer eingenistet. Er wollte und konnte nicht in einem der anderen Betten schlafen.
Seine Mutter hatte sein Zimmer kaum verändert. Auf den Regalen standen noch immer die Bücher, die ihn als Schüler gefesselt hatten, neben vielen anderen ein Dutzend Bände von Karl May, nur zwei, drei Bücher weiter, ein Zeitsprung in jeder Beziehung, das «Bildnis des Dorian Gray». Er nahm es vom Gestell, legte sich aufs Bett und begann zu lesen. Irgendwie kam es ihm vor, als ob auch ihm jetzt Ähnliches geschah. Da war die Jugend und das Leben nahm seinen Lauf, rasend schnell, und jetzt traf er sich in einem Spiegel mit dem alternden Mann, unausweichlich. So hart war ihm dies bisher nicht begegnet. Dieser Bruch mit seinem bisherigen Leben liess ihn in eine völlig neue Gegenwart fallen.
Er schob alle Arbeiten wie Ein- und Umräumen vor sich her. Die Schränke waren noch immer voll von Kleidern und anderen Sachen seiner Mutter. Er mochte daran nicht rühren. Andererseits musste er nur wenig Dinge besorgen. Küchen-, Toiletten- und Bettwäsche lag, sorgfältig gebügelt, in Stapeln in den Regalen. Im Augenblick brauchte er sich nur um sein Essen zu kümmern.
Dabei übersah er den seit dem Tod der Mutter wild wuchernden Garten. Er wollte ihn nicht sehen, er hatte Zeit und er versuchte, die Zeit anzuhalten, «reculer pour mieux sauter» fiel ihm ein.
Bücherregale musste er beschaffen! Er hatte in Paris alle seine Bücher in Kisten verpackt und mit den wenigen anderen Sachen, die er nicht zurücklassen wollte, einem Spediteur übergeben. Der Gedanke liess ihn lächeln: Nicht was er mitnehmen, sondern was er nicht zurücklassen wollte, hatte er eingepackt, das war ein Unterschied. Das grosse Zimmer neben dem Wohnzimmer – beide mit Sicht auf See und Alpen – in dem seine Mutter ihre Nächte lesend und schlafend verbracht hatte, wollte er zur Bibliothek, zum Lese- und Schreibzimmer, machen. Er würde lesen, viel lesen, in den Wald gehen, an den See, am See entlang zurückkehren, schreiben und lesen.
In den nächsten Tagen kaufte er sich eine Badehose und ging zum See. Seit über 40 Jahren war er nicht mehr dagewesen. Damals gab es im Sommer hin und wieder Badeverbote, weil die Bauern die Felder überdüngt hatten und der ganze Dreck bei Regen in den See geflossen war. Hin und wieder waren die Buben trotzdem schwimmen gegangen, nicht bei der geschlossenen Holzbude, in der Frauen und Männer nicht zusammen ins Wasser gehen und schwimmen durften, sondern an einer offenen Stelle hinter einer schützenden alten Betonmauer.
Da wollte er wieder hingehen und sich erinnern, schwimmen.
Jemand im Dorf hatte ihm erzählt, das Wasser sei jetzt wunderbar sauber und für die Jahreszeit erstaunlich warm. Das Gartenbad jedenfalls sei offen.
Er wollte nicht ins Gartenbad, er konnte sich darunter nichts vorstellen, der See war ja keine Piscine und in irgendeine Holzkiste wollte er sich nicht pferchen lassen.
Einst in Paris war er mit Miriam und den Mädchen, mit gefülltem Picknickkorb und einem Faltboot auf dem alten Peugeot ab und zu an Sonntagen bei schönem und warmem Wetter an die Yonne gefahren, dorthin, wo sie seicht ist und gemächlich fliesst. Da waren sie immer allein und ringsum war alles sanfte grüne Natur. Grün war auch das Wasser, nicht wirklich sauber, aber gewiss nicht ungesund, das wenigstens wollte er glauben. Auch das waren schöne Stunden, schöne Tage gewesen. Frankreich ist ein grosses schönes Land, erinnerte er sich.
Jene Mauer mit der kleinen Wiese, die er wiedersehen wollte, war noch da, auch eine neue Sitzbank. Alles war gut. Er schwamm sich zurück in seine Kindheit und Jugend. Später wanderte er am Ufer entlang zum Steg der Segelboote und war überrascht über die grosse Zahl vor allem beinahe neuer Schiffe. Vielleicht sollte er sich eine Jolle kaufen und segeln lernen oder umgekehrt. Die Anlegestelle gehörte dem Club, er wollte sich erkundigen und fürchtete den Gedanken, die Sache könnte für ihn zu teuer werden. Seine Pension aus Frankreich liess sich zwar sehen, aber allzu grosser Spielraum lag nicht drin. Hier schien das Alltagsleben deutlich teurer, das hatten ihm schon die ersten Einkäufe gezeigt und das Haus würde ihn auch belasten, mehr, als er sich ursprünglich ausgerechnet hatte, Erbteil und Ersparnisse würden kaum genügen, um schuldenfrei zu sein. Vielleicht hatte er sich selbst getäuscht, weil er einfach hierher kommen wollte. Hier bekam er ohnehin noch keine Rente und wenn, nur für die wenigen Jahre, in denen er in der Schweiz gearbeitet und eingezahlt hatte.
Immerhin, auf der Bank lagen einige zehntausend Euro von Miriam, der ausbezahlte Erlös aus der Wohnung in Paris.
Als er sich entschlossen hatte, Paris zu verlassen und in die Seeweite zu ziehen, hatte ihn die Aussicht gereizt, sich seinem in den letzten 40 Jahren mehr oder weniger vernachlässigten Fach Geschichte wieder etwas zu nähern. Noch als Maturand favorisierte er die Renaissance, doch die hatte seiner Meinung nach die Völker weit weniger bewegt als die spätere Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution, die Zeit, in der die heutige Welt erdacht und erfunden worden war, die Zeit von Descartes, Diderot, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Benjamin Franklin und vielen anderen. Europäer und Amerikaner begeisterten ihn, das war für ihn grosse Geschichte.
Es würde bestimmt sehr reizvoll sein, sich Schmauchtals kleiner Geschichte anzunehmen. Das war vermutlich Brachland und eine Möglichkeit, sich in der Gegend bemerkbar oder gar nützlich zu machen. Zu seiner grossen Enttäuschung fand er sehr schnell heraus, dass lokale und kompetente Kenner seit den Anfängen in der letzten Eiszeit alle relevanten Ereignisse, die politische und wirtschaftliche Entwicklung, Daten und Fakten schon lange akribisch gesammelt und in erstaunlich sorgfältig und edel gemachten Büchern festgehalten hatten. Sogar die Ursprünge der Schallers, der Ahnen seiner Mutter, und vieler anderer Familien der umliegenden Dörfer waren längst geklärt. Es gab nichts mehr zu recherchieren oder zu erforschen. Ernüchterung, ja beinahe Enttäuschung waren anfänglich gross. Doch die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Herkunft und den zum Teil tragischen Verwicklungen beschäftigte ihn zusehends, weniger die Fakten, mehr der menschliche Gehalt, die Saga. Er wusste, dass seine direkten Vorfahren, die Schallers, Bauern auf dem Heimberg gewesen waren, sein Grossvater jedoch bei den Brand-Cigars Verkäufer wurde und noch nicht 30 war, als er jeweils mit Koffern und Rucksack nach Deutschland fuhr, den Münchner Tabakläden seine Produkte anbot, den Import der Bestellungen organisierte und später Niederlassung und Fabrik der Firma in München leitete bis zur Reichskristallnacht. André lebte auch in der Gewissheit, ohne dies jemals überprüft zu haben, dass sein Grossvater als Folge seiner endlosen Raucherei an Kehlkopfkrebs erkrankt und daran unter entsetzlichen Schmerzen gestorben war. Dieser langsame Tod, den seine Mutter Tag für Tag begleitet hatte, hatte ihr traumatische Prägungen beigebracht. Wenige Wochen nach Grossvaters Sterben erhielt sie aus München die Nachricht vom grässlichen Ende ihres Mannes. Sie war jetzt allein mit ihren drei Kindern. Immerhin nicht arm, nicht weit von ihrem Bruder Ernst wohnend und auch in verschiedener Hinsicht gestützt durch die Beziehung zu den Brands, den Besitzern von Brand-Cigars. So war das bei ihm als Kind angekommen.
Er begann sich für Einzelschicksale, Herkunft und Lebensläufe von Menschen, die er aus seiner Jugendzeit oder Kindheit kannte, zu interessieren. Dieses Interesse war auch durch sein eigenes Erleben motiviert. Wenn es so etwas wie Liebe gab, hatte ihn diese nach Frankreich entführt. Miriam war für ihn einfach unwiderstehlich gewesen. Ihr Gesicht hatte fröhliche Unbefangenheit ausgestrahlt, und in allem, was sie sagte, war Zuversicht, Freude auf gutes Gelingen und frohe Tage gelegen. Er erlebte sie als Gegenpol zu seiner Mutter, die sich stets sorgte, sich vor jedem kommenden Tag fürchtete oder ihm mindestens ohne Hoffnung auf Gutes und Schönes entgegensah. Er selbst neigte zu dieser Gemütslage und Miriam hatte ihn da herausgeholt und in einem gewissen Mass auch mitgerissen.
Er hatte seine Mutter kaum lächeln sehen, mit Miriam zusammen sah er sie sogar lachen. Aber Miriam wollte nicht in der Schweiz leben. «C’est beau, la Suisse, tu sais, mais un peux étouffante …», und sie sagte dies mit grossem Charme.
Andrés Vater war offensichtlich irgendwie mit dem deutschen Faschismus verstrickt gewesen. Sein Sohn scheute sich jedoch sein Leben lang, aus Respekt vor seinen Eltern, dieses Thema anzusprechen. Aber der Mann hatte nun einmal Brand-Cigars in München in den letzten Jahren vor und während des Krieges bis kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner geleitet. Ohne ein Mindestmass an Linientreue hätte er diese Stellung nie bekommen oder gar halten können. Auch der Grossvater, der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg im Auftrag der legendären Mama Brand für Brand-Cigars nach Deutschland gezogen war, konnte sich dem Einfluss der Entwicklung zum nationalsozialistischen Deutschen Reich nicht entziehen. Allerdings verliess er Deutschland mit seiner Frau, als die Horden der paramilitärischen SA im Rassenwahn in den Strassen der Städte alles kurz und klein schlugen, was als jüdisch galt oder aussah – aus Altersgründen, wie er die braunen Behörden ausdrücklich wissen liess. Der alte Sebastian – so nannten ihn auch «seine» Arbeiterinnen und Arbeiter am Starnberger See – war damals 63 Jahre alt.
Er kaufte in der Schweiz durch die Vermittlung der Brands über dem See dieses schöne Haus. Er erlebte jedoch das Ende des Krieges nicht, er starb im März 1945, nur wenige Wochen vor dem grausigen Tod seines Schwiegersohnes und kaum zwei Monate vor dem Ende des Hitlerreichs. Schon nach dem Fall von Stalingrad wusste Sebastian, dass der Krieg für Deutschland verloren war, doch sprach er nie darüber, er setzte aber nach diesem Zusammenbruch der Ostfront alle Hebel in Bewegung und bat auch Marcel Brand, den Nachfolger der inzwischen verstorbenen Mama Brand, um Unterstützung, um seine Tochter Irma mit ihren Kindern – durch die Heirat waren sie deutsche «Reichsangehörige» geworden – auf Dauer in die Schweiz «heimzuholen», wie er es nannte.
Der Vorgang war kompliziert, ein Doppelbürgerrecht gab es nicht und die Familie konnte auch nicht den Status von Flüchtlingen annehmen, das hätte den als Leiter der Niederlassung zurückgebliebenen Vater in Schwierigkeiten bringen können. Er durfte nicht in den Verdacht eines Defätisten geraten, das war lebensgefährlich und zudem auch ein Risiko für die deutsche Brand-Cigars.
Es gelang nur Dank der Hilfe eines befreundeten Arztes, der sowohl bei der Mutter wie auch bei dem am 6. Juni 1944 geborenen Säugling Andreas eine Lungentuberkulose attestierte und die beiden älteren Kinder als schwer gefährdet einstufte. Nachdem sich die Werths bereit erklärt hatten, die Kosten einer Kur bis zur vollständigen Heilung in den Schweizer Bergen selbst zu tragen, lenkte der an sich sehr misstrauische, aber letztlich auch für kleinere und grössere Geschenke empfängliche Amtsleiter für Auslandsaufenthalte ein.
Es war eine Zitterpartie. Beinahe systematisch wurden im «Reich» unheilbar Kranke – Tuberkulöse galten mindestens als sehr schwer und selten heilbar – einer Heilstätte zugewiesen. In der Regel erhielten die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, die Patienten seien an den Folgen des Leidens gestorben. Nicht immer, aber hin und wieder und selbstverständlich nur für Nichtjuden waren andere Lösungen möglich.
Sebastian musste in Kauf nehmen, dass sein für seine Tochter im «Reich» angespartes und noch immer dort liegendes Geld als Bürgschaft gesperrt wurde. Das war zwar unschön, aber zu verschmerzen.
Im September, als die Amerikaner Frankreich befreiten, verbrachten Sebastians Enkel und seine Tochter die ersten Wochen in der neuen Heimat, in der deutschen Heimstätte von Davos. Die Wahl dieses Kurortes in Graubünden war für die Nazis unverdächtig. Während der Hitlerzeit galt die Stadt in den Bergen, vor allem seit dem Mord an Gauleiter Gustloff, als eine Drehscheibe deutscher Maulwürfe des Dritten Reichs.
Als ob er seine letzte Kraft für diesen Vorgang verbraucht hätte, erkrankte Sebastian wenige Wochen nach der Ankunft seiner Lieben. Damit begann für ihn eine lange und nicht nur sehr schmerzhafte, sondern auch kostspielige Leidenszeit. Bedingt durch den damaligen Zeitgeist, aber auch durch seine Biographie hatte Sebastian keine in der Schweiz einsetzbare Krankenversicherung. Irma wurde sehr schnell klar, dass ihre Eltern an ihren Kosten in Davos ausbluteten. Sie brach ihren «Kuraufenthalt» in den Bergen kurzerhand ab und zog noch vor Weihnachten ins Haus am Heimberg über dem See. So konnte sie auch ihrer Mutter helfen, über den gesundheitlichen Zerfall ihres Mannes hinwegzukommen.
Irma wollte arbeiten. Bei Brand-Cigars fand sich eine Stelle im Lohnbüro und ihre Mutter übernahm die Aufsicht auf die Kinder.
Nach den Herbstferien besuchten Elisabeth und Konrad die reguläre Dorfschule. Die Grossmutter hütete zu Hause den noch nicht jährigen André, während Irma ihrer Arbeit nachging. Diese Arbeit war für sie erlösend, nicht nur, weil sie damit zu einem Einkommen kam, sondern auch, weil sie sich ablenken konnte und sie sich nicht dauernd mit der Katastrophe, die der scheussliche Krieg in ihr Leben gebracht hatte, auseinandersetzen musste.
In einem Brief hatte sie versucht, ihrem Mann ihre Entscheidungen verständlich zu machen. Telefonate nach Deutschland waren beinahe unmöglich und wenn, wurden sie abgehört. Das wollte Irma nicht riskieren. Auch wurden sämtliche Briefe geöffnet, gelesen und nach Belieben zensiert oder gar konfisziert. Doch sie wählte einen unverfänglichen Text, sie schrieb, als wäre sie eine ehemalige Mitarbeiterin von Brand-Cigars, die sich an ihre Münchner Zeit erinnerte, von ihren Kindern erzählte und hoffte, ihn in besseren Zeiten besuchen zu können. Sie war überzeugt, ihr Mann würde, im Gegensatz zu den Zensoren, die wirkliche Botschaft verstehen.
Sie hatte auf ihren Brief nie eine Antwort erhalten. Einen Monat später war ihr Vater gestorben und kurz danach erhielt sie die Nachricht vom schrecklichen Tod ihres Mannes und Vaters ihrer Kinder.
Soviel wusste André. Er würde versuchen, mehr zu erfahren, nahm er sich vor.
Das grosse Dorf hatte sich in den vergangenen 40 Jahren viel stärker verändert, als er dies in den ersten Tagen wahrgenommen hatte. An jeder Ecke waren neue Wohn- und Geschäftshäuser entstanden, vor allem auch im langgezogenen Zentrum des Dorfes entlang der Haupt- oder Durchfahrtsstrasse.
Überall standen auch noch die kaum übersehbaren Fabrikgebäude der Tabakindustrie, zum Teil ordentlich instand gehalten, andere sahen eher etwas heruntergekommen oder mindestens vernachlässigt aus. Dies war ihm schon bei seinen ersten Streifzügen aufgefallen. Doch erst nach einigen Wochen begriff er, dass hinter den hohen Fenstern dieser Säle niemand mehr Zigarren wickelte. Zwar prangten an vielen Fassaden noch immer die Namen der einstigen Fabrikherren oder deren Marken, da und dort in messingglänzenden Lettern, doch die Räume dahinter wurden nun beispielsweise als Lager für alte Möbel genutzt.
Wo waren die Hunderte und Aberhunderte von Arbeiterinnen und Arbeiter der Region hingegangen? Wovon lebten alle diese Leute jetzt?
Doch das war noch nicht alles. Das Schmauchtal hatte auch Fabriken der Metallindustrie gehabt, in denen Profile, Bleche, Drähte und hochpräzise Drehbänke, Werkzeugmaschinen entstanden. Davon gab es nicht mehr viel. Tausende von Leuten, schätzte er, hatten in all diesen zum Teil riesigen Hallen und kleinen Fabriken gearbeitet. Jetzt standen sie scheinbar leer oder wurden nur noch zu einem kleinen Teil von wenigen Leuten genutzt. André erinnerte sich daran, als er als Sekundarschüler um die Mittagszeit nach Hause trödelte, wie während mehreren Minuten Hunderte von Arbeitern auf ihren durch den Fahrwind leise surrenden Fahrrädern an ihm vorbei zu ihren Mittagstischen pedalten. Es gab wenige Autos, einige Motorräder, doch um diese Mittagszeit und eine Stunde danach auf der Fahrt zurück in die Fabrik beherrschten die Fahrräder die Strasse.
Jetzt gab es sie nicht mehr, die Männer auf ihren Rädern. Wovon lebten die Menschen jetzt? All diese Fragen beschäftigten André sehr.
Im August reiste er für eine Woche an den Starnberger See zu seiner Schwester. Es galt, endlich die Erbschaft zu regeln. Die Mutter hinterliess zwar ein schuldenfreies Haus, aber darüber hinaus war nicht sehr viel geblieben. André würde also, um im Haus bleiben zu können, die Anteile seiner Schwester und Konrads Familie ausbezahlen und dabei Hypothekarschulden machen müssen. Darüber hatte er nie nachgedacht.
Das alles hatte ihm der Anwalt Peter Gramper, den Elisabeth mit den Abklärungen beauftragt hatte, erläutert und dabei auch den Vorschlag gemacht, den Nachkommen in Brasilien zu raten, das Erbe in der Schweiz zu belassen, um es vor dem galoppierenden Zerfall der brasilianischen Währung zu schützen. So blieben die Erben in Brasilien Miteigentümer des Hauses und könnten beispielsweise den anfallenden jährlichen Mietzins problemlos in Brasilien einführen.
Diese Idee gefiel auch Elisabeth für ihren Erbteil, umso mehr, als sie selbst keine Kinder hatte und das Geld für sich selbst nicht brauchte.
Anfänglich machte sich André Sorgen, wie er diese Miete mit seiner Rente schaffen würde, doch seine Bank war zu seinem eigenen Erstaunen sehr offen, man würde ihm im Hinblick auf das völlig unbelastete Haus nötigenfalls das Geld für diese Zinsen für zwei Jahre vorschiessen und in der Zwischenzeit könne er sich nach einem Zusatzeinkommen umsehen.
Zudem war André nicht mittellos. Miriam hatte ihm seinen Anteil an der gemeinsamen Wohnung ausbezahlt. Jetzt fehlte nur noch die Zusage aus Brasilien.
Eduardo, Ines und Sonja waren nie von São Paulo weggezogen. Sie lebten nach wie vor bei Silvias Verwandten. Ines, die Ältere, hatte ein Handelsdiplom geschafft und arbeitete in der Niederlassung einer grossen amerikanischen Werbeagentur.
Sonja besuchte das Lyzeum der katholischen Schule, die Elisabeth von ihrer einstigen Reise her kannte und wollte angeblich Lehrerin werden.
Keines der drei Kinder dachte je daran, seine schweizerische Herkunft und Nationalität wahrzunehmen. Ihr verstorbener Vater war eine für sie unwirkliche Erinnerung und die Umstände seines Todes erschienen ihnen noch immer als tragisches, aber gleichzeitig in ihrer Welt nicht seltenes Schicksal. Niemand in der Sippe ihrer Mutter machte davon ein grosses Aufhebens und niemand hatte je weiter versucht, die Wahrheit über die Hintergründe oder gar den oder die Täter zu finden.
Alle glaubten – oder mindestens schienen sie das zu glauben –, Konrad sei das Opfer einer bösen Organisation geworden und er hätte versucht, deren Machenschaften zu verhindern oder gar aufzudecken.
Viele der Verwandten, vor allem die Frauen, sahen in allem einfach eine Fügung Gottes. Die Männer neigten eher zur Selbsthilfe, ohne jedoch, keinesfalls offen, an Gott zu zweifeln. Das alles erzählte Elisabeth auf Grund der bisher eingegangenen Briefe und Belege.
André verbrachte ein paar gute Tage bei der alleinstehenden 70-jährigen Elisabeth. Sie bedauerte, keine Kinder und im Gegensatz zu Tante Helene auch keines adoptiert zu haben. Ihr Leben sei dazu zu unstet gewesen, meinte sie. Harald war sein Leben lang gereist und auch nach seiner Pensionierung antiken Ausgrabungen nachgegangen. Sie wollte nicht zu Hause auf ihn warten, also reiste sie, wenn immer möglich mit. Diese Art Leben hatte sie erst durch seinen Tod aufgeben müssen. Erst in neuester Zeit, nach dem Tod ihrer Mutter, mache sie sich ab und zu Gedanken über ihr eigenes Ende und ihren Nachlass. Harald wollte immer einen Teil seines Vermögens einer Stiftung schenken, habe sich jedoch nie dazu aufgerafft, etwas zu regeln. Sein Tod nach einem Hirnschlag kam unerwartet, auch er hinterliess ausser ihr keine direkten Erben. Ihrer Meinung nach könne man also mit Konrads Kindern in Brasilien grosszügig umgehen.
André brachte die Gespräche mit seiner Schwester immer wieder auf seinen Vater, seine Herkunft, sein Leben und sein schwieriges Ende. Im Gegensatz zu ihm hatte Elisabeth ihn gekannt. Sie war neun Jahre alt gewesen, als Mutter und Kinder in die Schweiz zogen, um der sich anbahnenden Katastrophe zu entgehen.
In jenem letzten Jahr vor dem Kriegsende war der Betrieb aus Mangel an Tabak beinahe eingestellt worden. Es wurde zwar noch gearbeitet, aber nur mit ziemlich minderwertigem Kraut aus deutschem Anbau. Vieles davon ging an die Truppen der Wehrmacht und der SS. Packungen und Schachteln trugen das Hakenkreuz als mehr oder weniger erzwungenes Bekenntnis zum Regime.
Lothar Werth galt als linientreu, er tat, was die rüden Parteibonzen erwarteten, er stellte auch Leute ein, die man ihm zuteilte und war Mitglied der NSDAP, das musste er sein. Man vertraute ihm auch noch, als Irma und die Kinder in die Schweiz fuhren.
Es waren Mitglieder der Gestapo, die plötzlich begannen, näher hinzuschauen. Als Irma die Heilstätte verlassen hatte und mit ihren Kindern zu den Eltern gezogen war, hatte sie von der durch die Schweizer Behörden schon ziemlich in Bedrängnis gekommene Davoser «Gauleitung» einen Hinweis bekommen. Die Frau sei jetzt geheilt, hiess es, aber warum fuhr sie nicht zurück ins Reich? Die Frau war nie krank gewesen, war die nächste Entdeckung. Der Arzt in München wurde eingezogen, unter Druck gesetzt und Lothar Werth jetzt überwacht. Man gab ihm Zeit, doch als Irmas Brief kam, war alles klar. Die ungebetenen Leser durchschauten Irmas etwas hilflosen Trick. Lothar und der Arzt gehörten zu den letzten Opfern der Nazis in München. Nur wenig später kamen die Amerikaner in die Stadt.
Die braunen Machtbesessenen hatten auch versucht, die Bundesbehörden der Schweiz auf die irreguläre Situation der vier «Reichsangehörigen» im Schmauchtal aufmerksam zu machen und ihre Auslieferung zu erwirken. Die Sache wurde in Bern schon im Hinblick auf die Kriegssituation auf die lange Bank geschoben und die Gemeinde hatte inzwischen für Irma und ihre Kinder in aller Eile die Anerkennung als Flüchtlinge beantragt. Auch dieses Gesuch wurde auf die lange Bank geschoben. Als Witwe konnte Irma in einem vermutlich beschleunigten Verfahren wieder Schweizerin werden und damit wurden auch ihre Kinder Bürger des Landes.
Lothar Werth war kein Münchner gewesen. Er kam aus dem badischen Brühl. Dort hatte 1932 ein verheerendes Feuer einen grossen Teil einer Zigarrenfabrik zerstört. Um die 50 Leute mussten entlassen werden, darunter auch der als Betriebsleiter ausgebildete Lothar Werth. Jetzt war auch klar, warum Mutter Irma nie etwas über Lothars Familie erzählt hatte, als ob es sie nicht gegeben hätte. In einem Album fanden sich zwar Bilder von Irmas und Lothars Hochzeit mit den beiderseitigen Eltern, und auch zur Taufe der beiden älteren Kinder waren sie angereist, aber sonst traf man sich kaum. Man reiste nicht so viel damals.
Lothars Eltern waren während des Krieges verstorben und seine beiden Brüder kamen «auf dem Feld der Ehre» um. Warum er selbst sich von der Wehrmacht fernhalten konnte, war nicht herauszufinden. Vielleicht war Rauchzeug kriegswichtiges Gut und eventuell wussten die Brands in der Schweiz mehr darüber, argwöhnte Elisabeth.
Während Stunden unterhielten sie sich über ihre Kindheit und lachten über Szenen mit ihrer Grossmutter.
65 Jahre alt war sie gewesen, als ihr Mann unter entsetzlichen Schmerzen starb. Er bekam zwar Morphium, der Arzt hatte ihr beigebracht, ihm die Spritzen zu geben. Sie litt jedes Mal dabei, fürchtete sich, einen vielleicht tödlichen Fehler zu begehen und musste sich doch dazu zwingen, sich an die vorgegebenen Dosen und Abstände zu halten, um ihm die unausweichlichen Schübe zu ersparen oder wenigstens zu verkürzen. Hin und wieder bat er sie, den tödlichen Fehler mit der Spritze zu machen und ihn so von seinen Qualen zu erlösen. Sie wusste, dass im «Reich» leidende Menschen mit Methode umgebracht wurden, aber auch, dass sie damit nicht in Ruhe würde weiterleben können. Es war für sie ein Albtraum, Zeugin seines Leids zu sein, und doch wollte sie seinen unbedingten Willen, zu Hause und keinesfalls im Spital zu sterben, respektieren. Im Gegensatz zu Irma, die in der Fabrik arbeitete und damit den Tag ausser Haus verbringen konnte, war sie immer da, nicht nur seinetwegen, sondern auch, um die Kinder zu betreuen. Elisabeth war jetzt zehn, Konrad sieben und Andreas nicht einmal jährig.
Die kleine, fast scheu wirkende, bescheidene und vor allem sparsame Frau aus Ravensburg, die so liebenswürdig schwäbelte, war unsäglich dankbar, ihre beiden Kinder und die drei Enkel endlich in der Schweiz zu haben und mit ihnen zusammenleben zu können. Jetzt, da ihr Mann im Sterben lag, konnte sie verstehen, warum er in den 20er Jahren alles daran gesetzt hatte, ihren Sohn Ernst zur weiteren Ausbildung in ein Schweizer Institut zu bringen. Hilde war nicht sehr religiös, aber sie glaubte an so etwas wie die Vorsehung. Vielleicht hatte Sebastian eine innere Ahnung vom kommenden Unheil gehabt? Auch sein Entschluss, nach der Reichskristallnacht die Führung der Niederlassung in München abzugeben und in der Schweiz in Rente zu gehen, konnte sie anfänglich nicht verstehen. Er war doch damals noch voll dabei, jeden Tag!
«Er hat einfach alles hingeschmissen und ist abgehauen, werden sie sagen», hatte sie ihm vorgeworfen. «Sollen sie» war alles, was er darauf erwiderte. Seine innersten Motive hatte er nie verraten.
Vermutlich wollte er sich keinesfalls in die Nähe der entfesselten Nazihorden gerückt sehen, von Anfang an nicht. Aber vieles liess sich nicht vermeiden. Schon als Hitler an die Macht kam, war er verunsichert gewesen. ‚Kommt Zeit, kommt Rat›, dachte er damals und wurde dabei durch die Mitarbeit von Marcel Brand, der mit seiner jungen Frau, ihrem kleinen Heinz und dem ängstlichen Kindermädchen nach München kam, gestützt.
In jenen Jahren hatte Marcels Mama als eigentliche Chefin und Seele des Unternehmens noch immer in allen Belangen das Sagen. Auch sie, die sich seit 30 Jahren voll auf Sebastian verlassen hatte, mahnte zur Geduld. Nichts würde so heiss gegessen wie angerichtet, meinte sie. Und doch nagten die Zweifel unerbittlich. Es kam der Tag, an dem die Nazis ihr Hakenkreuz auf den Schachteln und den Zigarrenringen sehen wollten. Es gab dagegen zwar irgendwelche politisch-ideologischen Gründe, aber doch für die Mehrheit der Deutschen keinen sachlichen Anhaltspunkt. Er gab auch zu, seine Meinung sei noch immer, dass die deutschen Brand-Cigars in Wirklichkeit ein Schweizer Produkt seien, doch das Stammhaus gab nach und Sebastian lenkte ein. Aber nach seinem Gusto war das alles nicht. Und jetzt, 1938, war auch die Zeit der Mama Brand vorbei. Vielleicht war dieses Motiv stärker als die Kristallnacht. Hilde wusste es nicht. Vermutlich dachte Sebastian, seinem Nachfolger und Schwiegersohn Lothar Werth würde dies alles leichter fallen.
Die Oma genoss die Enkelkinder. Daneben hielt sie ein gutes Dutzend Hühner und zwei Katzen. Sie hätschelte einen Gemüsegarten, zog Himbeeren und Brombeeren und nutzte die Früchte von drei Obstbäumen, die ebenfalls im Garten standen. Sie war und fühlte sich nach wie vor als Besitzerin des Hauses, dafür hatte Sebastian gesorgt und Irma war damit zufrieden. Sie beschaffte zwar mit ihrer Arbeit weitgehend die laufenden Lebenskosten, doch hin und wieder steuerte Hilde vom Angesparten etwas bei, vor allem für die Kinder. Sie bezahlte die damals noch nicht selbstverständlichen Musikstunden und Instrumente, kam im Sommer und im Winter für die Kosten von Lagerferien in den Bergen auf, gab Geld für die vielen Bücher, die die jungen Leute lasen, weil die Oma sie dazu anhielt und schon mit zwölf bekamen sie ein Radio.
Im Alltag war die Oma sparsam bis geizig, denn, so argumentierte sie, es war ja nicht ihr Geld, das sie ausgab, sondern das von Irma. Sie trug haarklein jede Ausgabe in ein Buch ein, kochte so spärlich, dass es kaum Reste gab, und wenn, machte sie anderntags daraus eine Suppe. Sie streute böse Blicke, wenn jemand seinen Teller nicht leer ass und es gab böse Worte, wenn jemand auch nur einen Krumen Brot liegen liess. Die schwäbische Gemütlichkeit hatte eben zwei Seiten.
Anfänglich nähte sie den beiden grösseren Kindern Röcke und Hosen, später nutzte sie die Zeit, während sie Radio hörte, mit Stricken: Socken, Pullover und Mützen. Alles, was sich flicken liess, wurde auch geflickt, mit Garn, Nadel und Strumpfkugel.
Auf der Rückfahrt ins Haus seiner Kindheit erinnerte sich André an diese kleinen und doch so prägenden Erlebnisse der Vergangenheit. Eigentlich hatte Oma in all den Jahren die Arbeit seiner Mutter gemacht, fiel ihm auf.
Doch das war nicht die ganze Wahrheit. Irma machte sehr wohl ihren Teil. Am Abend arbeitete sie mit den Kindern die Schulaufgaben durch, übte mit Elisabeth die langweiligen Etüden auf dem Klavier, auch vierhändig, begleitete Konrads Querflötenspiel und forderte den noch kleinen André mit der Blockflöte heraus. Im Sommer begleitete sie die Kinder zum Schwimmen an den See. Sie war selbst eine gute Schwimmerin und hatte den Kindern dieses Können so früh wie möglich beigebracht. Im Winter besuchte sie mit ihnen Museen und kleine Theater in Stadt und Land, ging sogar ins Kino, wenn es Filme gab, die für sie zugelassen waren oder die sie für zuträglich hielt. Sie verwickelte sie auch in Gespräche über Gott und die Welt. Sie war selbst kaum gläubig, hielt aber darauf, dass sie die Stunden mit den Konfirmanden besuchten. Das war bei Elisabeth kein Problem, jedoch bei Konrad schon. Bei André hatte sie resigniert.
Und jetzt, da er älter war, fragte er sich auch, wie wohl seine Mutter damit fertig geworden war, so ganz ohne Mann zu leben. Er war sich sicher: Da gab es nichts und niemanden. Dabei war sie doch erst 37 gewesen, als sie ihn verlassen hatte, ohne dies wirklich zu wollen, nur auf bessere Zeiten wartend und hoffend. 60 Jahre hatte sie mehr oder weniger allein gelebt. Nein, nicht allein, 20 Jahre mit ihrer Mutter und ihnen, den Kindern. An die 40 Jahre lebte sie dann noch allein in diesem Haus, die letzten zwei oder drei Jahre davon im Altenheim. Kein Wunder, dass sie das Haus nicht verkaufen wollte. Das Haus war ihre Festung gewesen.
Wie wäre sein Leben wohl verlaufen, wenn sie die Flucht in die Schweiz unterlassen hätten? Diese Frage beschäftigte André im Zug auf der Rückfahrt in die Seeweite. Alles an seiner Herkunft erschien ihm an den Tabak gebunden. Trotzdem waren er und Elisabeth Tabakmuffel. Beide waren sie geprägt von einer gewissen Feindseligkeit gegenüber diesem stinkenden, schwelenden, schmauchenden, rauchenden, zerstörenden und mordenden Kraut und dem ganzen Drumherum. Beiden war jedoch auch klar, wie vieles sie diesem Kraut und dem Drumherum zu verdanken hatten.
Im Lauf der Gespräche hatte sich Elisabeth nach Tante Helene, die in Wirrwil im Altenheim lebe, erkundigt und wollte ihm kaum glauben, als André ihr versicherte, dies nicht gewusst zu haben, denn seines Wissens nach sei sie doch nach dem Tod ihres Mannes ins Tessin gezogen. Er versprach, gelegentlich bei ihr vorbeizuschauen.