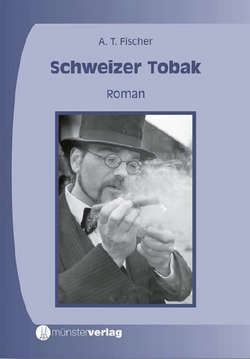Читать книгу Schweizer Tobak - Albert T. Fischer - Страница 9
Landleben
ОглавлениеUm die Jahrhundertwende, als Louis Brand mit seiner Frau die ersten Firmenerfolge feierte, lebte Emma Lönz mit ihrem Vater und ihrer Grossmutter abseits vom Dorf auf dem Stadelhof, einem der grösseren Anwesen auf dem Kreuzacher Dürrbühl.
Ihr kleingewachsener Vater Gottfried Lönz, Göpf genannt, galt als Grobian. Er hatte einen Klumpfuss und konnte nur hinkend gehen.
Die wirkliche Herrin auf dem Stadelhof war Stine, Göpfs Mutter, Emmas Grossmutter. Sie war die Einzige, die ihren zum Jähzorn neigenden und seine Behinderung immer wieder verfluchenden Sohn zu bändigen vermochte. Das war wichtig, denn zum Hof gehörten zehn Kühe, einige Kälber und Rinder. Ohne Melker oder Knecht und im Sommer mit weiteren Helfern, meistens Taglöhnern und einer Magd als Hilfe für die alte Frau, war die Arbeit nicht zu bewältigen.
Emma war wie einst ihre Mutter ein eher feingliedriges Mädchen und schien der Grossmutter nicht stark genug, um auf dem Hof so etwas wie eine brauchbare oder gar vollwertige Magd zu werden. Schon während ihrer Schuljahre musste die Kleine lernen, Tabakblätter auszurippen. Die Alte holte den Tabak jeden Freitag, um eine Woche später die ausgerippten Blätter abzuliefern. Emma war ein geschicktes Mädchen. Sie tat mit Fleiss, was die Grossmutter ihr zumutete, denn nur so blieb diese einigermassen bei guter Laune. Zwar war der Lehrer mit der Schülerin nicht zufrieden. Er besuchte Stine und erzählte ihr, das Mädchen schlafe oft während des Unterrichts, aber er möge sie nicht bestrafen, weil er glaube, die Arme müsse zu Hause zu viele Stunden arbeiten.
Das brachte Stine aus der Fassung. Was er sich da ausdenke, sei eine Frechheit. Die Emma müsse kaum je länger als bis zehn Uhr abends arbeiten und auch am Morgen vor Kirchgang und Schule verlange sie nur ganz selten einen Einsatz, höchstens an Freitagen, wenn die Lieferung für die Fabrik nicht erfüllt sei. Dann müsse sie halt um vier oder halb fünf aufstehen und den Rest bewältigen, aber sie selbst helfe ihr dabei immer.
Der Lehrer gab sich damit nicht zufrieden. Er erzählte Stine, Kinderarbeit werde in Zukunft bedeutend stärker geahndet. Es gehe nicht an, dass die Familien nach wie vor ihre Kinder ausbeuteten. Er werde wiederkommen und mit ihm ein Fräulein aus Sankt Gallen, das gegenwärtig eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema mache. Ihr könne sie dann alles sagen, was sie mit der Emma mache und wie sie darüber denke. Die schreibe alles auf und daraus werde zuletzt ein Buch über die Kinderarbeit im Schmauchtal. Das machte Stine stutzig. Er solle sich hüten, dieses Fräulein vorbeizubringen, einen Dreck werde sie der erzählen, in ihrem Haus mache sie, was sie für richtig finde und das gehe bei Gott niemanden etwas an. Kinder müssten sich von klein auf an Arbeit gewöhnen, sonst werde nie etwas aus ihnen und jetzt solle er gehen, sonst rufe sie den Göpf und der werde ihm dann seine Schulmeisterflausen austreiben.
Kinderarbeit war zwar in jenen Jahren längst verboten. Es war jedoch die Grossmutter, die jede Woche einmal mit ihrem Wägelchen die entrippten Blätter brachte, die neuen Bündel holte und den Lohn kassierte. Dass die kleine Emma ihrer Grossmutter ab und zu behilflich war, kümmerte niemanden. Weil Emma sehr geschickt war, bekam sie mit vierzehn Arbeit in der Fabrik. Das stille, fleissige, bescheidene Mädchen war beliebt bei ihren Kolleginnen, aber auch beim Aufseher und schliesslich auch bei Mama Brand.
Die älteren Frauen hatten Emmas Mutter ebenfalls gekannt. Böse Zungen im Dorf wollten wissen, eine andere Frau als jenes schüchterne Mädchen armer Leute hätte der Wüterich Göpf nie bekommen, ihre Eltern hätten das zarte Ding an Stine und ihren Göpf verramscht, er habe seine Frau verprügelt und einige behaupteten, sie sei überhaupt nicht an den Folgen von Emmas Geburt gestorben, sondern am Elend der endlosen Quälereien ihres Mannes.
Sechs Tage die Woche sass das Mädchen im Fabriksaal auf ihrem Stuhl und verarbeitete ihre Chargen. Nach vier Jahren hatte sie es zur Wickelmacherin gebracht, doch Stine holte nach wie vor jeden Freitag Tabakblätter, und wenn Emma am Abend nach jeweils zehn Stunden Fabrikarbeit nach Hause kam, setzte sie sich in der Stube an den Tisch zum Ausrippen bis zehn oder elf Uhr nachts. In den Wintermonaten, wenn es draussen weniger Arbeit gab, setzten sich Stine, die Magd, der Knecht und der Göpf dazu und alle arbeiteten im Licht einer trüben Petrollampe mit. Die mittlerweile junge Frau war blasser und trauriger geworden. In den letzten Wochen vor ihrem 17. Geburtstag wurde ihr während der Arbeit in der Fabrik ab und zu übel und sie musste sich erbrechen. Hin und wieder weinte sie still vor sich hin. Auf Fragen zu ihrer Verfassung zuckte sie die Achseln, lächelte beschwichtigend und meinte, es sei nichts, sie fühle sich einfach etwas müde. Damit stiess sie auf Verständnis und auch Anteilnahme.
Es gab viel zu reden im Dorf, als Emma, für jedermann unerwartet, von ihrem unehelichen Kind entbunden wurde. Nach wenigen Wochen ging sie wieder in die Fabrik und Stine hütete den kleinen Lukas. Das Rätselraten über die mögliche Vaterschaft dauerte über Monate. Die völlig verdatterte junge Mutter weinte zwar oft, schwieg aber eisern zu dieser Frage.
Erst im August 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach und der Knecht Melchior Stramm zum Militärdienst eingezogen wurde, meldeten er und Emma sich zur Hochzeit an. Im Dorf sickerte durch, Melch sei der Vater von Lukas und nur im Hinblick auf den möglichen Krieg hätten sich Göpf und seine Mutter dazu überwinden können, die Schande ihrer Tochter, sich mit dem Knecht eingelassen zu haben, offenzulegen. Schon im September fand die Hochzeit statt. Der Mann konnte sich, niemand wusste, warum, vom weiteren Militärdienst befreien und blieb auf dem Hof.
Melchior Stramm fühlte sich jetzt nicht mehr als Melker und Knecht. Er getraute sich beinahe von einem Tag auf den anderen, dem Göpf entgegenzutreten. Schon kurz nach der Hochzeit nannte er ihn laut und schadenfreudig Klumpsack, drohte ihm seinerseits mit Prügeln und erschreckte die alte Stine jeden Tag mindestens einmal mit einem Riesengebrüll über irgendetwas, das ihm nicht passte. Auf diese Weise erhielt Emma in der Küche endlich fliessendes Wasser, das sie bis dahin kübelweise vom Brunnen in die Küche schleppen musste und nur wenige Wochen danach sagte die Alte ja zur Installation von elektrischem Licht im ganzen Haus.
Emma befahl er ungeduldig, ihre Arbeit in der Fabrik aufzugeben und den Haushalt zu übernehmen. Von jetzt an solle Stine entweder in die Fabrik gehen oder zu Hause allein ausrippen. So, wie Emma bisher Vater und Grossmutter beinahe unterwürfig und vor allem aus lauter Angst gehorchte, so folgte sie den Ansprüchen ihres Mannes. Der Magd aber sagte Melch, wenn sie sich der neuen Ordnung füge, könne sie bleiben, sonst müsse sie gehen. Die Martha – eine schon etwas ältere Jumpfer, wie man damals ledige Frauen nannte – hatte keine grosse Wahl, fügte sich und blieb.
Die Veränderungen auf Göpfs Hof wurden im Dorf sehr schnell wahrgenommen und jedermann wunderte sich.
Der Winter kam und ging vorüber.
Nicht alles entwickelte sich zum Guten. Im Frühling wurde der kleine Lukas zwei Jahre alt, stand noch immer nur wackelig auf den Beinen und begann kaum damit, einzelne Wörter zu reden. Er schlief oder schrie, wollte oft nicht essen und bewegte sich wenig. Melch interessierte sich für den Kleinen wenig, aber er nahm ihn ab und zu auf die Arme und sagte zu ihm: «Dir verdanke ich mein ganzes Glück, bleib gesund, Kleiner.» Dann tätschelte er ihm die Wangen, gab ihn seiner Mutter oder legte ihn ins Bettchen zurück.
Wenn er schrie, gab ihm Stine von ihrem sogenannten Kräutersud. Allmählich wurde Emma etwas neugierig, womit die Grossmutter ihren Urenkel beruhigte. Sie nahm von Kräutern und dem Sud eine Probe und lief damit zum Apotheker. Der war entsetzt. Die Inhalte waren mehr als fragwürdig. Da sei Mohn dabei, der hier wachse, giftiges Zeug. Bestimmt wurde der Bub dadurch in seiner Entwicklung bereits behindert.
Es kam zu einem ersten nachhaltigen Streit zwischen Stine und ihrer Enkelin. Melch sass mit in der Küche und sicherte so den Ausgang der Auseinandersetzung. Als alles raus war, nannte er Stine eine alte Hexe, eine Giftmischerin, früher hätte man solche verbrannt. Die Stine war entsetzt und bekreuzigte sich.
Da nun Stine nach wie vor Woche für Woche mit dem Handwagen Tabakblätter holte, sie in der Stube allein ausrippte und Freitag für Freitag ablieferte, begann Emma aufzublühen. Im Sommer erwartete sie ihr zweites Kind, den Moritz. Und in den drei Jahren danach kamen noch zwei, Michael und der jüngste, Alois.
Während diese drei ehelichen Söhne prächtig gediehen, blieb Lukas ein Kümmerling. Was ihn auszeichnete, war seine stets gute Laune und sein unstillbarer Appetit. Als ob er nachholen wollte, was er als Säugling versäumt hatte, ass er, was ihm in die Hände fiel. Emma musste schon bald alles wegschliessen, was in der Küche herumstand. Er machte sich selbst hinter die für die Schweine gedämpften Kartoffeln oder hinter den Krug mit dem Sauerrahm her.
Mit sieben ging Lukas zur Schule. Er war ein fetter kleiner Junge mit auffallend kleinem Kopf, kleinen Händen, kurzen Beinen und kleinen Füssen. Nach einer Woche schickte ihn der Dorflehrer nach Hause, er solle in einem Jahr wieder kommen.
So blieb ihm ein weiteres Jahr, um die Hühner zu jagen, auf den Wiesen erfolglos Schmetterlingen nachzurennen und seiner Mutter kleine Sträusse zu pflücken.
Emma hatte sich mit dem etwas dümmlichen Lukas, wie Melch ihn nannte, abgefunden. Sie liebe ihn, wie er halt sei, erklärte sie, wenn jemand es wissen wollte. Manchmal weinte sie bei so dummen Fragen.
Es gab nur einen Ärger, den sie dem Jungen nie verzieh. Er blieb Bettnässer. Beinahe jede Nacht liess er sein Wasser fahren. Sie tauschte sich darüber mit allen möglichen Leuten aus und versuchte alle Ratschläge nacheinander umzusetzen. Nichts half.
Als der Bub mit acht nochmals einen Einstieg in die Schule versuchte, behielt ihn der Lehrer zwar, aber der Pfarrer fand, Lukas würde nie richtig beichten lernen und demnach in Sünde leben müssen. Er fände dies unhaltbar und empfahl, den Kleinen in ein katholisches Heim zu geben, wo er vielleicht auch ein wenig schreiben und lesen lernen könnte, aber ganz bestimmt ein richtiges Kind Gottes werden würde.
Emma wollte ihren Buben nicht hergeben und Melch scheute die Kosten. Nur der Göpf machte sich für die Lösung stark und meinte, er würde für die Kosten aufkommen. Nach Ostern 1923, er war gerade zehn Jahre alt, schloss sich die Tür zwischen Emma und Lukas, den Melchior beinahe von Anfang an Lucky nannte.
An Pfingsten reiste Emma mit Melch an die Reuss zu dem alten umgebauten Kloster. Blass, traurig und sichtbar leichter geworden sah Lukas aus. Er sei erkältet gewesen, sagte die Nonne, die ihn betreute. Sie lud die beiden Gäste zur nachmittäglichen Vesper ein, dort würde Lukas mitsingen, lächelte die gute Schwester Cäcilie. Danach gab es im Refektorium zusammen mit anderen Besuchern Tee und etwas Konfekt. Um vier war die Besuchszeit vorbei. Emma und Melch mussten gehen. Erst auf der Heimfahrt wurde Emma bewusst, dass sie ihren Lukas nicht fünf Minuten für sich allein gehabt hatte.
Der Sommer kam und damit die strengste Zeit auf dem Hof. Es gab keine Besuche mehr an der Reuss. Für Weihnachten setzte Emma durch, dass Lukas nach Hause kommen durfte.
Lukas war verändert. Er hatte vor allem sein Lachen und seine sonst alltägliche Freude verloren. Als Melch ihn am zweiten Weihnachtstag zurückbringen wollte, begann er zu weinen. Er erbrach sein ganzes Essen und bat erbärmlich, bleiben zu dürfen. Also fuhr Melch allein hin, um die Sache zu klären. Der Direktor der Anstalt, ein Geistlicher, zeigte sich entrüstet. Es verstosse gegen jede konsequente Erziehung, wenn ein Kind aus einem Programm gerissen werde, in dem die kleine Seele Gott zugeführt werde.
Emma zog ihren besten Rock an und besuchte Mama Brand. Diese Frau stand damals noch immer der Brand Zigarrenfabrik vor. Inzwischen hatte sie in Deutschland längst eine Niederlassung gegründet, das Unternehmen auf beiden Seiten des Rheins durch die Kriegsjahre gesteuert und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Tabaks gemeistert. Sie hatte allen Widerwärtigkeiten getrotzt und sich allen Vorurteilen gegenüber Frauen als Vorgesetzten erfolgreich gestellt.
Als Emma Lukas zur Welt gebracht hatte, hatte sich die Mama, wie sie inzwischen genannt wurde, um Emma Sorgen gemacht und war dabei auf Zurückweisung oder mindestens Zurückhaltung gestossen. Emma wollte sich von niemandem helfen lassen, sie brach einfach in Tränen aus. Abschliessend hatte die Mama gesagt: «Kind, wenn du mir etwas zu sagen hast, komm und sag es mir.» Nun ging Emma hin und erzählte ihr von Lukas, ihrem kleinen dummen Buben.
Sie werde sich der Sache annehmen, das hatte die Mama versprochen.
Lukas konnte zur Schule gehen, der Dorflehrer übte sich in Geduld und nach Ostern liess ihn der Pfarrer, nach einer umständlich geplapperten Beichte, am weissen Sonntag zur ersten Kommunion. Mama Brand hatte ganze Arbeit geleistet. Obwohl sie reformiert war, also nicht den richtigen Glauben hatte, konnte es sich der geistliche Herr nicht erlauben, ihre Wünsche zu übergehen. Mamas jährlicher Obolus war ihm zu wichtig.
Lukas lernte ein wenig lesen, mit Karten spielen und dabei auch etwas rechnen. Seine jüngeren Brüder begannen ihn zu überholen, auch ihn dann und wann auszutricksen, aber sie spielten mit ihm und liessen ihn hin und wieder gewinnen – er ahmte sie mehr nach, als dass er von ihnen lernte.
Inzwischen übernahm er auch, meist eher unwillig, einige Arbeiten auf dem Hof. Er liebte es beispielsweise, den Heurechen über die Wiese zu ziehen und freute sich, wie sich die saubere Grasnarbe hinter ihm leicht neigte. So legte er hin und her eine Bahn neben die andere und sie ergaben ein sauberes Abbild seiner Arbeit.
Eines Tages sagte Lukas, er wolle in der Fabrik arbeiten. Lukas bekam seine Stelle als Ausripper. Das waren in der Regel vier Handgriffe, bei denen den Tabakblättern die Rippen ausgezogen wurden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten erreichte er eine bemerkenswerte Geschicklichkeit.
Zu seinem 20. Geburtstag schenkte ihm eine Frau im Dorf den zwilchenen Anzug ihres verstorbenen, nur wenig grösseren und ähnlich massigen Mannes. Zum braunen Kleid gehörten zwei Hosen, ein Gilet, ein Hut, zwei weisse Leinenhemden und ein schwarzer Krawattenknopf. Sie überliess ihm zudem einen Stock mit Elfenbeingriff und, was ihn am meisten freute, die Taschenuhr des Verstorbenen.
Der Schneider im Dorf machte ein paar Änderungen, kürzte die Hosen und das alles ohne grosse Rechnung. Lukas hatte seiner Mutter von allem nichts erzählt und sich am folgenden Sonntag ohne Ankündigung die neuen Sachen angezogen.
Er setzte sich am Morgen zum Kaffee im neuen Gewand an den Tisch, zog sich danach Gilet und Jacke an, setzte sich den Hut auf den Kopf, nahm den Stock und zog ins Dorf zur Kirche, zur Messe. Er werde dort für seine Mutter beten. Emma war sehr krank.
Mit 84 Jahren starb Stine. Sie arbeitete bis in die letzten Wochen, fuhr mit ihrem Wägelchen zur Fabrik und zurück. Sie war eine der letzten Heimarbeiterinnen. Die Betriebe waren zunehmend auf eine gleich bleibend hohe Qualität der Deckblätter angewiesen und diese liess sich in der Fabrik leichter sichern. Auch wurde die inzwischen verdeckte oder geleugnete Ausbeutung der Kinder durch die eigenen Eltern mehr und mehr als Schande gebrandmarkt und die Fabrikherren wollten nicht länger an den Pranger gestellt werden.
Nach Stines Tod versuchte der von Melchior durch die Jahre immer wieder gedemütigte Göpf einen Befreiungsschlag.
Als Alleinerbe seiner Mutter verkaufte er hinter Melchs Rücken Mama Brand zu Handen ihres Sohnes Marcel auf dem Dürrbühl ein Stück Land. Das war keine Kleinigkeit, um die vier Hektar, ein Drittel der gesamten Fläche, die zum Hof gehörte, in unmittelbarer Nachbarschaft, deutlich über dem Hof, durch Buschwerk getrennt, an schönster Lage mit Sicht auf See und Alpen vom Säntis bis zur Jungfrau, zum Bau einer Villa.
Von Melch zur Rede gestellt, behauptete er, Stine hätte das Ganze noch zu Lebzeiten eingefädelt. Die Villa werde dem neu verheirateten Sohn, der gegenwärtig mit seiner jungen Frau noch in München lebe und dem sie, da sie selbst schon beinahe siebzig sei, die Leitung der Fabrik übertragen wolle, als Wohnhaus dienen.
In der Folge geschah Unglaubliches: Melch warf seinen Schwiegervater aus dem Haus und befahl ihm, in der Scheune über dem Stall in dem Zimmer, in dem er einst als junges Knechtlein sein Bett hatte, zu hausen und zu schlafen. Er solle nur noch zum Essen ins Haus kommen dürfen.
Alle Proteste, auch Emmas Bitte, ihn nicht dermassen zu demütigen, halfen nichts. Er meinte, die Buben bräuchten ohnehin mehr Platz und Lukas sein eigenes Zimmer. Melch blieb bei seiner Entscheidung. Er räumte Göpfs Bett und Kasten eigenhändig um und brachte den ganzen Krempel in die Scheune.
Die Geschichte wurde bald auch im Dorf bekannt und jedermann wunderte sich, warum sich der Göpf diese Demütigung gefallen liess. Grundsätzlich hätte er doch seinerseits seinen Schwiegersohn mit der ganzen Familie vom Hof verjagen können, doch nichts Derartiges geschah.
Kurz nachdem Lukas 20 geworden war und sich über seinen neuen Anzug freute, lag seine Mutter im Sterben. Auch an ihrem Begräbnis trug er seine neue Kleidung, mit einem schwarzen Band um den linken Arm. Am Grab zog er seinen Hut, nahm von Melchior den Weihwasserwedel, um den Sarg zu besprengen, gab ihn weiter an seinen Bruder, übernahm die kleine Schaufel mit etwas Erde, schüttete diese ins Grab, gab die Schaufel weiter, bekreuzigte sich auf Stirn, Mund und Brust und folgte Melchior. Erst zu Hause begann er hemmungslos zu weinen.
Drei Tage nach Emmas Begräbnis erhängte sich ihr Vater in der Tenne neben dem Stall. Im Dorf waren die Menschen entsetzt.
Melch arbeitete zusammen mit einem Knecht und einer Magd auf dem Hof von früh bis spät und versuchte, nicht auf das Gerede zu achten. Nur wenige Monate nach Göpfs Tod verliessen ihn auch sein Knecht und seine Magd, Grund für neues Gerede.
Als Knecht zog der 20-jährige Lorenz Gramper aus dem Entlebuch, der Melchior in vielem an seine eigene Herkunft erinnerte, in den Verschlag über dem Stall, als Magd fand er eine ledige Frau aus der Ostschweiz. Er bezahlte einen guten Lohn und zu essen gab es genug. Das war den beiden das Wichtigste. Melch wurde sehr, sehr einsam.
Das alles geschah noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Brand-Cigars war im kleinen Kreuzach zu einem der grossen Betriebe der Region angewachsen. Was weder im Dorf noch im Schmauchtal kaum jemand ausser der Konkurrenz wusste, war, welche Bedeutung Brand-Cigars in Deutschland noch vor dem Zweiten Weltkrieg erreichte. Zweitausend Arbeiterinnen und Arbeiter produzierten dort für die deutsche Marktführerin Brand-Cigars.