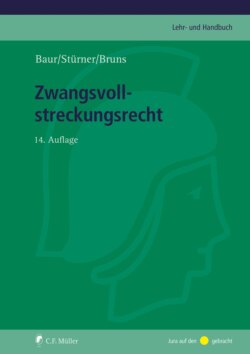Читать книгу Zwangsvollstreckungsrecht, eBook - Alexander Bruns - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
ОглавлениеVorwort
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Erstes Kapitel Grundlagen des Einzelvollstreckungsrechts
§ 1 Zweck und Funktion des Einzelvollstreckungsrechts 1.1
I. Zwangsvollstreckung als Rechtsverwirklichung 1.1, 1.2
II. Zwangsvollstreckung als Bestandteil verfassungsrechtlicher Rechtsschutzgewährleistung 1.3
III. Das Verhältnis von Erkenntnisverfahren und Vollstreckungsverfahren 1.4 – 1.8
1. Erkenntnisverfahren ohne nachfolgende Zwangsvollstreckung 1.5
2. Vollstreckungsverfahren ohne vorangegangenes Erkenntnisverfahren 1.6
3. Gleichzeitiges Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren 1.7, 1.8
IV. Einzelvollstreckung und Gesamtvollstreckung 1.9, 1.10
§ 2 Grundzüge des Vollstreckungsverfahrens
I. Die Grundstruktur des Vollstreckungsverfahrens 2.1, 2.2
1. Das Erkenntnisverfahren und seine innere Gliederung 2.1
2. Das Vollstreckungsverfahren und die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2.2
II. Die Ausgestaltung des Vollstreckungsverfahrens 2.3 – 2.8
1. Antragsverfahren 2.3
2. Einseitigkeit 2.4
3. Prüfung der Vollstreckungsvoraussetzungen 2.5
4. Bindung der Vollstreckungsorgane 2.6
5. Form der Vollstreckungsakte 2.7
6. Wirkung von Vollstreckungsakten 2.8
III. Die Vollstreckungsarten 2.9 – 2.13
1. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen (§§ 802a–882h) 2.10
2. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen (§§ 883–886) 2.11
3. Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen 2.12
4. Zwangsvollstreckung zur „Erwirkung“ einer Unterlassung oder Duldung (§ 890) 2.13
IV. Die vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelfe 2.14 – 2.21
1. Arten von Rechtsbehelfen 2.14 – 2.17
a) Die Erinnerung 2.15
b) Drittwiderspruchsklage 2.16
c) Vollstreckungsgegenklage 2.17
2. Grundsätze der Rechtsbehelfsverfahren 2.18 – 2.21
a) Klageverfahren 2.19
b) Erinnerungsverfahren 2.20
c) Beschwerdeverfahren 2.21
V. Gesetzesquellen und Gesetzesaufbau 2.22 – 2.26
1. Gesetzesquellen 2.22
2. Gesetzesaufbau 2.23 – 2.26
a) Der Aufbau des Buches Zwangsvollstreckungsrecht 2.23
b) Die Gliederung des allgemeinen Teils 2.24, 2.25
c) Gliederung und systematische Stellung des Zwangsversteigerungsgesetzes 2.26
VI. Der Bereich der zivilprozessualen Zwangsvollstreckung 2.27 – 2.40
1. Zivilprozessuale Vollstreckung und Vollstreckung anderer staatlicher Akte 2.27
2. Die Reichweite zivilprozessualer Vollstreckung 2.28 – 2.30
a) Formale Abgrenzung 2.28
b) Entscheidungen in Familiensachen sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit 2.29
c) Ansprüche der Justizbehörden 2.30
3. Entscheidungen anderer Gerichte 2.31 – 2.36
a) Arbeitsgerichte 2.32
b) Allgemeine und besondere Verwaltungsgerichte 2.33 – 2.35
c) Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof 2.36
4. Verwaltungseigene Titel 2.37 – 2.40
a) Anwendungsbereich der Verwaltungsvollstreckung 2.37
b) Rechtsgrundlagen der Verwaltungsvollstreckung 2.38
c) Besonderheit der Verwaltungsvollstreckung 2.39
d) Geltung zivilprozessualen Vollstreckungsrechts 2.40
§ 3 Die Geschichte der Einzelvollstreckung
I. Römisches Recht 3.2 – 3.8
1. Die Vollstreckung im Legisaktionenverfahren 3.2
2. Die Vollstreckung im Formularverfahren 3.3, 3.4
3. Die Vollstreckung des Kognitionsverfahrens 3.5 – 3.8
II. Der germanische Prozess 3.9 – 3.13
1. Frühzeit, Volksrechte und Karolingerzeit 3.9, 3.10
2. Mittelalterliche Rechtsentwicklung 3.11 – 3.13
III. Der italienisch-kanonische Prozess 3.14, 3.15
IV. Die Vollstreckung des gemeinen Prozesses 3.16 – 3.19
V. Partikulare Gesetzgebung, französisches Recht und Reichszivilprozessordnung 3.20, 3.21
VI. Die weitere Entwicklung von der liberalen zur sozialen Vollstreckung 3.22 – 3.26
1. Die Gläubigerherrschaft des französischen Systems 3.22
2. Ausbau des Schuldnerschutzes und Aktivierung des Gerichts 3.23 – 3.25
a) Ausbau des Sozialschutzes 3.24
b) Aktivierung des Gerichts 3.25
3. Novellengesetzgebung und Kodifikation 3.26
VII. Würdigung der historischen Entwicklung 3.27 – 3.31
1. Von der Personal- zur Realexekution 3.28
2. Geldvollstreckung und Naturalvollstreckung 3.29
3. Parteimacht und Gerichtsmacht 3.30
4. Humanisierung und Schuldnerschutz 3.31
§ 4 Stand und Reform des Einzelvollstreckungsrechts
I. Wirtschaftliche Daten 4.1 – 4.4
1. Gerichtsvollzieher 4.2
2. Amtsgerichte 4.3, 4.4
a) Mobiliarvollstreckung 4.3
b) Immobiliarvollstreckung 4.4
II. Rechtssoziologie und Vollstreckung 4.5, 4.6
1. Soziologie des Vollstreckungsschuldners 4.5
2. Vollstreckungsorgane als „Sozialingenieur“? 4.6
III. Grundsatzreform des Einzelvollstreckungsrechts? 4.7 – 4.10
1. Grundsätzliche Mängel 4.7
2. Grundzüge einer Grundsatzreform 4.8
3. Würdigung 4.9, 4.10
IV. Systemimmanente Reformvorschläge 4.11 – 4.37
1. Die wichtigsten Reformvorschläge 4.12 – 4.17
a) Allgemeiner Teil 4.12
b) Mobiliarpfändung 4.13
c) Forderungspfändung 4.14
d) Räumungsvollstreckung 4.15
e) Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung 4.16
f) Sachaufklärung, Eidesstattliche Versicherung und Haft 4.17
2. Die Verwirklichung in neueren Reformen oder Reformvorhaben 4.18 – 4.25
3. Würdigung 4.26 – 4.37
V. Die neuen Bundesländer 4.38 – 4.45
1. Das Vollstreckungsrecht in der früheren DDR 4.38
2. Würdigung 4.39
3. Die Übergangsregelung 4.40 – 4.45
a) Grundsatz 4.40
b) Schwebende Vollstreckungsverfahren 4.41
c) Frühere DDR-Titel 4.42 – 4.44
d) Ehegattenvollstreckung 4.45
§ 5 Die Vollstreckungsbeteiligten und ihre Rechtsbeziehungen
I. Die Beteiligten 5.2 – 5.5
1. Gläubiger und Schuldner 5.3
2. Vollstreckungsorgane 5.4
3. Betroffene Dritte 5.5
II. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten 5.6, 5.7
1. Die drei Rechtsverhältnisse 5.6
2. Das „Vollstreckungsrechtsverhältnis“ 5.7
III. Das Antragsverhältnis 5.8 – 5.11
1. Der Antrag und seine Bescheidung 5.8
2. Der Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Antragsverhältnissen 5.9
3. Vollstreckungsanspruch und verfassungsmäßiger Justizgewährungsanspruch 5.10
4. Vollstreckungsanspruch und vollstreckbarer Anspruch 5.11
IV. Das Eingriffsverhältnis 5.12 – 5.16
1. Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 5.12
2. Gesetzmäßigkeit und materielle Prüfung 5.13, 5.14
3. Staatlicher Eingriff, Gemeinwohl und Schuldnerschutz 5.15, 5.16
V. Das Vollstreckungsverhältnis 5.17 – 5.24
1. Begriff 5.17
2. Vollstreckungsgegenstand 5.18
3. Rechtmäßigkeit der Vollstreckung 5.19 – 5.22
a) Rechtskraft und Präklusion 5.19
b) Rechtskräftiges Urteil und ungerechtfertigte Vollstreckung 5.20
c) Rechtskräftiger Vollstreckungsbescheid und ungerechtfertigte Vollstreckung 5.21
d) Ungerechtfertigte Fortführung der Vollstreckung 5.22
4. Vorläufig vollstreckbares Urteil und ungerechtfertigte Vollstreckung 5.23
5. Vertragswidrige Vollstreckung 5.24
VI. Drittverhältnisse 5.25 – 5.27
1. Gestörte Dritte 5.26
2. Einbezogene Dritte 5.27
§ 6 Grundsätze der Einzelvollstreckung
I. Verfahrensgrundsätze und Dogmatik des Einzelvollstreckungsrechts 6.1 – 6.4
1. Bedeutung von Verfahrensgrundsätzen 6.1
2. Geltungsbereich der Verfahrensgrundsätze 6.2
3. Herkunft vollstreckungsrechtlicher Verfahrensgrundsätze 6.3
4. Vollstreckungsgrundsätze und Verfassung 6.4
II. Allgemeine Verfahrensgrundsätze 6.5 – 6.36
1. Grundsatz der Parteidisposition 6.5 – 6.19
a) Parteiherrschaft über Anfang und Ende der Vollstreckung 6.6 – 6.13
aa) Gläubigerherrschaft 6.6, 6.7
bb) Schuldnerherrschaft 6.8
cc) Einverständliches Parteihandeln 6.9, 6.10
dd) Einbruchstellen der Offizialmaxime 6.11 – 6.13
b) Parteiherrschaft über Vollstreckungsart und Vollstreckungsgegenstand 6.14 – 6.18
aa) Das Dispositionsrecht des Gläubigers 6.14, 6.15
bb) Disposition des Schuldners 6.16
cc) Parteivereinbarung über Art und Gegenstand der Vollstreckung 6.17
dd) Würdigung der Parteiherrschaft über Art und Gegenstand der Vollstreckung 6.18
c) Disposition über das Verfahrensrecht der Vollstreckung? 6.19
2. Amtsbetrieb und Parteibetrieb 6.20
3. Beibringungsgrundsatz oder Inquisitionsgrundsatz 6.21 – 6.25
a) Grundsätzliche Geltung des Beibringungsgrundsatzes 6.22, 6.23
b) Die Erforschung durch den Gerichtsvollzieher als Einbruchstelle des Inquisitionsgrundsatzes 6.24
c) Rechtsvergleichung und Reform 6.25
4. Einseitigkeit und Gehör 6.26 – 6.30
a) Grundsatz der Einseitigkeit 6.27
b) Verwirklichung im einfachen Recht 6.28, 6.29
c) Würdigung 6.30
5. Schriftlichkeit und Mündlichkeit 6.31, 6.32
a) Verfahrenseinleitung 6.31
b) Mündliche Verhandlungen und Erörterungen 6.32
6. Öffentlichkeit 6.33, 6.34
a) Öffentlichkeit als Ausnahme 6.33
b) Parteiöffentlichkeit 6.34
7. Grundsatz der Vollstreckungsbeschleunigung 6.35, 6.36
a) Eingeschränkte gesetzgeberische Verwirklichung 6.35
b) Würdigung und Kritik 6.36
III. Vollstreckungsspezifische Verfahrensgrundsätze 6.37 – 6.75
1. Prioritätsgrundsatz 6.37 – 6.43
a) Die Geltung des Prioritätsprinzips 6.38, 6.39
b) Das Prioritätsprinzip im materiellen Recht 6.40
c) Die Rechtfertigung des Prioritätsprinzips 6.41 – 6.43
aa) Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung 6.41
bb) Vor- und Nachteile des Prioritätsprinzips 6.42
cc) Bewertung 6.43
2. Naturalvollstreckung und Geldliquidation 6.44 – 6.46
a) Begriffe 6.44
b) Freie Wahl zwischen Naturalvollstreckung und Geldliquidation 6.45, 6.46
3. Dezentralisierung und Zentralisierung der Vollstreckung 6.47 – 6.52
a) Begriffe und Zusammenhänge 6.47
b) Die dezentrale Organisation des geltenden Rechts 6.48 – 6.50
c) Würdigung 6.51, 6.52
4. Formalisierungsgrundsatz 6.53 – 6.63
a) Inhalt des Formalisierungsgrundsatzes 6.53
b) Durchbrechungen oder Auflockerungen der Formalisierung? 6.54 – 6.63
aa) Auslegung von Rechtsbegriffen 6.55
bb) Handlungsermessen 6.56
cc) Rechtsmissbräuchliche Vollstreckung 6.57, 6.58
dd) Materiellrechtliche Evidenzkontrolle? 6.59, 6.60
ee) Formalisierung der Erfüllungskontrolle 6.61 – 6.63
5. Numerus clausus der Vollstreckungsarten 6.64 – 6.66
a) Begriff 6.64
b) Geltung und Begründung 6.65, 6.66
6. Grundsatz des beschränkten Vollstreckungszugriffs 6.67 – 6.70
a) Begriff 6.67
b) Ausformung im geltenden Recht 6.68, 6.69
c) Würdigung 6.70
7. Grundsatz formgebundener Verwertung 6.71, 6.72
a) Bedeutung 6.71
b) Die Ausformung im geltenden Recht 6.72
8. Grundsatz effektiver Verwertung 6.73 – 6.75
a) Bedeutung 6.73
b) Geltung im gegenwärtigen Recht 6.74
c) Würdigung 6.75
§ 7 Vollstreckung und Verfassung
I. Die verfassungsrechtliche Rechtsschutzgewährleistung zu Gunsten des Gläubigers 7.1
II. Die verfassungsmäßigen Grenzen des Vollstreckungszugriffs beim Schuldner 7.2 – 7.18
1. Eingriffe in das Eigentum 7.2
2. Eingriffe in Gesundheit 7.3
3. Eingriffe in die persönliche Freiheit 7.4 – 7.12
a) Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 7.5, 7.6
b) Vollstreckung durch Willensbeugung 7.7 – 7.12
4. Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung 7.13
5. Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 7.14
6. Beschränkter Vollstreckungszugriff und Verfassung 7.15, 7.16
7. Effektive Verwertung und Verhältnismäßigkeit 7.17, 7.18
III. Verfahrensgestaltung und Verfassung 7.19 – 7.37
1. Parteiautonomie und faires Verfahren 7.19, 7.20
a) Parteidisposition über Anfang und Ende als Freiheitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) 7.19
b) Gewährleistung eines fairen Verfahrens 7.20
2. Gläubigerdisposition über Art und Gegenstand der Vollstreckung und Verhältnismäßigkeit 7.21, 7.22
3. Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes in der Vollstreckung 7.23 – 7.25
a) Effektiver Rechtsschutz und Vollstreckungsbeschleunigung 7.23
b) Effektiver Rechtsschutz und Naturalvollstreckung 7.24
c) Effektiver Rechtsschutz und Formalisierung 7.25
4. Numerus clausus der Vollstreckungsarten und formgebundene Verwertung im Lichte des Gesetzmäßigkeitsgrundsatzes 7.26 – 7.28
5. Rechtliches Gehör, Öffentlichkeit und Parteiöffentlichkeit 7.29 – 7.32
a) Gehör des Schuldners 7.29, 7.30
b) Parteiöffentlichkeit 7.31
c) Öffentlichkeit? 7.32
6. Garantie vollstreckungsrechtlicher Rechtsbehelfe 7.33
7. Priorität und Rechtsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) 7.34 – 7.37
IV. Verfassungsrechtliche Stellung des Ehegatten des Vollstreckungsschuldners 7.38, 7.39
V. Würdigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Vollstreckungsrecht 7.40 – 7.46
1. Der Bereich verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung 7.40
2. Die Problematik verfassungsgerichtlichen Eingriffs 7.41 – 7.45
a) Falsche Kanonisierung 7.42
b) Beschränkte Fachkompetenz 7.43
c) Schwelle zum Verfassungsverstoß 7.44
d) Grundrechtskollision und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 7.45
3. Verfassungsrichterliche Selbstbeschränkung im Vollstreckungsrecht 7.46
Zweites Kapitel Die Vollstreckungsorgane und das Vollstreckungsverfahren
§ 8 Die Vollstreckungsorgane
I. Der Gerichtsvollzieher 8.1 – 8.30
1. Rechtsstellung 8.1 – 8.4
a) Beamtenrechtliche Stellung 8.3
b) Verfahrensvorschriften 8.4
2. Das Verhältnis zwischen Gerichtsvollzieher und Gläubiger 8.5 – 8.7
a) Öffentlichrechtliche Natur 8.5
b) Die Befugnisse des Gerichtsvollziehers im Verhältnis zum Gläubiger 8.6
c) Gefahrübergang und Eigentumserwerb 8.7
3. Das Verfahren des Gerichtsvollziehers 8.8 – 8.11
a) Funktionelle Zuständigkeit 8.9
b) Örtliche Zuständigkeit 8.10
c) Einzelheiten 8.11
4. Die Wohnungsdurchsuchung durch den Gerichtsvollzieher 8.12 – 8.25
a) Die verfassungsgerichtlichen Vorgaben 8.13
b) Die Verhältnismäßigkeit 8.14
c) Grundsätzliche Erforderlichkeit der richterlichen Erlaubnis 8.15
d) Geschäftsräume 8.16
e) Mehrere Gläubiger 8.17
f) Eheliche Wohnungen und Wohngemeinschaften 8.18, 8.19
g) Untermiete 8.20
h) Herausgabe und Duldung 8.21
i) Räumung 8.22
j) Haft 8.23
k) Andere Formen gewaltsamer Vollstreckung 8.24
l) Entbehrlichkeit der richterlichen Erlaubnis bei Gefahr im Verzuge 8.25
5. Verfahren der Durchsuchungsanordnung 8.26 – 8.29
a) Grundzüge und Grundfragen 8.27
b) Umfang der Anordnung 8.28
c) Rechtsbehelf 8.29
6. Kritik 8.30
II. Das Amtsgericht (Vollstreckungsgericht) als Vollstreckungsorgan 8.31 – 8.35
1. Funktionelle Zuständigkeit 8.31
2. Zuweisung an den Rechtspfleger 8.32 – 8.34
a) Verfassungsrechtliche Problematik 8.33
b) Rechtsbehelfproblematik 8.34
3. Örtliche Zuständigkeit 8.35
III. Das Prozessgericht als Vollstreckungsorgan 8.36, 8.37
1. Funktionelle Zuständigkeit 8.36
2. Örtliche Zuständigkeit 8.37
IV. Andere Behörden als Vollstreckungsorgane 8.38, 8.39
1. Grundbuchamt 8.38
2. Einschreiten anderer Behörden 8.39
§ 9 Beginn, Stillstand und Beendigung der Zwangsvollstreckung
I. Beginn der Zwangsvollstreckung 9.2
II. Stillstand der Zwangsvollstreckung 9.3 – 9.12
1. Einstellung der Zwangsvollstreckung und ihre Anordnung 9.4 – 9.10
a) Einstellung auf Anordnung des Gerichts 9.6
b) Einstellung ohne gerichtliche Anordnung 9.7 – 9.9
c) Fortgang nach Einstellung 9.10
2. Tatsächlicher Stillstand 9.11
3. Prüfung der Einstellungsvoraussetzungen 9.12
III. Beendigung der Zwangsvollstreckung 9.13 – 9.15
1. Beendigung im Ganzen 9.14
2. Beendigung einzelner Vollstreckungsmaßnahmen 9.15
IV. Aufhebung einzelner Vollstreckungsmaßnahmen 9.16 – 9.19
1. Aufhebungsgründe 9.17
2. Aufhebung durch das Vollstreckungsorgan 9.18
3. Durchführung der Aufhebung 9.19
§ 10 Vollstreckungsverträge
I. Das Vollstreckungsrecht als grundsätzlich zwingendes Recht 10.1, 10.2
II. Einzelne Zulässigkeitsfragen 10.3 – 10.12
1. Vollstreckungserweiternde Verträge 10.4, 10.5
2. Vollstreckungsausschließende Verträge 10.6 – 10.9
a) Materiellrechtliche Vereinbarungen 10.7
b) Regelung von Vollstreckungsmodalitäten 10.8
c) Vollständiger Vollstreckungsausschluss 10.9
3. Gegenständliche Beschränkung der Vollstreckung 10.10 – 10.12
a) Vereinbarung vor Beendigung des Rechtsstreits 10.11
b) Vereinbarung nach Beendigung des Rechtsstreits 10.12
§ 11 Mängel des Zwangsvollstreckungsverfahrens
I. Gesetzmäßigkeitsgrundsatz und fehlerhafter Staatsakt 11.1
II. Anfechtbarkeit als Regelfolge – Verstrickung 11.2, 11.3
III. Verstrickung und Pfändungspfandrecht 11.4 – 11.7
1. Nichtiger Vollstreckungsakt und Pfändungspfandrecht 11.5
2. Anfechtbarer Vollstreckungsakt und Pfändungspfandrecht 11.6
3. Privatrechtliche Voraussetzungen des Pfändungspfandrechtes 11.7
IV. Die Heilung fehlerhafter Vollstreckungsakte 11.8
Drittes Kapitel Die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
§ 12 Mängel des Zwangsvollstreckungsverfahrens
I. Vollstreckungsvoraussetzungen und Formalisierung der Vollstreckung 12.1
II. Titel und Klausel als Vollstreckungsvoraussetzungen 12.2
III. Voraussetzungen des Beginns der Vollstreckung und Vollstreckungshindernisse 12.3 – 12.5
1. Voraussetzungen des Vollstreckungsbeginns 12.3
2. Vollstreckungshindernisse 12.4, 12.5
IV. Personenmehrheiten 12.6
V. Allgemeine Voraussetzungen des Verfahrensrechts 12.7 – 12.15
1. Deutsche Gerichtsbarkeit 12.8
2. Funktionelle und örtliche Zuständigkeit 12.9
3. Rechtswegzuständigkeit 12.10
4. Partei- und Prozessfähigkeit 12.11
5. Prozessvollmacht 12.12
6. Prozessführungsbefugnis 12.13
7. Rechtsschutzinteresse 12.14
8. Rechtskraft 12.15
§ 13 Der Vollstreckungstitel im Allgemeinen
I. Begriff und Wesen des Vollstreckungstitels 13.1
II. Bestimmung der Parteien der Vollstreckung im Titel 13.2
III. Bestimmung von Inhalt und Umfang der Vollstreckung durch den Titel 13.3, 13.4
IV. Verlust des Titels 13.5
V. Mehrheit von Titeln 13.6
VI. Vollstreckbarkeit im engeren und im weiteren Sinne 13.7
§ 14 Die Endurteile
I. Begriff des Endurteils 14.1 – 14.5
1. Endurteile ordentlicher Gerichte 14.2
2. Vollstreckungsfähige Leistungsurteile – Bestimmtheit der Leistung 14.3, 14.4
3. Rechtskräftige und vorläufig vollstreckbare Endurteile 14.5
II. Rechtskräftige Endurteile als Vollstreckungstitel 14.6 – 14.11
1. Rechtsmittelfähige Urteile 14.7
2. Rechtsmittelverzicht 14.8
3. Teilanfechtung 14.9
4. Bedingte Urteile 14.10
5. Künftige Leistungen 14.11
III. Vorläufige Maßnahmen zur Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung (§ 707) 14.12 – 14.28
1. Voraussetzungen 14.13 – 14.17
a) Antrag 14.14
b) Keine Beendigung der Vollstreckung 14.15
c) Einlegung des Rechtsbehelfs 14.16
d) Möglicher Erfolg des Rechtsbehelfs 14.17
2. Inhalt der Maßnahmen 14.18 – 14.23
a) Einstweilige Einstellung 14.19, 14.20
b) Sicherheitsleistung des Gläubigers 14.21
c) Aufhebung der Vollstreckungsmaßnahme 14.22
d) Höhe und Art der Sicherheitsleistung 14.23
3. Zuständigkeit und Form der Entscheidung 14.24
4. Vorläufigkeit der Anordnungen 14.25
5. Abänderung und Aufhebung der Maßnahmen 14.26
6. Entsprechende Anwendung des § 707 14.27, 14.28
a) Kraft Gesetzes 14.27
b) Ohne gesetzliche Anordnung 14.28
§ 15 Die vorläufig vollstreckbaren Urteile
I. Grundsätze vorläufiger Vollstreckbarkeit 15.1 – 15.8
1. Grundsatz der Sicherheitsleistung 15.2
2. Vorläufig vollstreckbare Titel 15.3 – 15.7
a) Urteile 15.4
b) Sonstige Vollstreckungstitel (§ 794) 15.5
c) Ehe- und Kindschaftssachen 15.6
d) Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckbarkeit im weiteren und engeren Sinne 15.7
3. Anordnung von Amts wegen 15.8
II. Die Sicherheitsleistung im Einzelnen 15.9 – 15.31
1. Vorläufige Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung 15.10 – 15.20
a) Besondere Schutzbedürftigkeit des Gläubigers 15.11
b) Eilverfahren 15.12 – 15.15
aa) Versäumnisurteil 15.13
bb) Einspruch 15.14
cc) Neue mündliche Verhandlung 15.15
c) Urteile über geringe Summen 15.16 – 15.18
aa) Verurteilung in der Hauptsache bis 1250,– € 15.17
bb) Kostenerstattungsanspruch 15.18
d) Urteile mit erhöhter Richtigkeitsgewähr 15.19
e) Arreste und einstweilige Verfügungen 15.20
2. Vorläufige Vollstreckung und Sicherheitsleistung des Gläubigers 15.21 – 15.24
a) Bankbürgschaft 15.22
b) Sicherungsvollstreckung 15.23
c) Rückgabe der Sicherheit 15.24
3. Anträge des Gläubigers auf Erlass der Sicherheitsleistung und Schuldnerschutz 15.25 – 15.30
a) Gläubigerantrag auf Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung 15.26
b) Vollstreckungsschutz des Schuldners 15.27 – 15.30
aa) Abwendungsbefugnis 15.28
bb) Besonderer Vollstreckungsschutz 15.29
cc) Nicht zulässiges Rechtsmittel 15.30
4. Tenorierungsbeispiele 15.31
III. Entscheidungen über vorläufige Vollstreckbarkeit nach Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln 15.32 – 15.37
1. Vollstreckbarerklärung bei Teilanfechtung 15.33
2. Vorläufige Maßnahmen nach Einspruch, Berufung, Gehörsrüge und Revision 15.34 – 15.37
a) Einspruch und Berufung – Gehörsrüge 15.35
b) Revision 15.36, 15.37
IV. Vollstreckung aus vorläufigen Titeln 15.38 – 15.41
1. Wirkungen und Beschränkungen der Vollstreckung 15.39
2. Beendigung der vorläufigen Vollstreckbarkeit 15.40, 15.41
V. Schadensersatz bei ungerechtfertigter Vollstreckung 15.42 – 15.64
1. Voraussetzungen der Ersatzpflicht 15.43 – 15.46
a) Aufhebung oder Abänderung der Hauptsacheentscheidung in der Rechtsmittelinstanz 15.44
b) Schaden als Vollstreckungsfolge 15.45
c) Kein Verschulden 15.46
2. Inhalt und Umfang der Ersatzansprüche 15.47 – 15.50
a) Inhalt der Schadensersatzpflicht 15.48
b) Inhalt des Bereicherungsanspruchs 15.49
c) Nebeneinander von Schadensersatz und Bereicherung 15.50
3. Anspruchsinhaber und Anspruchsschuldner 15.51 – 15.53
a) Vertauschte Parteirollen 15.52
b) Rechtsnachfolge 15.53
4. Einwendungen 15.54 – 15.56
a) Mitwirkendes Verschulden 15.55
b) Aufrechnung 15.56
5. Geltendmachung des Anspruchs 15.57 – 15.59
a) Selbstständige Klage 15.58
b) Rechtsverfolgung im anhängigen Rechtsstreit 15.59
6. Rechtsnatur des Anspruchs 15.60
7. Entsprechende Anwendung des § 717 15.61 – 15.64
a) Gesetzliche Fälle 15.62
b) Fälle der Analogie 15.63
c) Ablehnung einer Analogie 15.64
§ 16 Sonstige Vollstreckungstitel
I. Überblick 16.1
II. Gerichtliche Entscheidungen 16.2 – 16.9
1. Kostenfestsetzungsbeschlüsse 16.3
2. Beschwerdefähige Entscheidungen 16.4
3. Vollstreckungsbescheide 16.5
4. Anwaltsvergleiche und Schiedssprüche 16.6 – 16.8
a) Anwaltsvergleiche 16.7
b) Schiedssprüche 16.8
5. Entscheidungen im einstweiligen Verfahren und Unterhaltsbeschlüsse 16.9
III. Der Prozessvergleich 16.10 – 16.16
1. Der Vergleich in den einzelnen Verfahrensarten 16.11
2. Dritte im Vergleich 16.12
3. Vollstreckungswirkung des Vergleichs 16.13
4. Einwendungen gegen den Vergleich 16.14
5. Vollstreckungsklausel 16.15
6. Räumungsvergleich 16.16
IV. Vollstreckbare Urkunde 16.17 – 16.32
1. Voraussetzungen wirksamer Unterwerfung 16.18 – 16.24
a) Notarielle Beurkundung 16.19
b) Unterwerfungsfähigkeit, Bestimmtheit und Rechtsnatur des Anspruchs 16.20
c) Unterwerfungserklärung 16.21 – 16.24
aa) Rechtsnatur 16.22
bb) AGB-Recht 16.23
cc) Dingliche und persönliche Unterwerfung, Eigentümergrundschuld 16.24
2. Vollstreckbare notarielle Ausfertigung 16.25
3. Rechtsbehelfe des Schuldners 16.26 – 16.31
a) Vollstreckungsgegenklage 16.27
b) Erinnerung 16.28
c) Klauselerinnerung 16.29
d) Abänderungsklage 16.30, 16.31
4. Vollstreckungsunterwerfung des Duldungspflichtigen 16.32
V. Vollstreckungstitel außerhalb der ZPO 16.33
VI. Leistungsklage trotz sonstigen Vollstreckungstitels? 16.34
§ 17 Die Vollstreckungsklausel
I. Wesen und Bedeutung 17.1 – 17.3
1. Die Klausel als amtliche Vollstreckbarkeitsbescheinigung 17.1, 17.2
2. Aushändigung der vollstreckbaren Ausfertigung nach Erfüllung 17.3
II. Ausnahmsweise Vollstreckung ohne Klausel 17.4
III. Inhalt der Klausel – vollstreckbare Ausfertigung 17.5
IV. Titelübertragende Klausel 17.6 – 17.27
1. Rechtsnachfolge auf Gläubiger- oder Schuldnerseite 17.7 – 17.19
a) Rechtsnachfolger des Gläubigers 17.8, 17.9
b) Rechtsnachfolger des Schuldners 17.10 – 17.12
aa) Gesamtrechtsnachfolger 17.11
bb) Sonderrechtsnachfolger 17.12
c) Partei kraft Amtes 17.13 – 17.19
aa) Insolvenzverwalter 17.14
bb) Testamentsvollstrecker 17.15, 17.16
cc) Nachlassverwalter 17.17
dd) Zwangsverwalter 17.18
ee) Gesetzliche und gewillkürte Prozessstandschafter 17.19
2. Titelübertragung ohne eigentliche Rechtsnachfolge 17.20 – 17.25
a) Nacherbschaft 17.21
b) Vermögensübernahme und Erbschaftskauf 17.22
c) Fortführung eines Handelsgeschäfts 17.23
d) Nießbrauchbestellung 17.24
e) Bucheigentümer 17.25
3. Verfahren zur Feststellung der Voraussetzungen einer Titelübertragung 17.26, 17.27
V. Titelergänzende Klausel 17.28 – 17.38
1. Vollstreckungsbedingungen 17.29 – 17.31
a) Kassatorische Klausel 17.30
b) Befreiung vom Nachweis der Entstehung und Fälligkeit 17.31
2. Verfahren zur Feststellung des Bedingungseintritts 17.32
3. Voraussetzungen des Vollstreckungsbeginns außerhalb des Klauselerteilungsverfahrens 17.33 – 17.37
a) Sicherheitsleistung 17.34
b) Kalendarische Zeitbestimmung 17.35
c) Fristablauf seit Zustellung 17.36
d) Alternative Leistungspflicht 17.37
4. Zug um Zug vorzunehmende Gegenleistung 17.38
§ 18 Das Verfahren zur Erteilung der Vollstreckungsklausel
I. Zuständigkeit 18.1 – 18.3
1. Gerichtliche Entscheidungen und Prozessvergleiche 18.2
2. Gerichtliche und notarielle Urkunden 18.3
II. Erteilungsverfahren 18.4 – 18.6
1. Antragsverfahren 18.4
2. Prüfungskompetenz im Klauselerteilungsverfahren 18.5
3. Urkundsbeamter und Rechtspfleger 18.6
III. Rechtsbehelfe der Parteien 18.7 – 18.14
1. Rechtsbehelfe des Gläubigers bei Verweigerung der Klausel 18.8
2. Einwendungen des Schuldners gegen die Klauselerteilung (Erinnerung) 18.9 – 18.14
a) Zuständigkeit 18.10
b) Beschränkung auf Prüfung formeller Voraussetzungen der Klauselerteilung 18.11
c) Entscheidung und Rechtsmittel 18.12
d) Einstweilige Anordnungen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit 18.13
e) Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 18.14
IV. Besondere Rechtsbehelfe bei titelübertragender oder titelergänzender Klausel 18.15 – 18.26
1. Klage des Gläubigers auf Klauselerteilung 18.16 – 18.20
a) Zuständigkeit 18.17
b) Rechtsnatur der Klage 18.18
c) Mögliche Einwendungen 18.19
d) Wirkung der Entscheidung 18.20
2. Klage des Schuldners auf Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus der erteilten Klausel 18.21 – 18.26
a) Rechtsnatur der Klage 18.22
b) Zuständigkeit 18.23
c) Mögliche Einwendungen 18.24
d) Vorläufige Maßnahmen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit 18.25
e) Verhältnis zu § 732 18.26
V. Weitere vollstreckbare Ausfertigung 18.27
VI. Klauselerteilung und neue Bundesländer 18.28
§ 19 Die Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten und Lebenspartner
I. Überblick 19.1
II. Die Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten 19.2 – 19.9
1. Drittwiderspruchsklage des anderen Ehegatten 19.2
2. Eigentumsvermutung und Gewahrsamsfiktion 19.3 – 19.9
a) Bedeutung 19.4 – 19.7
b) Geltungsbereich 19.8
c) Verfassungsmäßigkeit der Regelung 19.9
III. Besonderheiten beim Güterstand der Zugewinngemeinschaft 19.10 – 19.14
1. Drittwiderspruchsklage auf Grund § 1368 BGB 19.10, 19.11
2. Vollstreckungsrechtliche Besonderheiten der Ausgleichsforderung 19.12 – 19.14
a) Die Ausgleichsforderung als Pfändungsobjekt 19.13
b) Vollstreckung im Falle des § 1383 BGB 19.14
IV. Besonderheiten beim Güterstand der Gütergemeinschaft 19.15 – 19.23
1. Vollstreckung in das Sonder- und Vorbehaltsgut 19.16
2. Vollstreckung in das Gesamtgut 19.17 – 19.22
a) Alleinverwaltung 19.18
b) Gesamtverwaltung 19.19
c) Erwerbsgeschäft des nicht oder nicht allein verwaltungsberechtigten Ehegatten 19.20
d) Beendete Gütergemeinschaft 19.21
e) Fortgesetzte Gütergemeinschaft 19.22
3. Vorgehensweise des Gerichtsvollziehers 19.23
V. Die Zwangsvollstreckung gegen Lebenspartner 19.24 – 19.27
1. Überblick 19.24
2. Eigentumsvermutung und Gewahrsamsfiktion 19.25
3. Besonderheiten beim Vermögensstand der Ausgleichsgemeinschaft 19.26
4. Besonderheiten beim Vermögensstand der Gütergemeinschaft? 19.27
§ 20 Die Zwangsvollstreckung in den Nachlass und andere besondere Vermögensmassen
I. Die Zwangsvollstreckung in den Nachlass 20.2 – 20.28
1. Allgemeine Grundsätze 20.3 – 20.18
a) Vollstreckungsbeginn vor Tod des Erblassers 20.4, 20.5
aa) Fortsetzung der Vollstreckung (§ 779 Abs.1) 20.4
bb) Bestellung eines besonderen Vertreters (§ 779 Abs. 2) 20.5
b) Vollstreckungsbeginn nach Tod des Erblassers 20.6 – 20.9
aa) Vor Erbschaftsannahme 20.7
bb) Nach Erbschaftsannahme 20.8, 20.9
c) Die Beschränkung der Erbenhaftung 20.10 – 20.17
aa) Geltendmachung durch Erben (§ 781) 20.10
bb) Einordnung der Klage gemäß § 785 ins Rechtsbehelfssystem 20.11, 20.12
cc) Vorbehalt beschränkter Erbenhaftung 20.13 – 20.15
(1) Verfahrensweise 20.14
(2) Anwendungsbereich 20.15
dd) Aufhebung früherer Vollstreckungsmaßnahmen bei Nachlassverwaltung oder -insolvenz 20.16, 20.17
(1) Bei Vollstreckungen ins Eigenvermögen 20.16
(2) Bei Vollstreckungen in den Nachlass 20.17
d) Zusammenfassung 20.18
2. Besonderheiten bei der Miterbengemeinschaft 20.19 – 20.22
a) Vor Nachlassauseinandersetzung 20.19 – 20.21
aa) Vollstreckung in den Nachlass (§ 747) 20.19
bb) Haftungsbeschränkung 20.20, 20.21
(1) Allgemeines 20.20
(2) Vorläufig beschränkte Haftung gemäß § 2059 Abs. 1 BGB 20.21
b) Nach Nachlassauseinandersetzung 20.22
3. Besonderheiten bei Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und Nachlassinsolvenz 20.23 – 20.28
a) Testamentsvollstreckung am Gesamtnachlass und an einzelnen Gegenständen 20.23 – 20.25
aa) Verwaltung des gesamten Nachlasses 20.24
bb) Verwaltung einzelner Nachlassgegenstände 20.25
b) Nachlassverwaltung 20.26
c) Nachlassinsolvenz 20.27, 20.28
II. Die Zwangsvollstreckung in Gesamthandsvermögen 20.29 – 20.39
1. Gesellschaft bürgerlichen Rechts 20.30 – 20.33
a) Vollstreckung von Gesamthandsverbindlichkeiten 20.31
b) Gesamtschuldnerische Haftung einzelner Gesellschafter 20.32
c) Vollstreckung durch „persönliche“ Gläubiger 20.33
2. Offene Handelsgesellschaft 20.34 – 20.38
a) Gläubiger der OHG 20.35
b) Gesamtschuldnerische Haftung einzelner Gesellschafter 20.36
c) Vollstreckung durch „persönliche“ Gläubiger 20.37, 20.38
3. Nicht-rechtsfähiger Verein 20.39
§ 21 Die Voraussetzungen für den Beginn der Zwangsvollstreckung
I. Bestimmtheit der Parteien einer Vollstreckung 21.2
II. Zustellung bestimmter Urkunden 21.3 – 21.8
1. Zustellung des Vollstreckungstitels 21.4 – 21.7
a) Amtsbetrieb 21.5
b) Parteibetrieb 21.6
c) Besonderheiten 21.7
2. Ausnahmsweise Zustellung der Klausel 21.8
III. Bedingter oder befristeter Titel 21.9 – 21.19
1. Sicherheitsleistung 21.10, 21.11
2. Kalendarische Zeitbestimmung bzw. Befristung 21.12 – 21.14
a) Die Vorratspfändung 21.13
b) Die Dauer- bzw. Vorauspfändung 21.14
3. Abhängigkeit der Vollstreckung von einer Zug um Zug-Leistung des Gläubigers 21.15 – 21.19
a) Tatsächliches Angebot 21.15
b) Wörtliches Angebot 21.16
c) Beweis der Befriedigung oder des Annahmeverzugs des Schuldners durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden 21.17
d) Vollstreckung durch das Vollstreckungsgericht 21.18
e) Verurteilung „nach Empfang der Gegenleistung“ 21.19
IV. Folgen des Fehlens von Voraussetzungen für den Vollstreckungsbeginn 21.20
Viertes Kapitel Der Gegenstand der Zwangsvollstreckung
§ 22 Allgemeines
I. Vermögensvollstreckung und Personalvollstreckung 22.1
II. Das Vermögen des Schuldners 22.2 – 22.9
1. Das Schuldnervermögen 22.3
2. Verwertbare Vermögensgegenstände 22.4, 22.5
a) Vermögensbegriff 22.4
b) Spezialitätsgrundsatz 22.5
3. Das gegenwärtige Vermögen 22.6
4. Das gesamte Vermögen 22.7
5. Keine Reihenfolge der Zugriffsmöglichkeiten 22.8
6. Mehrere Vermögensträger 22.9
III. Materiellrechtliche Haftungsbeschränkungen und Haftungserweiterungen 22.10, 22.11
1. Materiellrechtliche Beschränkungen 22.10
2. Materiellrechtliche Erweiterungen 22.11
§ 23 Die unpfändbaren Sachen
I. Reichweite des Pfändungsverbots 23.2 – 23.5
1. Beschränkung auf Vollstreckung wegen Geldforderungen – Pfändung eigener Sachen 23.3, 23.4
2. Materiellrechtliche Wirkungen? 23.5
II. Unpfändbare Gegenstände im Einzelnen 23.6 – 23.12
1. Auswahlkriterien und Fallgruppen 23.6, 23.7
2. Maßgebender Beurteilungszeitpunkt 23.8
3. Amtswegige Prüfung und Rechtsbehelfe 23.9, 23.10
4. Austauschpfändung 23.11
5. Pfändungsschutz für Surrogate? 23.12
III. Sonderschutz für Gegenstände des gewöhnlichen Hausrats 23.13
§ 24 Die aus sozialpolitischen Gründen unpfändbaren Forderungen und der Gläubigerschutz gegen Lohnmanipulation
I. Grundsätze 24.2
II. Pfändungsbeschränkungen beim Arbeitseinkommen und Pfändungsschutzkonto 24.3 – 24.47
1. Der Kreis geschützter Forderungen 24.4 – 24.17
a) Arbeitseinkommen 24.5 – 24.11
aa) Begriff 24.5
bb) Dienst- und Versorgungsbezüge 24.6
cc) Arbeits- und Dienstlöhne 24.7
dd) Ruhegelder und ähnliche Bezüge 24.8
ee) Hinterbliebenenbezüge 24.9
ff) Sonstige Vergütungen für Dienstleistungen aller Art 24.10
gg) Karenzentschädigungen und Versicherungsrenten 24.11
b) Nicht wiederkehrende Dienstleistungsvergütung 24.12
c) Versorgungsrenten 24.13
d) Naturalbezüge 24.14
e) Schutz bei Barauszahlung oder Kontoüberweisung – Pfändungsschutzkonto 24.15
f) Schutz gegen öffentlich-rechtliche Vollstreckung 24.16
g) Unverzichtbarkeit des Schutzes 24.17
2. Volle Unpfändbarkeit 24.18
3. Bedingte Pfändbarkeit („Billigkeitspfändung“) 24.19, 24.20
4. Beschränkte Pfändbarkeit 24.21 – 24.30
a) Laufendes Arbeitseinkommen 24.22 – 24.24
aa) Unpfändbarer Grundbetrag 24.23
bb) Unpfändbarer Teil des Mehreinkommens 24.24
b) Nicht wiederkehrend zahlbare Vergütung 24.25
c) Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens 24.26 – 24.30
aa) Ausgangspunkt 24.27
bb) § 850e Nr. 2 24.28
cc) § 850e Nr. 3 24.29
dd) § 850e Nr. 2a 24.30
5. Einschränkungen des Pfändungsschutzes bei privilegierten Vollstreckungsforderungen 24.31 – 24.37
a) Der Kreis privilegierter Forderungen 24.32
b) Umfang des verbleibenden Pfändungsschutzes 24.33 – 24.35
aa) Notwendiger Unterhalt 24.34
bb) Andere unterhaltsberechtigte Angehörige 24.35
c) Vorrangige Befriedigung aus zusätzlich pfändbarem Betrag 24.36
d) Vorratspfändung 24.37
6. Verfahren zur Berücksichtigung des Pfändungsschutzes 24.38 – 24.42
a) Verfahrensgrundsätze 24.38
b) Die Folgen fehlerhafter Rechtsanwendung 24.39 – 24.42
aa) Kein Pfändungspfandrecht 24.40
bb) Rechtsbehelfe 24.41
cc) Einwendung des Drittschuldners im Einziehungsprozess 24.42
7. Modifikation des Pfändungsschutzes nach richterlichem Ermessen 24.43 – 24.46
a) Schuldnerantrag 24.44
b) Gläubigerantrag bei Forderungen aus unerlaubter Handlung 24.45
c) Gläubigerantrag nach § 850f Abs. 3 24.46
8. Anpassung des Pfändungsschutzes an geänderte tatsächliche Verhältnisse 24.47
III. Gläubigerschutz durch Erweiterung der Pfändbarkeit 24.48 – 24.52
1. Lohnverschleierung 24.49 – 24.51
a) Tatbestand 24.50
b) Pfändung des fingierten Anspruchs 24.51
2. Lohnschiebung 24.52
IV. Pfändungsbeschränkungen bei Sozialleistungsforderungen 24.53 – 24.65
1. Überblick über die gesetzliche Regelung 24.53
2. Der Kreis geschützter Forderungen 24.54
3. Besondere Pfändungsschutzregeln des Sozialrechts 24.55 – 24.61
a) Einmalige Geldleistungen 24.55
b) Laufende Geldleistungen 24.56 – 24.58
aa) Rechtslage vor der Novelle 1994 24.57
bb) Die Neuregelung durch das 2. SGBÄndG 24.58
c) Pfändung von Kindergeld 24.59, 24.60
d) Schutz ausgezahlten Bargeldes und Kontenschutz 24.61
4. Das Pfändungsverfahren und seine besonderen Probleme 24.62 – 24.65
a) Billigkeitsvortrag 24.62, 24.63
b) Blankettpfändung 24.64
c) Rechtsbehelfe 24.65
§ 25 Sonstige unpfändbare Forderungen und Rechte
I. Unpfändbarkeit bei nicht übertragbaren Forderungen und nicht veräußerlichen Rechten 25.1 – 25.10
1. Unübertragbare Forderungen 25.3 – 25.9
a) Unübertragbarkeit auf Grund materiellen Rechts 25.4
b) Unübertragbarkeit nach § 399, 1. Alt. BGB 25.5 – 25.7
c) Pfändbarkeit kraft Vereinbarung unübertragbarer Forderungen 25.8, 25.9
2. Unveräußerliche Rechte 25.10
II. Unpfändbarkeit übertragbarer Ansprüche 25.11 – 25.15
1. Der Pflichtteilsanspruch 25.12
2. Schutz vor Pfändung aus sozialen Gründen 25.13 – 25.15
a) §§ 851a, 851b 25.14
b) § 863 25.15
III. Gesamthandsgemeinschaften 25.16 – 25.21
IV. Folgen des Verstoßes gegen §§ 851, 852 25.22
§ 26 Gläubigeranfechtung
I. Grundgedanken 26.1 – 26.9
1. Ausgangslage 26.1, 26.2
2. Begriff und Abgrenzung 26.3 – 26.9
a) Anfechtungsrecht 26.4, 26.5
b) Rückgewähranspruch 26.6 – 26.9
II. Voraussetzungen 26.10 – 26.50
1. Allgemeine Voraussetzungen 26.12 – 26.20
a) Rechtshandlung 26.12 – 26.15
b) Gläubigerbenachteiligung 26.16, 26.17
c) Zurechnungszusammenhang 26.18 – 26.20
2. Anfechtungsgrund 26.21 – 26.35
a) Vorsatzanfechtung 26.22 – 26.29
aa) Rechtshandlung des Schuldners (§ 3 Abs. 1 S. 1) 26.23, 26.24
bb) Abschluss eines entgeltlichen Vertrages (§ 3 Abs. 1, 2) 26.25 – 26.27
cc) Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners 26.28
dd) Kenntnis des anderen Teils 26.29
b) Schenkungsanfechtung 26.30 – 26.34
aa) Unentgeltliche Leistung 26.31, 26.32
bb) Vornahme binnen Vierjahresfrist 26.33, 26.34
c) Weitere Anfechtungsgründe 26.35
3. Besondere Anfechtungsvoraussetzungen 26.36 – 26.44
a) Gläubigerseite 26.36 – 26.42
aa) Vollstreckbarer Schuldtitel 26.37 – 26.39
bb) Geldforderung 26.40
cc) Fälligkeit 26.41, 26.42
b) Schuldnerseite 26.43, 26.44
4. Einwände des Anfechtungsgegners 26.45 – 26.50
a) Einwände gegen Titel 26.46
b) Einwände gegen den Anspruch 26.47 – 26.49
c) Der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegen das Anfechtungsrecht 26.50
III. Rechtsfolgen 26.51 – 26.88
1. Die Parteien des Rückgewährschuldverhältnisses 26.51 – 26.67
a) Anspruchsinhaber 26.52 – 26.60
aa) Mehrheit von Berechtigten 26.53 – 26.59
bb) Insolvenz des Schuldners 26.60
b) Anfechtungsgegner 26.61 – 26.67
aa) Einzelrechtsnachfolger des Dritten 26.62 – 26.66
bb) Mehrheit von Verpflichteten 26.67
2. Der Inhalt des Rückgewähranspruchs 26.68 – 26.78
a) Grundsatz 26.68 – 26.70
b) Rückgewähr in Natur 26.71 – 26.73
c) Wertersatz in Geld 26.74 – 26.76
d) Gegenrechte des Empfängers 26.77, 26.78
3. Die Geltendmachung der Anfechtung 26.79 – 26.88
a) Klage 26.80, 26.81
b) Einrede 26.82, 26.83
c) Anfechtungsankündigung 26.84
d) Behördlicher Duldungsbescheid 26.85
e) Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes 26.86 – 26.88
Fünftes Kapitel Die einzelnen Arten der Zwangsvollstreckung
Erster Abschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen
Vorbemerkungen
I. Geldforderungen in fremder Währung
II. Haftungsansprüche
III. Zahlungen an Dritte und Befreiungsanspruch
IV. Zwangsvollstreckung einer Wahlschuld
1. Unterabschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das bewegliche Vermögen
§ 27 Pfändung und Pfändungspfandrecht
I. Pfändung und Verstrickung 27.1 – 27.6
1. Begriffe und Funktion 27.2
2. Entstehung und Beendigung der Verstrickung 27.3 – 27.5
a) Entstehung 27.3
b) Beendigung 27.4, 27.5
3. Überpfändung, überflüssige Pfändung, Nachpfändung 27.6
II. Das Pfändungspfandrecht 27.7 – 27.11
1. Gesetzliche Regelung und ihre Streitfragen 27.7
2. Öffentlichrechtliche und privatrechtliche Theorie 27.8 – 27.10
a) Grundpositionen 27.8
b) Schwächen der öffentlichrechtlichen Theorie 27.9
c) Schwächen der privatrechtlichen Theorie 27.10
3. Die „gemischt privat-öffentlichrechtliche Theorie“ 27.11
III. Der Inhalt der gemischt privat-öffentlichrechtlichen Theorie 27.12 – 27.16
1. Die Bedeutung der Verstrickung für das Pfändungspfandrecht 27.12
2. Verstrickung ohne Pfändungspfandrecht 27.13, 27.14
a) Wesentliche Verfahrensfehler 27.13
b) Fehlen materiellrechtlicher Voraussetzungen 27.14
3. Akzessorietät des Pfändungspfandrechtes 27.15
4. Rechte des Inhabers eines Pfändungspfandrechtes 27.16
IV. Das Prioritätsprinzip 27.17, 27.18
1. Unterkapitel Die Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen
§ 28 Die Pfändung beweglicher Sachen
I. Der Gegenstand der Fahrniszwangsvollstreckung 28.1 – 28.6
1. Früchte 28.2
2. Zubehör 28.3
3. Wertpapiere 28.4 – 28.6
a) Grundsatz 28.5
b) Legitimationspapiere 28.6
II. Gewahrsam an beweglichen Sachen 28.7 – 28.14
1. Gewahrsamsbegriff 28.8 – 28.10
2. Grundsätzliches Verbot einer Prüfung der Vermögenszugehörigkeit 28.11
3. Prüfung der Zugehörigkeit zum verwaltungsunterworfenen Vermögen bei Schuldnern kraft Amtes 28.12
4. Gewahrsam Dritter 28.13, 28.14
III. Die Bewirkung der Pfändung 28.15 – 28.30
1. Pfändung durch Inbesitznahme 28.16
2. Inbesitznahme durch Siegelung oder Wegnahme 28.17
a) Siegelung und Pfandanzeige 28.18 – 28.20
b) Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher 28.21 – 28.24
aa) Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere 28.22
bb) Gefährdung des Vollstreckungserfolges 28.23
cc) Obhutspflicht des Gerichtsvollziehers 28.24
3. Benachrichtigung des Schuldners 28.25
4. Schätzung des Werts der Pfandstücke 28.26
5. Besitzverhältnisse nach Pfändung 28.27 – 28.29
a) Bei Schuldnergewahrsam 28.28
b) Bei Wegnahme durch den Gerichtsvollzieher 28.29
6. Aufhebung der Pfändung 28.30
IV. Die Anschlusspfändung 28.31 – 28.35
1. Voraussetzungen 28.32
2. Bewirkung der Anschlusspfändung 28.33
3. Rechtsstellung des Gläubigers 28.34
4. Verwertung 28.35
§ 29 Die Verwertung der gepfändeten Sachen
I. Verwertungspraxis – Aufschub und Aussetzung der Verwertung 29.1, 29.2
1. Verwertungspraxis 29.1
2. Der zeitweilige Vollstreckungsaufschub 29.2
II. Die Verwertung gepfändeten Geldes durch Ablieferung 29.3, 29.4
1. Verfahren 29.3
2. Rechtswirkungen von Wegnahme und Ablieferung 29.4
III. Die Verwertung anderer Sachen 29.5 – 29.20
1. Öffentliche Versteigerung als Regelform 29.6 – 29.13
a) Formalien, Zuschlag, Mindestgebot 29.7
b) Rechtliche Wertung der Versteigerung 29.8 – 29.13
aa) Rechtsnatur von Gebot und Zuschlag 29.9
bb) Eigentumserwerb des Erstehers 29.10
cc) Gefahrübergang hinsichtlich des Erlöses 29.11
dd) Erlös als Surrogat des Pfandgegenstandes 29.12
ee) Ersteigerung eigener Sachen 29.13
2. Freihändiger Verkauf seitens des Gerichtsvollziehers 29.14
3. Modifikation der Verwertung durch den Gerichtsvollzieher oder auf Grund einer Anordnung des Vollstreckungsgerichts 29.15 – 29.18
a) Verwertung auf andere Art oder an einem anderen Ort 29.16, 29.17
aa) Bedeutung und Voraussetzungen 29.16
bb) Freihändiger Verkauf und Zwangsüberweisung 29.17
b) Versteigerung durch andere Person 29.18
4. Verwertung mehrfach gepfändeter Sachen – Konkurrenz mit Vertragspfandrecht 29.19, 29.20
IV. Verwertung ohne Pfändungspfandrecht – Eigentumserwerb am Gelderlös und Ausgleich nach Schadensersatz- und Bereicherungsrecht 29.21 – 29.25
1. Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche nach Verwertung fremder Sachen 29.22, 29.23
2. Ausgleich bei fehlendem vollstreckbarem Anspruch 29.24
3. Ausgleich bei Verstoß gegen Verfahrensvorschriften 29.25
2. Unterkapitel Die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte
§ 30 Die Zwangsvollstreckung in Forderungen
I. Grundsätze 30.1
II. Pfändbare Forderungen und Rechte 30.2 – 30.8
1. Geldforderungen 30.3 – 30.5
2. Unpfändbare Forderungen 30.6
3. Forderungen aus einem Kontokorrent bzw. Girokonto 30.7
4. Bankguthaben 30.8
III. Das zuständige Vollstreckungsgericht 30.9
IV. Das Pfändungsverfahren 30.10 – 30.18
1. Das Gesuch des Gläubigers 30.11
2. Grundsatz des fehlenden rechtlichen Gehörs 30.12
3. Der Pfändungsbeschluss und sein Inhalt 30.13 – 30.16
a) Notwendige Angaben 30.14
b) Bestimmtheit der zu pfändenden Forderung 30.15
c) arrestatorium und inhibitorium 30.16
4. Zustellung an Drittschuldner und Schuldner 30.17
5. Rechtsbehelfe bei fehlerhafter Pfändung 30.18
V. Wirkung und Umfang der Pfändung 30.19 – 30.29
1. Wirkung der Verstrickung und des Pfändungspfandrechts 30.20 – 30.24
a) Befugnis des Gläubigers zur Vorbereitung und Sicherung der Einziehung 30.21
b) Rechtsstellung des Vollstreckungsschuldners 30.22
c) Rechtsstellung des Drittschuldners 30.23, 30.24
2. Umfang der Pfändung 30.25 – 30.27
a) Teilpfändung und Vollpfändung 30.26
b) Besonderheiten der Pfändung von Arbeitseinkommen 30.27
3. Mitpfändung von Zinsen und Nebenrechten 30.28
4. Hilfspfändung 30.29
VI. Verwertung und Überweisung 30.30 – 30.40
1. Überweisung zur Einziehung 30.31 – 30.35
a) Das Rechtsverhältnis Gläubiger – Vollstreckungsschuldner 30.32
b) Das Verhältnis Gläubiger – Drittschuldner 30.33
c) Forderung als Bestandteil des Schuldnervermögens 30.34
d) Akzessorietät des Pfändungspfandrechts bei Pfändung der Vollstreckungsforderung 30.35
2. Überweisung an Zahlungs statt 30.36
3. Anordnung einer anderen Art der Verwertung 30.37
4. Die Stellung des Drittschuldners nach Pfändung und Überweisung 30.38 – 30.40
a) Schutz des gutgläubigen Drittschuldners 30.39
b) Einwendungen des Drittschuldners gegen die Klage des Gläubigers 30.40
VII. Pfändung für mehrere Gläubiger 30.41
VIII. Die Vorpfändung 30.42
§ 31 Besondere Formen der Forderungspfändung
I. Pfändung und Verwertung hypothekarisch gesicherter Forderungen 31.1 – 31.7
1. Pfändungsbeschluss 31.2
2. Briefübergabe oder Eintragung 31.3 – 31.5
a) Briefübergabe (einschließlich Hilfspfändung) 31.4
b) Grundbucheintragung bei Buchhypotheken 31.5
3. Verwertung der Hypothekenforderung 31.6
4. Pfändung des Rechts auf Befriedigung aus dem Versteigerungserlös nach Zwangsversteigerung 31.7
II. Pfändung von Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung körperlicher Sachen 31.8 – 31.16
1. Anspruch hinsichtlich beweglicher Sachen 31.9 – 31.11
2. Anspruch hinsichtlich unbeweglicher Sachen 31.12 – 31.16
a) Pfändung des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums 31.13, 31.14
b) Pfändung der Auflassungsanwartschaft 31.15
c) Anspruch auf Herausgabe eingetragener Schiffe 31.16
§ 32 Die Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte
I. Grundlagen 32.1 – 32.7
1. „Andere Vermögensrechte“ 32.1 – 32.4
a) Die Kasuistik 32.2
b) Bruchteilseigentum 32.3
c) Selbstständigkeit und Übertragbarkeit der Rechte 32.4
2. Art und Weise der Zwangsvollstreckung 32.5 – 32.7
a) Pfändung 32.6
b) Verwertung 32.7
II. Gesellschafts- und Gemeinschaftsanteile 32.8 – 32.16
1. BGB-Gesellschaft und OHG 32.9 – 32.12
a) Zwangsvollstreckung in den Anteil am Gesellschaftsvermögen 32.10
b) Zwangsvollstreckung in das Auseinandersetzungsguthaben 32.11, 32.12
2. GmbH 32.13
3. Aktiengesellschaft 32.14
4. Miterbengemeinschaft 32.15
5. Eheliche Gütergemeinschaft 32.16
III. Anwartschaftsrechte 32.17 – 32.20
1. Doppelpfändungs-Theorie 32.18
2. Sachpfändungs-Theorie 32.19
3. Rechtspfändungs-Theorie 32.20
IV. Grund-, Rentenschulden und Reallasten 32.21 – 32.29
1. Allgemeines 32.22
2. Eigentümergrundschuld 32.23 – 32.28
a) Analogie zur Pfändung von hypothekarisch gesicherten Forderungen 32.24
b) Pfändung nach § 857 Abs. 2 32.25
c) „Künftige“ Eigentümergrundschulden 32.26
d) Verwertung der Eigentümergrundschuld 32.27
e) Pfändung des Versteigerungserlöses 32.28
3. Rückübertragungsanspruch bei Sicherungsgrundschulden 32.29
V. Immaterialgüterrechte 32.30 – 32.45
1. Urheberrecht 32.31 – 32.35
a) Zwangsvollstreckung gegen den Urheber 32.32, 32.33
b) Zwangsvollstreckung gegen den Rechtsnachfolger 32.34
c) Die Zwangsvollstreckung in Nutzungsrechte 32.35
2. Verlagsrecht 32.36
3. Gewerbliche Schutzrechte 32.37 – 32.44
a) Begriffe 32.37, 32.38
b) Abgestufter Schutz gewerblicher Immaterialgüterrechte 32.39 – 32.43
c) Verwertung 32.44
4. Lizenzen 32.45
VI. Computersoftware 32.46 – 32.48
1. Sachpfändung und Rechtspfändung 32.47
2. Pfändbarkeit von Software 32.48
VII. Internet-Domains 32.49
§ 33 Das Verteilungsverfahren
I. Zweck und Anwendungsbereich 33.1
II. Verfahrensgrundsätze 33.2 – 33.6
1. Verfahren von Amts wegen 33.3
2. Zuständigkeit 33.4
3. Anfertigung des Teilungsplans 33.5
4. Feststellung des Teilungsplans im Verteilungstermin 33.6
III. Rechtsbehelfe gegen den Teilungsplan 33.7 – 33.15
1. Die Widerspruchsklage 33.8 – 33.13
a) Mögliche Widerspruchsgründe 33.9
b) Widerspruch vor oder im Verteilungstermin als Klagevoraussetzung 33.10
c) Bedeutung der Monatsfrist nach § 878 Abs. 1 33.11
d) Zuständigkeit 33.12
e) Urteil 33.13
2. Die sofortige Beschwerde 33.14
3. Abgrenzung zu anderen Rechtsbehelfen 33.15
2. Unterabschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das unbewegliche Vermögen
§ 34 Die allgemeinen Grundzüge der Immobiliarvollstreckung
I. Begriff und systematische Stellung der Immobiliarzwangsvollstreckung 34.1 – 34.11
1. Begriff 34.1, 34.2
2. Systematische Stellung des Immobiliarvollstreckungsrechts 34.3 – 34.11
a) Die gesetzliche Regelung der Immobiliarvollstreckung 34.3, 34.4
b) Die Systematik des ZVG 34.5
c) Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung in besonderen Fällen 34.6 – 34.11
aa) Auseinandersetzungsversteigerung 34.7 – 34.9
bb) Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung auf Antrag des Insolvenzverwalters 34.10
cc) Zwangsversteigerung eines Nachlassgrundstücks auf Antrag eines Erben 34.11
II. Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen 34.12 – 34.18
1. Grundstücke 34.12
2. Grundstücksgleiche Rechte 34.13
3. Miteigentumsanteil an Immobilien 34.14, 34.15
4. Wohnungseigentum und Schiffseigentum 34.16, 34.17
a) Wohnungseigentum 34.16
b) Schiffseigentum 34.17
5. Immobiliarrechte in den neuen Bundesländern 34.18
III. Der Umfang der Immobiliarvollstreckung 34.19 – 34.30
1. Unterschiedlicher Umfang bei Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 34.20 – 34.24
a) Haftungsumfang in der Zwangsversteigerung 34.21 – 34.23
b) Umfang der Zwangsverwaltung 34.24
2. Freiwerden mithaftender Gegenstände 34.25
3. Maßgeblicher Zeitpunkt für Mithaftung bei persönlichen Gläubigern – Rangordnung 34.26, 34.27
a) Maßgeblicher Zeitpunkt für Mithaftung bei persönlichen Gläubigern 34.26
b) Rangordnung 34.27
4. Verhältnis zur vorausgehenden Mobiliarvollstreckung 34.28
5. Unzulässigkeit der Mobiliarvollstreckung nach Beschlagnahme 34.29
6. Rechtsbehelfe 34.30
IV. Vollstreckungsorgan, Verfahren und Beteiligte 34.31 – 34.36
1. Das Vollstreckungsorgan 34.31
2. Antragsverfahren 34.32
3. Die Beteiligten 34.33 – 34.36
a) Parteien 34.34
b) Realberechtigte 34.35
c) Inhaber anderer angemeldeter Rechte 34.36
V. Die Befriedigungsrechte und ihre Rangordnung 34.37 – 34.39
1. Vorzugsrechte und Realgläubiger 34.38
2. Persönliche Gläubiger 34.39
VI. Verfassungsrecht und Zwangsversteigerung 34.40 – 34.44
1. Das faire, rechtsstaatliche Versteigerungsverfahren 34.41
2. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 34.42
3. Gehörsrüge bei Verletzung rechtlichen Gehörs vor Zuschlag 34.43
4. Zwangsversteigerung wegen Bagatellforderungen als Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? 34.44
§ 35 Der Gang des Zwangsversteigerungsverfahrens zur Vorbereitung der Versteigerung
I. Überblick über den Verfahrensverlauf 35.1
II. Der Antrag und seine Voraussetzungen 35.2 – 35.4
III. Die Versteigerungsanordnung und ihre Umsetzung 35.5 – 35.8
1. Der Erlass des Versteigerungsbeschlusses 35.5
2. Die Eintragung des Versteigerungsvermerks 35.6
3. Beitritt und Rechtsnachfolge 35.7, 35.8
IV. Die Beschlagnahme und ihre Wirkungen 35.9 – 35.13
1. Veräußerungsverbot zu Gunsten des betreibenden Gläubigers 35.10 – 35.12
a) Umfang der Beschlagnahme 35.11
b) Relatives Veräußerungsverbot 35.12
2. Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück 35.13
V. Aufhebung und einstweilige Einstellung des Verfahrens 35.14 – 35.22
1. Aufhebungsgründe 35.15 – 35.17
a) Entgegenstehendes dingliches Recht 35.15
b) Antragsrücknahme, fehlender Fortsetzungsantrag und ergebnisloser Termin 35.16
c) Fälle des § 776 und des § 766 35.17
2. Einstweilige Einstellung 35.18 – 35.21
a) Gläubigerantrag 35.18
b) Gerichtliche Anordnung 35.19
c) Einstellung nach §§ 75, 77 ZVG 35.20
d) Schuldnerschutz 35.21
3. Rechtsbehelfe 35.22
§ 36 Der Versteigerungstermin, der Zuschlag und die Verteilung des Erlöses
I. Der Versteigerungstermin 36.1 – 36.17
1. Die Bestimmung des Versteigerungstermins 36.1
2. Die Versteigerungsbedingungen und ihre Grundlagen 36.2 – 36.12
a) Das Übernahmeprinzip 36.3, 36.4
b) Das Deckungsprinzip 36.5 – 36.8
aa) Geringstes Gebot und Bargebot 36.5, 36.6
bb) Mindestgebot 36.7
cc) Ausbietungs- und Ausfallgarantie 36.8
c) Die Versteigerungsbedingungen 36.9 – 36.12
aa) Gesetzliche Versteigerungsbedingungen 36.9, 36.10
bb) Besondere Versteigerungsbedingungen 36.11, 36.12
3. Die drei Abschnitte des Versteigerungstermins 36.13 – 36.17
a) Bekanntmachungen zum Verfahren 36.14
b) Die eigentliche Versteigerung 36.15, 36.16
c) Anhörung über den Zuschlag 36.17
II. Der Zuschlagsbeschluss und seine Rechtswirkungen 36.18 – 36.31
1. Die Versagung des Zuschlags 36.19 – 36.21
2. Der Zuschlag an den Meistbietenden und die Zuschlagsbeschwerde 36.22, 36.23
a) Das Recht auf den Zuschlag 36.22
b) Die Zuschlagsbeschwerde 36.23
3. Die Wirkungen des Zuschlags 36.24 – 36.31
a) Eigentumserwerb des Erstehers 36.24
b) Erlöschen von Rechten und Surrogation am Erlös 36.25, 36.26
c) Bereicherungsausgleich 36.27
d) Bestehenbleiben von Rechten kraft Vereinbarung 36.28, 36.29
e) Räumungs- und Herausgabevollstreckung aus dem Zuschlagsbeschluss 36.30
f) Rechtsstellung des Mieters 36.31
III. Die Verteilung des Erlöses 36.32 – 36.43
1. Die Feststellung der Verteilungsmasse 36.33
2. Der Teilungsplan 36.34 – 36.43
a) Rechtsnatur 36.35
b) Der Inhalt des Teilungsplans 36.36 – 36.39
aa) Die zu berücksichtigenden Rechte 36.37
bb) Die Berücksichtigung von Sicherungsgrundschulden 36.38, 36.39
c) Rechtsbehelfe gegen den Teilungsplan 36.40
d) Die Ausführung des Plans 36.41, 36.42
e) Bereicherungsausgleich nach Planausführung 36.43
§ 37 Die Zwangsverwaltung
I. Zweck 37.1
II. Zulässigkeitsvoraussetzungen 37.2
III. Antrag, Anordnung und Umfang der Beschlagnahme 37.3
IV. Bestellung und Funktion des Zwangsverwalters 37.4 – 37.11
1. Bestellung des Zwangsverwalters 37.4 – 37.6
a) Institutsverwalter 37.5
b) Landwirtschaftliche Grundstücke 37.6
2. Funktion des Zwangsverwalters 37.7 – 37.10
a) Verwaltung und Grundstücksnutzung 37.7
b) Prozessführung 37.8
c) Gewerbebetrieb 37.9
d) Gerichtliche Aufsicht – Haftung 37.10
3. Handeln des Zwangsverwalters kraft Amtes 37.11
V. Verteilung der Nutzungen 37.12 – 37.14
VI. Aufhebung der Zwangsverwaltung 37.15, 37.16
§ 38 Die Zwangshypothek
I. Funktion 38.1
II. Eintragung und Eintragungsvoraussetzungen 38.2 – 38.7
1. Titel und Sicherungsbedürfnis 38.2
2. Zuständigkeit und Verfahren des Grundbuchamtes 38.3
3. Wertgrenze und Verbot der Gesamthypothek, fehlende Vollstreckungsvoraussetzungen 38.4 – 38.6
4. Rechtsbehelfe 38.7
III. Sachenrechtliche Behandlung der Zwangshypothek 38.8, 38.9
IV. Schiffszwangshypothek 38.10
Zweiter Abschnitt Die Zwangsvollstreckung wegen anderer Ansprüche als Geldforderungen
§ 39 Grundgedanken – Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen
I. Überblick 39.1
II. Verhältnis zum Schadensersatzanspruch 39.2
III. Herausgabe von Sachen 39.3 – 39.17
1. Bewegliche Sachen 39.4 – 39.9
a) Bestimmte bewegliche Sachen 39.4 – 39.8
aa) Quantität bestimmter beweglicher Sachen 39.5
bb) Vorlage zur Einsicht 39.6
cc) Vorgeschaltete Handlungspflicht 39.7
dd) Herausgabe eines Kindes 39.8
b) Vertretbare Sachen 39.9
2. Unbewegliche Sachen und Räumungsvollstreckung 39.10 – 39.14
a) Ehewohnung, Wohngemeinschaften, Hausbesetzungen 39.11
b) Untermiete 39.12
c) Vollstreckungsschutz 39.13
d) Vorsorge für bewegliche Sachen 39.14
3. Gewahrsam eines Dritten 39.15, 39.16
a) Pfändung und Überweisung des Herausgabeanspruchs 39.15
b) Vermieterpfandrecht 39.16
4. Herausgabe beim Titel auf Übereignung 39.17
§ 40 Die Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen
I. Handlungsvollstreckung: vertretbare Handlung 40.2 – 40.16
1. Vertretbare Handlung 40.3 – 40.14
a) Werk-, Dienst- und Arbeitsleistungen 40.4
b) Erklärungen und Willenserklärungen 40.5 – 40.8
aa) Abgabe einer bestimmten Willenserklärung, § 894 40.6
bb) Vertretbare Handlung, § 887 40.7
cc) Unvertretbare Handlung, § 888 40.8
c) Herausgabe- und Räumungsvollstreckung, §§ 883 ff. 40.9
d) Anspruch auf Schuldbefreiung 40.10
e) Dauerverpflichtungen 40.11
f) Mitwirkung eines Dritten 40.12
g) Vornahme im Ausland 40.13
h) Einzelfälle 40.14
2. Vornahme auf Kosten des Schuldners 40.15
3. Widerstand des Schuldners 40.16
II. Handlungsvollstreckung: unvertretbare Handlung 40.17 – 40.29
1. Begriff der unvertretbaren Handlung 40.18 – 40.23
a) Beispiele 40.19
b) Mitwirkung eines Dritten 40.20
c) Einsicht in die Geschäftsbücher 40.21
d) Kreditaufnahmepflicht 40.22
e) Vornahme im Ausland 40.23
2. Nicht vollstreckbare Titel über unvertretbare Handlungen 40.24 – 40.26
a) Titel über unvertretbare Dienste 40.25
b) Arbeitsleistung als vertretbare Handlung 40.26
3. Zwangsgeld und Zwangshaft – Anordnungsverfahren 40.27 – 40.29
III. Unterlassungsvollstreckung 40.30 – 40.48
1. Die Unterlassungs- oder Duldungspflicht 40.30 – 40.33
a) Bestimmtheit und Kerntheorie 40.31
b) Handlungspflichten als Folge von Unterlassungsgeboten 40.32
c) Konkurrenz zur Vertragsstrafe 40.33
2. Voraussetzungen für die Festsetzung der Ordnungsmittel 40.34 – 40.36
a) Androhung 40.35
b) Zuwiderhandlung des Schuldners 40.36
3. Festsetzung von Ordnungsgeld und Ordnungshaft 40.37 – 40.39
4. Rechtsnatur der Ordnungsmaßnahmen 40.40 – 40.47
a) Erfordernis eines Verschuldens seitens des Schuldners 40.42
b) Folgen des Titelfortfalls 40.43 – 40.46
aa) Ablauf der im Titel bestimmten Frist 40.44
bb) Wegfall des Titels ex tunc 40.45
cc) Wegfall des Titels ex nunc 40.46
c) Fortsetzungszusammenhang zwischen mehreren Verstößen 40.47
5. Festsetzungsverfahren – Rechtsbehelfe 40.48
§ 41 Die Vollziehung der Urteile auf Abgabe einer Willenserklärung
I. Grundsatz der Fiktion 41.1
II. Voraussetzungen der Fiktion 41.2 – 41.9
1. Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung 41.3 – 41.5
2. Abgrenzung zur Handlungsvollstreckung 41.6 – 41.8
a) Anwendungsbereich von § 894 41.7
b) Anwendungsbereich der §§ 887, 888 41.8
3. Erforderlichkeit eines Urteils 41.9
III. Zeitpunkt des Fiktionseintritts 41.10 – 41.12
1. Eintritt der Fiktion nach formeller Rechtskraft 41.11
2. Sicherungswirkung vor formeller Rechtskraft 41.12
IV. Umfang und Grenzen der Fiktionswirkung 41.13 – 41.17
1. Form der Willenserklärung und andere Wirksamkeitsvoraussetzungen 41.14, 41.15
2. Weitere Voraussetzungen für das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts 41.16
3. Die Möglichkeit gutgläubigen Erwerbs 41.17
Sechstes Kapitel Die Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung
§ 42 Allgemeines
I. Überblick 42.1 – 42.4
1. Rechtsbehelfe bei formellen Mängeln 42.1
2. Rechtsbehelfe bei materiellen Mängeln 42.2 – 42.4
II. Gefahr der Vollstreckungsverschleppung 42.5
III. Materielle Rechtskraft der Entscheidungen 42.6
IV. Reform der Rechtsbehelfe 42.7
§ 43 Die Vollstreckungserinnerung
I. Verfahrensfehler eines Vollstreckungsorgans 43.2 – 43.6
1. Fehler des Gerichtsvollziehers 43.3
2. Fehler des Vollstreckungsgerichts bzw. des Rechtspflegers 43.4
3. Fehler des Prozessgerichts als Vollstreckungsorgan 43.5
4. Fehler des Grundbuchamts 43.6
II. Der Erinnerungsberechtigte und seine Rüge 43.7 – 43.13
1. Erinnerungsberechtigter 43.8
2. Zulässige Rügen 43.9 – 43.13
III. Zuständigkeit und Verfahren 43.14 – 43.22
1. Zuständigkeit 43.14
2. Zulässigkeit – zeitliche Grenzen 43.15
3. Formlosigkeit 43.16
4. Die Entscheidung über die Erinnerung 43.17 – 43.20
5. Sofortige Beschwerde als Rechtsbehelf 43.21
6. Rechtskraft der Entscheidung 43.22
IV. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 43.23 – 43.26
1. Vollstreckungsabwehrklage, Klauselerinnerung 43.23
2. Drittwiderspruchsklage 43.24
3. Dienstaufsichtsbeschwerde 43.25
4. §§ 23 ff. EGGVG 43.26
§ 44 Die sofortige Beschwerde im Vollstreckungsverfahren
I. Vollstreckungsmaßnahmen und Entscheidungen 44.2
II. Entscheidungen im Vollstreckungsverfahren mit fakultativer mündlicher Verhandlung 44.3
III. Beschwerdebefugnis, Beschwerdefrist, Umfang der Prüfung 44.4
IV. Rechtsbeschwerde 44.5
§ 45 Die Vollstreckungsgegenklage
I. Funktion und Rechtsnatur 45.1 – 45.3
1. Funktion 45.2
2. Rechtsnatur 45.3
II. Zulässigkeit 45.4 – 45.8
1. Titel mit vollstreckbarem Inhalt 45.5 – 45.7
a) Leistungsurteile und ähnliche Titel 45.6
b) Weitere Titel 45.7
2. Drohende Vollstreckung – fortdauernde Vollstreckung 45.8
III. Begründete Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch 45.9 – 45.26
1. Endurteile 45.10 – 45.17
a) Maßgebliche letzte Tatsachenverhandlung 45.11 – 45.13
b) Einwendungsarten und maßgeblicher Entstehungszeitpunkt 45.14 – 45.16
c) Besonderheiten bei Versäumnisurteilen 45.17
2. Andere gerichtliche Entscheidungen 45.18 – 45.23
a) Schiedssprüche 45.19
b) Ausländische Urteile 45.20
c) Vollstreckungsbescheide 45.21
d) Kostenfestsetzungsbeschlüsse 45.22
e) Adhäsionsverfahren 45.23
3. Vollstreckungstitel ohne vorausgehendes Erkenntnisverfahren 45.24 – 45.26
a) Gerichtliche und notarielle Urkunden 45.25
b) Gerichtliche Vergleiche 45.26
IV. Besonderheiten des Verfahrens 45.27 – 45.35
1. Zuständigkeit 45.28, 45.29
2. Parteien 45.30
3. Klagantrag 45.31
4. Konzentrationsgrundsatz und Eventualmaxime 45.32
5. Umfang der Prüfung – Kosten 45.33
6. Einstweilige Anordnungen bezüglich der Vollstreckung 45.34, 45.35
V. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 45.36 – 45.42
1. Erinnerung 45.36
2. Feststellungsklage und prozessuale Gestaltungsklage analog § 767 45.37
3. Parallelstreitigkeiten mit identischen Vorfragen 45.38
4. Schadensersatz und Bereicherungsausgleich 45.39
5. Klage auf Herausgabe des Schuldtitels 45.40
6. Abänderungsklage 45.41
7. Berufung und Einspruch 45.42
§ 46 Die Drittwiderspruchsklage und die Klage auf vorzugsweise Befriedigung
I. Die Drittwiderspruchsklage 46.1 – 46.30
1. Funktion, Rechtsnatur, Anwendungsbereich 46.1 – 46.3
2. Das die Veräußerung hindernde Recht 46.4 – 46.15
a) Eigentum und Rechtsinhaberschaft 46.5 – 46.9
aa) Eigentumsvorbehalt 46.6
bb) Treuhandverhältnisse 46.7, 46.8
cc) Oder-Konto 46.9
b) Andere dingliche Rechte 46.10
c) Besitz 46.11
d) Obligatorische Rechte 46.12
e) Anfechtungsrecht 46.13
f) Veräußerungsverbot 46.14
g) Sondervermögen 46.15
3. Parteien der Klage – Einwendungen 46.16 – 46.20
a) Aktivlegitimation 46.16
b) Passivlegitimation 46.17
c) Einwendungen des Vollstreckungsgläubigers 46.18 – 46.20
4. Verfahren 46.21 – 46.26
a) Zuständigkeit 46.22
b) Antrag und Tenor 46.23
c) Vorläufige Anordnung bezüglich der Vollstreckung 46.24
d) Vorläufige Vollstreckbarkeit, Kostenentscheidung 46.25
e) Schadensersatz aus verspäteter „Freigabe“ 46.26
5. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen 46.27 – 46.30
a) Schadensersatz- und Bereicherungsklage 46.27
b) Erinnerung 46.28
c) Unterlassungs- und Feststellungsklage 46.29
d) Aussonderung 46.30
II. Die Klage auf vorzugsweise Befriedigung 46.31 – 46.37
1. Normzweck und Anwendungsbereich 46.31
2. Rechtsnatur 46.32
3. Rechtsschutzbedürfnis 46.33
4. Klageantrag 46.34
5. Parteien 46.35
6. Gesetzliche Pfandrechte 46.36
7. Verfahren; einstweilige Anordnung 46.37
§ 47 Die Erinnerung auf Grund der schuldnerschützenden Generalklausel
I. Die speziellen Schuldnerschutzvorschriften und die Grundsätze der Zwangsvollstreckung 47.1
II. Die Generalklausel und ihr Anwendungsbereich 47.2, 47.3
1. Grundsätzlicher Inhalt 47.2
2. Anwendungsbereich und Kasuistik 47.3
III. Dogmatische Einordnung der Generalklausel 47.4 – 47.8
1. Grundsätzliche Berechtigung und rechtskraftbedingte Schranken 47.4
2. Die Funktionen der Generalklausel 47.5 – 47.8
a) Ergänzungsfunktion 47.6
b) Ermächtigungsfunktion 47.7
c) Schrankenfunktion 47.8
IV. Verfahren 47.9, 47.10
1. Entscheidung durch das Vollstreckungsgericht 47.9
2. Aufschub durch den Gerichtsvollzieher 47.10
Siebtes Kapitel Die Sachaufklärung der Zwangsvollstreckung
§ 48 Eidesstattliche Versicherung, Haft und Schuldnerbefragung
I. Zweck und Mittel der vollstreckungsrechtlichen Sachaufklärung 48.1 – 48.4
1. Die eidesstattliche Versicherung 48.2
2. Unförmliche Befragung des Schuldners 48.3
3. Stand und Reform vollstreckungsrechtlicher Sachverhaltsaufklärung 48.4
II. Die Voraussetzungen der Vermögensauskunft mit eidesstattlicher Versicherung 48.5 – 48.8
1. Vollstreckungsauftrag, allgemeine und besondere Vollstreckungsvoraussetzungen 48.5
2. Zweijährige Sperrfrist für erneute Vermögensauskunft 48.6
3. Rechtsschutzbedürfnis 48.7
4. Gesetzliche Vertretung 48.8
III. Das Verfahren bis zur Abgabe von Vermögensauskunft und eidesstattlicher Versicherung 48.9 – 48.14
1. Zuständigkeit 48.9
2. Gläubigerantrag 48.10
3. Prüfungspflichten des Gerichtsvollziehers 48.11
4. Terminbestimmung und Ladung 48.12
5. Inhalt der Vermögensauskunft 48.13, 48.14
a) Vollständigkeit 48.13
b) Richtigkeit 48.14
IV. Der Termin zur Abnahme von Vermögensauskunft und eidesstattlicher Versicherung 48.15 – 48.19
1. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und ihre Wirkung 48.16
2. Haftbefehl bei Weigerung 48.17 – 48.19
a) Erlass des Haftbefehls 48.17
b) Haftbefehl und Verhältnismäßigkeit 48.18
c) Sofortige Beschwerde gegen Erlass oder Ablehnung des Haftbefehls 48.19
V. Vollzug des Haftbefehls 48.20 – 48.23
1. Die Verhaftung des Schuldners 48.20
2. Haftunfähigkeit 48.21
3. Haftdauer 48.22
4. Wirkung voller Haftverbüßung 48.23
VI. Die zentrale Verwaltung der Vermögensverzeichnisse 48.24 – 48.27
1. Umfang der zentralen Verwaltung 48.25
2. Löschungsvoraussetzungen 48.26
3. Datenschutz 48.27
Achtes Kapitel Kosten der Zwangsvollstreckung
§ 49 Die Kosten der Zwangsvollstreckung
I. Die Kostenhaftung der Parteien gegenüber den Vollstreckungsorganen 49.1
II. Die Kostenhaftung der Parteien gegenüber ihren Verfahrensbevollmächtigten 49.2
III. Der Kostenausgleich zwischen Vollstreckungsgläubiger und Vollstreckungsschuldner nach § 788 49.3 – 49.16
1. Anwendungsbereich des § 788 49.3
2. Der Erstattungsanspruch des Vollstreckungsgläubigers gegen den Vollstreckungsschuldner 49.4 – 49.10
a) Der Gegenstand des Erstattungsanspruchs 49.5, 49.6
aa) Kosten der Zwangsvollstreckung 49.5
bb) Nicht erstattungspflichtige Aufwendungen 49.6
b) Der Umfang des Erstattungsanspruchs 49.7
c) Die Durchsetzung des Erstattungsanspruchs 49.8 – 49.10
aa) Beitreibung mit der Hauptforderung 49.9
bb) Kostenfestsetzung gemäß § 788 Abs. 2 49.10
3. Der Erstattungsanspruch des Vollstreckungsschuldners gegen den Vollstreckungsgläubiger 49.11 – 49.13
a) Entstehungsvoraussetzungen 49.11
b) Inhalt des Erstattungsanspruchs 49.12
c) Durchsetzung des Anspruchs 49.13
4. Die Billigkeitsentscheidung bei Vollstreckungsschutz und Austauschpfändung 49.14 – 49.16
a) Anspruchsvoraussetzungen 49.15
b) Anspruchsdurchsetzung 49.16
Neuntes Kapitel Arrest und einstweilige Verfügung
§ 50 Allgemeines
I. Zweck und Funktion 50.1
II. Schutz vor Gefahren des einstweiligen Verfahrens 50.2
III. Aufbau der gesetzlichen Regelung 50.3
IV. Praktische Bedeutung 50.4, 50.5
1. Geschichte 50.4
2. Die neuere Entwicklung und der europäische Rahmen 50.5
Erster Abschnitt Der Arrest
§ 51 Die Voraussetzungen des Arrests und der Arrestprozess
I. Zweck und Form des Arrests 51.1
II. Voraussetzungen des Arrests 51.2 – 51.11
1. Arrestanspruch 51.3
2. Arrestgrund 51.4 – 51.9
a) Dinglicher Arrest 51.5 – 51.8
aa) § 917 Abs. 1 51.5
bb) § 917 Abs. 2 51.6 – 51.8
(1) Verbürgung der Gegenseitigkeit bei Vollstreckung von Inlandstiteln 51.7
(2) Vollstreckung von Auslandstiteln 51.8
b) Persönlicher Arrest 51.9
3. Dingliche Sicherheit und vollstreckbarer Titel als Ausschlussgründe 51.10
4. Unerheblichkeit der Vollzugsaussichten 51.11
III. Der Arrestprozess 51.12 – 51.22
1. Zuständigkeit (Arrestgericht) 51.13 – 51.17
a) Gericht der Hauptsache 51.14, 51.15
b) Amtsgericht 51.16
c) Ausschließlichkeit und Sonderfälle 51.17
2. Das Arrestgesuch 51.18 – 51.22
a) Inhalt, Rücknahme 51.18
b) Glaubhaftmachung und Beweislastverteilung 51.19
c) Form 51.20
d) Streitgegenstand und Rechtshängigkeit 51.21
e) Antrag auf Vollziehungsmaßnahmen 51.22
IV. Arrestbefehl ohne und mit mündlicher Verhandlung 51.23 – 51.30
1. Verfahren ohne mündliche Verhandlung 51.24 – 51.26
a) Arrestbefehl 51.25
b) Zurückweisender Beschluss 51.26
2. Verfahren mit mündlicher Verhandlung 51.27
3. Inhalt des Arrestbefehls 51.28 – 51.30
a) Obligatorischer Inhalt 51.28
b) Fakultativer Inhalt 51.29, 51.30
V. Rechtsbehelfe 51.31 – 51.40
1. Widerspruch gegen den Arrestbefehl 51.32 – 51.37
a) Rechtsnatur 51.33
b) Zuständigkeit 51.34
c) Mündliche Verhandlung 51.35
d) Das Urteil 51.36
e) Rechtsbehelfe gegen das Urteil 51.37
2. Sofortige Beschwerde gegen zurückweisenden Beschluss 51.38
3. Berufung 51.39
4. Verhältnis der Rechtsbehelfe zur Arrestaufhebung 51.40
VI. Rechtskraftwirkung der Entscheidungen 51.41 – 51.44
1. Abweisung des Antrags 51.42
2. Erlass des Arrests 51.43
3. Wirkung auf den Hauptprozess 51.44
VII. Aufhebung des Arrestbefehls 51.45 – 51.52
1. Aufhebung nach Ablauf der Klagefrist 51.46
2. Aufhebung wegen veränderter Umstände 51.47 – 51.52
a) Zuständigkeit und Wirkung des Antrags 51.48
b) Veränderte Umstände 51.49
c) Die Entscheidung 51.50
d) Einverständliche Aufhebung 51.51
e) Übergang zum Hauptprozess? 51.52
§ 52 Die Vollziehung des Arrests
I. Entsprechende Geltung der gewöhnlichen Vollstreckungsvorschriften 52.1 – 52.4
1. Das erfasste Vermögen 52.2
2. Rechtsbehelfe und Vollziehungskosten 52.3
3. Insolvenzverfahren 52.4
II. Besondere Voraussetzungen des Arrestvollzugs 52.5 – 52.11
1. Sofortige Vollstreckbarkeit des Arrestbefehls 52.6
2. Vollziehungsfrist 52.7 – 52.10
a) Beginn der Vollziehungsfrist 52.8
b) Anforderungen an den Vollzug 52.9
c) Folgen der Fristversäumnis 52.10
3. Zustellung bei vorweggenommenem Vollzug 52.11
III. Vollziehung des dinglichen Arrests 52.12 – 52.25
1. In bewegliches Vermögen 52.13 – 52.22
a) Sicherung ohne Verwertung: das Arrestpfandrecht 52.14
b) Verwandlung des Arrestpfandrechts in ein Vollstreckungspfandrecht 52.15 – 52.20
c) Verbindung von Arrestbefehl und Pfändungsbeschluss 52.21
d) Vollzug des Arrests in Schiffe 52.22
2. In Grundstücke 52.23 – 52.25
a) Verfahren 52.24
b) Besonderheiten der Arresthypothek 52.25
IV. Persönlicher Arrest 52.26
V. Aufhebung des Arrestvollzugs 52.27 – 52.30
1. Aufhebungsgründe 52.28
2. Zuständigkeit und Entscheidung 52.29
3. Rechtsbehelfe 52.30
VI. Schadensersatz nach Vollzug des Arrests 52.31 – 52.40
1. Voraussetzungen des Ersatzanspruches 52.32 – 52.37
a) Anfänglich ungerechtfertigter Arrest 52.33 – 52.36
b) Ablauf der Klagefrist 52.37
2. Der ersatzfähige Schaden 52.38
3. Geltendmachung 52.39
4. Analoge Anwendung 52.40
Zweiter Abschnitt Die einstweilige Verfügung
§ 53 Arten und Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung
I. Arten der einstweiligen Verfügung 53.1 – 53.5
1. Sicherung, Regelung und Befriedigung 53.1, 53.2
2. Ergänzende Bestimmungen und Sonderregelungen der ZPO 53.3
3. Selbstständige Regelungen in anderen Verfahrensgesetzen 53.4
4. Besonderheiten bei schiedsgerichtlicher Zuständigkeit 53.5
II. Die sichernde einstweilige Verfügung nach § 935 (Sicherungsverfügung) 53.6 – 53.14
1. Der Verfügungsanspruch 53.6 – 53.8
a) Prüfung des Verfügungsanspruchs 53.7
b) Vorlagepflichten 53.8
2. Der Verfügungsgrund 53.9
3. Sicherheitsleistung 53.10
4. Der Inhalt der Sicherungsverfügung 53.11 – 53.14
a) Ermessensgrenzen 53.12
b) Minus und Aliud zur Befriedigung 53.13
c) Vollstreckungsfähiger Inhalt 53.14
III. Die regelnde einstweilige Verfügung nach § 940 (Regelungsverfügung) 53.15 – 53.23
1. Das streitige Rechtsverhältnis 53.15 – 53.18
a) Begriff und Anwendungsbereich 53.16, 53.17
b) Schlüssigkeitsprüfung des Verfügungsanspruchs 53.18
2. Der Verfügungsgrund 53.19
3. Der Inhalt der Regelungsverfügung 53.20 – 53.23
a) Regeln der Ermessensausübung 53.20, 53.21
b) Kasuistik 53.22
c) Vollstreckungsfähiger Inhalt? 53.23
IV. Die auf Befriedigung gerichtete einstweilige Verfügung (Leistungsverfügung) 53.24 – 53.30
1. Wesen und Rechtsgrundlage der Leistungsverfügung 53.24
2. Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs 53.25
3. Glaubhaftmachung des Verfügungsgrundes 53.26
4. Inhalt der Leistungsverfügung 53.27 – 53.30
a) Grundsatz 53.27
b) Kasuistik 53.28, 53.29
c) Vollstreckungsfähiger Inhalt 53.30
§ 54 Verfahren und Vollzug der einstweiligen Verfügung
I. Allgemeine Grundsätze 54.1
II. Das „Normalverfahren“ 54.2 – 54.8
1. Das Gesuch 54.2
2. Zuständigkeit des Hauptsachegerichts 54.3
3. Das Verfahren der einstweiligen Verfügung 54.4 – 54.6
a) Mündliche Verhandlung und Gehör 54.4
b) Die Schutzschrift 54.5
c) Die Entscheidung 54.6
4. Rechtsbehelfe 54.7
5. Besonderheiten der Unterlassungsverfügung in Wettbewerbssachen 54.8
III. Besonderheit: Amtsgerichtliche Zuständigkeit 54.9 – 54.15
1. Eilzuständigkeit des Amtsgerichts 54.9
2. Verhandlung und Beschluss 54.10
3. Rechtsbehelfe 54.11 – 54.15
IV. Der Vollzug 54.16 – 54.22
1. Vollzug der Sicherungs- und Regelungsverfügung 54.17 – 54.20
a) Vollziehungsfristen 54.18
b) Gerichtliches Eintragungsersuchen 54.19
c) § 927 statt § 767 54.20
2. Vollzug der Leistungsverfügung 54.21, 54.22
V. Schadensersatzpflicht 54.23 – 54.25
Zehntes Kapitel Internationales und ausländisches Vollstreckungsrecht
Vorbemerkungen
§ 55 Die Europäische Zwangsvollstreckung
I. Internationales und Europäisches Zwangsvollstreckungsrecht 55.1
II. Der Geltungsbereich der Vollstreckbarkeit unter der EuGVVO 55.2 – 55.8
1. Der territoriale Geltungsbereich 55.2
2. Der sachliche Anwendungsbereich für Zivil- und Handelssachen 55.3, 55.4
3. Die grundsätzlich geeigneten Titel 55.5 – 55.8
III. Automatische Vollstreckbarkeit und Verfahren der Vollstreckungsversagung 55.9 – 55.29
1. Rechtsquellen 55.9
2. Grundzüge des Verfahrens 55.10 – 55.22
a) Die Abschaffung des Exequaturverfahrens 55.10 – 55.12
b) Voraussetzungen und Umfang der Vollstreckung im Inland 55.13, 55.14
c) Das Verfahren zur Versagung der Vollstreckung 55.15, 55.16
d) Rechtsmittel 55.17, 55.18
e) Aussetzung des Verfahrens 55.19
f) Einstweiliger Rechtsschutz gegen Vollstreckungsmaßnahmen 55.20, 55.21
g) Würdigung des Verfahrens 55.22
3. Die Anpassung des Entscheidungsinhalts ausländischer Titel 55.23
4. Die Implementierung offener oder unvollständiger ausländischer Titel 55.24 – 55.29
a) Grundsatz 55.24
b) Typische Erscheinungsformen offener oder unvollständiger Titel 55.25
c) Das Verfahren der Implementierung 55.26, 55.27
d) Umrechnungsfragen 55.28
e) Rechtsbehelfe 55.29
IV. Internationale Forderungspfändung in Europa 55.30 – 55.43
1. Autonomes Recht und Europarecht 55.30
2. Deutsches autonomes Recht 55.31
3. Geschlossenes System internationaler Forderungspfändung in der EU 55.32 – 55.34
4. Europäischer Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung 55.35 – 55.43
a) Anwendungsbereich 55.36
b) Verfahren zum Erlass und Vollzug eines Pfändungsbeschlusses 55.37, 55.38
c) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Beschlüsse 55.39
d) Rechtsbehelf des Schuldners und des Gläubigers 55.40, 55.41
e) Schadensersatz 55.42
f) Würdigung 55.43
V. Europäische Vollstreckung von Handlungen, Unterlassungen und Willenserklärungen 55.44 – 55.64
1. Herausgabevollstreckung 55.44 – 55.47
2. Handlungsvollstreckung 55.48 – 55.54
a) Vertretbare Handlung 55.48 – 55.51
b) Nicht vertretbare Handlung 55.52 – 55.54
3. Unterlassungsvollstreckung 55.55 – 55.60
4. Die Abgabe von Willenserklärungen 55.61 – 55.64
VI. Inhaltliche Prüfungskompetenz im Verfahren der Vollstreckungsversagung 55.65 – 55.83
1. Grundsatz 55.65
2. Ordre public (Art. 45 Abs. 1 lit. a EuGVVO) 55.66, 55.67
3. Fehlerhafte Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstückes bei Versäumnisentscheidungen (Art. 45 Abs. 1 lit. b EuGVVO) 55.68 – 55.77
a) Verhältnis von Rechtzeitigkeit und Art und Weise 55.68
b) Rechtzeitigkeit 55.69
c) Art und Weise 55.70 – 55.72
d) Das verfahrenseinleitende Schriftstück 55.73
e) Heilung 55.74 – 55.76
f) Reform 55.77
4. Unvereinbarkeit mit Inlandsentscheidung (Art. 45 Abs. 1 lit. c EuGVVO) 55.78 – 55.80
5. Unvereinbarkeit mit anerkennungsfähiger Auslandsentscheidung (Art. 45 Abs. 1 lit. d EuGVVO) 55.81, 55.82
6. Missachtung ausschließlicher europäischer Gerichtsstände (Art. 45 Abs. 1 lit. e EuGVVO) 55.83
VII. Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen 55.84 – 55.101
1. Bedeutung 55.84
2. Geltungsbereich 55.85
3. Grundzüge des Bestätigungsverfahrens 55.86 – 55.93
a) Die Zuständigkeit zur Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel 55.86
b) Die Bestätigungsvoraussetzungen 55.87 – 55.90
c) Ausstellung der Bestätigung und Rechtsbehelfe im Ursprungsstaat 55.91, 55.92
d) Vorlage zum EuGH 55.93
4. Vollstreckbarkeit des Europäischen Vollstreckungstitels und Rechtsbehelfe im Vollstreckungsstaat 55.94 – 55.99
a) Gleichstellung von im Ursprungsstaat vollstreckbaren Titeln und Inlandstiteln 55.94, 55.95
b) Vollstreckungsverweigerung 55.96, 55.97
c) Aussetzung und Beschränkung der Vollstreckung 55.98
d) Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung 55.99
5. Würdigung 55.100, 55.101
VIII. Der Europäische Zahlungsbefehl 55.102 – 55.116
1. Bedeutung 55.102
2. Geltungsbereich 55.103
3. Grundzüge des Mahnverfahrens 55.104 – 55.110
a) Die Zuständigkeit für das Mahnverfahren 55.104
b) Antrag des Gläubigers 55.105
c) Prüfung des Antrags durch das Gericht 55.106
d) Erlass und Zustellung des Zahlungsbefehls 55.107
e) Einspruchsmöglichkeit des Antragsgegners und Vollstreckbarkeitserklärung durch das Gericht 55.108
f) Rechtsbehelfe im Ursprungsstaat 55.109, 55.110
4. Vollstreckbarkeit des Europäischen Zahlungsbefehls und Rechtsbehelfe im Vollstreckungsstaat 55.111 – 55.115
a) Gleichstellung von im Ursprungsstaat vollstreckbaren Titeln und Inlandstiteln 55.111
b) Vollstreckungsverweigerung 55.112, 55.113
c) Aussetzung und Beschränkung der Vollstreckung 55.114
d) Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung 55.115
5. Würdigung 55.116
IX. Das Europäische Verfahren für geringfügige Forderungen 55.117 – 55.132
1. Bedeutung 55.117
2. Geltungsbereich 55.118
3. Grundzüge des Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 55.119 – 55.126
a) Zuständigkeit 55.119
b) Verfahrenseinleitung 55.120
c) Durchführung des Verfahrens 55.121 – 55.123
d) Erlass und Zustellung des Urteils 55.124
e) Überprüfung des Urteils 55.125
f) Rechtsmittel im Ursprungsstaat 55.126
4. Vollstreckbarkeit des Urteils und Rechtsbehelfe im Vollstreckungsstaat 55.127 – 55.131
a) Gleichstellung von im Ursprungsstaat vollstreckbaren Titeln und Inlandstiteln 55.127
b) Vollstreckbarkeit 55.128
c) Vollstreckungsverweigerung 55.129
d) Aussetzung und Beschränkung der Vollstreckung 55.130
e) Rechtsbehelfe der Zwangsvollstreckung 55.131
5. Würdigung 55.132
X. Europäische Vollstreckung unter dem Luganer Übereinkommen 55.133, 55.134
1. Zweck und Geltungsbereich 55.133
2. Inhalt 55.134
XI. Konkurrenzen 55.135 – 55.143
1. EuGVVO und EuVTVO 55.135
2. EuGVVO, EuMVVO und EuGFVO 55.136
3. EuVTVO und EuMVVO 55.137
4. EuGVVO und nationales Recht 55.138
5. Bilaterale Verträge zwischen EU-Staaten 55.139 – 55.141
6. Bilaterale Verträge und Luganer Übereinkommen 55.142
7. Multilaterale Übereinkommen 55.143
XII. Die Europäische Eheverordnung 55.144 – 55.146
1. Vorgeschichte und Anwendungsbereich 55.144
2. Grundstruktur 55.145
3. Konkurrenz zu internationalen Übereinkommen 55.146
XIII. Europäische Unterhaltsverordnung 55.147 – 55.149
1. Vorgeschichte und Anwendungsbereich 55.147
2. Grundstruktur 55.148
3. Konkurrenz zu internationalen Übereinkommen 55.149
XIV. Europäische Erbrechtsverordnung 55.150 – 55.152
1. Vorgeschichte und Anwendungsbereich 55.150
2. Grundstruktur 55.151
3. Konkurrenz zu internationalen Übereinkommen 55.152
XV. Gläubigeranfechtung und Immunität in Europa 55.153
§ 56 Multilaterale und bilaterale Übereinkommen
I. Multilaterale Übereinkommen 56.2 – 56.11
1. Haager Unterhaltsübereinkommen 2007 56.2, 56.3
2. UN-Unterhaltsübereinkommen und Auslandsunterhaltsgesetz 56.4, 56.5
3. Haager Kinderschutzübereinkommen 1996 56.6
4. Haager Übereinkommen über zivilrechtliche Aspekte internationaler Kindesentführung 1980 56.7 – 56.9
5. Haager Zivilprozessübereinkommen 1954 56.10
6. Haager Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen? 56.11
II. Bilaterale Abkommen 56.12 – 56.18
1. Vollstreckungsabkommen mit „alten“ EU-Staaten 56.12
2. Vollstreckungsabkommen mit anderen europäischen Staaten 56.13 – 56.17
a) Großbritannien, Griechenland, Spanien und Österreich 56.13, 56.14
b) Norwegen 56.15
c) Schweiz 56.16, 56.17
3. Weitere Staaten 56.18
III. Vollstreckungsübereinkommen und autonome Vollstreckbarerklärung 56.19
IV. Stand des Vertragsrechts und seiner Ausführungsgesetze 56.20, 56.21
1. Die Einheitlichkeit und Systematik des Vertragsrechts 56.20
2. Deutsche Ausführungsgesetzgebung 56.21
§ 57 Das autonome deutsche internationale Vollstreckungsrecht
I. Die Klage auf Vollstreckbarerklärung 57.1 – 57.5
1. Grundzüge 57.1
2. Die Voraussetzungen einer Vollstreckbarerklärung 57.2
3. Das Verhältnis der Klage auf Vollstreckbarerklärung zur Vollstreckungsgegenklage und Leistungsklage 57.3
4. Die Vollstreckbarerklärung von U.S.-amerikanischen Urteilen im besonderen 57.4
5. Implementierung offener oder unvollständiger Titel 57.5
II. Das Vollstreckungsverfahren mit Auslandswirkung 57.6 – 57.19
1. Grundsatz 57.6, 57.7
2. Grenzüberschreitende Vollstreckung und ihre Schranken 57.8 – 57.19
a) Internationale Forderungspfändung 57.9 – 57.11
b) Internationale Herausgabevollstreckung 57.12, 57.13
c) Internationale Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung 57.14 – 57.18
d) Willenserklärungen 57.19
III. Internationales Anfechtungsrecht 57.20 – 57.24
1. Grundsätzliche Möglichkeiten 57.20
2. Die gegenwärtige Rechtslage 57.21 – 57.24
IV. Völkerrechtliche Vollstreckungsgrenzen im Inland 57.25 – 57.27
1. Grundsätze 57.25
2. Vertragsrecht 57.26, 57.27
§ 58 Die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
I. Vorbemerkung 58.1
II. Das UN-Vollstreckungsübereinkommen 58.2, 58.3
III. Europäisches Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit 58.4
IV. Weltbankübereinkommen 58.5
V. Bilaterale Abkommen 58.6, 58.7
VI. Autonomes Verfahrensrecht 58.8, 58.9
§ 59 Ausländisches Einzelvollstreckungsrecht
I. Frankreich 59.1 – 59.33
1. Geschichtliche Rahmenbedingungen 59.1 – 59.4
2. Vollstreckungstitel 59.5
3. Vollstreckungsarten der Geldforderungsvollstreckung 59.6 – 59.20
a) Forderungspfändung („saisie-attribution“) 59.6 – 59.8
b) Sachpfändung („saisie-vente“) 59.9 – 59.12
c) Sonderformen der Pfändung 59.13
d) Immobiliarvollstreckung 59.14 – 59.17
e) Verhältnis der Vollstreckungsarten 59.18
f) Sachverhaltsaufklärung 59.19
g) Verbraucherrestschuldbefreiung 59.20
4. Naturalvollstreckung 59.21 – 59.27
a) Herausgabevollstreckung und Räumung 59.21, 59.22
b) Vertretbare Handlungen und Beseitigung 59.23
c) Astreinte 59.24 – 59.26
d) Willenserklärungen 59.27
5. Sicherungsmaßnahmen („mesures conservatoires“) 59.28, 59.29
6. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 59.30 – 59.32
a) Europäische Urteilsvollstreckung 59.30
b) Weitere Verträge 59.31
c) Autonomes Recht 59.32
7. Entwicklungsstand 59.33
II. England 59.34 – 59.56
1. Rahmenbedingungen 59.34, 59.35
2. Vollstreckungstitel 59.36
3. Die Vollstreckungsarten der Geldforderungsvollstreckung 59.37 – 59.49
a) Vollstreckung in bewegliche Sachen („execution on goods“) 59.37, 59.38
b) Vollstreckung in Forderungen („third party debt orders“ bzw. „garnishee proceedings“) 59.39
c) Vollstreckung in Lohn- und Gehaltsforderungen („attachment of earnings“) 59.40, 59.41
d) Immobiliarvollstreckung („charging order on land“) 59.42, 59.43
e) Pfändung von anderen Vermögensrechten 59.44
f) Zwangsverwaltung 59.45
g) Zwangshaft („imprisonment for debt“) 59.46
h) Sachverhaltsaufklärung 59.47, 59.48
i) Schuldnerschutz 59.49
4. Naturalvollstreckung 59.50 – 59.52
a) Herausgabevollstreckung 59.50
b) Handlungen und Unterlassungen 59.51, 59.52
5. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 59.53 – 59.55
a) Europäische Entscheidungen 59.53
b) Deutsch-britisches Vollstreckungsübereinkommen 59.54
c) Autonomes Recht 59.55
6. Entwicklungsstand 59.56
III. Italien 59.57 – 59.69
1. Rahmenbedingungen 59.57
2. Vollstreckungstitel 59.58
3. Vollstreckungsarten der Geldforderungsvollstreckung 59.59 – 59.65
a) Allgemeine Regeln 59.59, 59.60
b) Sachpfändung („esproprazione mobiliare presso il debitore“) 59.61
c) Forderungspfändung („espropriazione presso terzi“) 59.62
d) Immobiliarvollstreckung („espropriazione immobiliare“) 59.63, 59.64
e) Rechtsbehelfe 59.65
4. Naturalvollstreckung 59.66
5. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 59.67 – 59.69
a) Europäische Vollstreckung 59.67
b) Weitere wichtige Vollstreckungsverträge 59.68
c) Autonomes Recht 59.69
IV. Spanien 59.70 – 59.102
1. Rahmenbedingungen 59.70 – 59.73
a) Gesamtvollstreckung und Einzelvollstreckung 59.71
b) Organe der Zwangsvollstreckung 59.72, 59.73
2. Vollstreckungsvoraussetzungen und Vollstreckungstitel 59.74 – 59.79
a) Antrag beim Vollstreckungsgericht 59.74
b) Vollstreckungstitel 59.75 – 59.77
c) Vollstreckungsklausel und Zustellung 59.78, 59.79
3. Grenzen der Real- und Personalexekution 59.80 – 59.82
a) Vermögensvollstreckung 59.80, 59.81
b) Personalexekution 59.82
4. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 59.83 – 59.93
a) Allgemeine Regeln 59.83 – 59.85
b) Durchführung der Pfändung 59.86 – 59.88
c) Wirkungen der Pfändung 59.89
d) Verwertung 59.90 – 59.93
5. Naturalvollstreckung 59.94 – 59.97
a) Handlungen und Unterlassungen 59.94, 59.95
b) Herausgabe von Sachen 59.96
c) Abgabe einer Willenserklärung 59.97
6. Rechtsbehelfe 59.98 – 59.100
a) Rechtsbehelfe der Parteien 59.98
b) Rechtsbehelfe Dritter („tercerías“) 59.99, 59.100
7. Einstweiliger Rechtsschutz 59.101
8. Vollstreckung ausländischer Titel 59.102
V. Vereinigte Staaten 59.103 – 59.125
1. Rahmenbedingungen 59.103 – 59.108
a) State Law 59.103
b) Ursprünge des Common Law 59.104
c) Vollstreckungsorgane 59.105
d) Verfahrensgrundsätze 59.106
e) Verhältnis zum Insolvenzrecht 59.107
f) Außergerichtliche Forderungsbeitreibung 59.108
2. Vollstreckungstitel 59.109 – 59.112
3. Die Vollstreckungsarten der Geldforderungsvollstreckung 59.113 – 59.120
a) Pfandverwertung 59.113, 59.114
b) Garnishment 59.115
c) Schuldnerschutz 59.116 – 59.118
d) „Supplementary proceedings“ 59.119
e) Gläubigeranfechtung 59.120
4. Naturalvollstreckung 59.121, 59.122
a) Herausgabevollstreckung 59.121
b) Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung 59.122
5. Vorläufiger Rechtsschutz („prejudgment remedies“) 59.123
6. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 59.124, 59.125
VI. Schweiz 59.126 – 59.141
1. Rahmenbedingungen 59.126 – 59.129
a) Bundesrecht und Kantonsrecht 59.126
b) Schuldbetreibung auf Konkurs und Schuldbetreibung auf Pfändung 59.127
c) Zentrale Vollstreckungsorganisation 59.128, 59.129
2. Das Einleitungsverfahren der Geldvollstreckung 59.130
3. Das Pfändungsverfahren 59.131 – 59.136
a) Vorbereitung 59.131
b) Pfändung und Sicherung der Pfändung 59.132, 59.133
c) Mehrfache Pfändung 59.134
d) Schuldnerschutz 59.135
e) Verwertung 59.136
4. Naturalvollstreckung 59.137, 59.138
5. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile 59.139 – 59.141
a) Autonomes Recht und Staatsverträge 59.139, 59.140
b) Das Lugano-Übereinkommen 59.141
VII. Österreich 59.142 – 59.153
1. Rahmenbedingungen 59.142 – 59.146
a) Exekutionsordnung und Nebengesetze 59.142
b) Vollstreckungsorganisation und Vollstreckungsorgane 59.143, 59.144
c) Grundsätze des Verfahrens 59.145, 59.146
2. Exekutionstitel 59.147
3. Geldforderungsvollstreckung 59.148 – 59.150
a) Forderungspfändung 59.148
b) Fahrnispfändung 59.149
c) Immobiliarvollstreckung 59.150
4. Naturalvollstreckung 59.151
5. Rechtsbehelfe 59.152
6. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile 59.153
VIII. Griechenland 59.154 – 59.180
1. Das prozessuale Grundrecht auf Zwangsvollstreckung 59.154
2. Rechtsquellen des Zwangsvollstreckungsrechts 59.155, 59.156
3. Organe der Zwangsvollstreckung 59.157, 59.158
4. Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung 59.159
5. Vollstreckungstitel 59.160 – 59.163
a) Rechtskräftige Entscheidungen (Leistungstitel) 59.161
b) Vorläufig vollstreckbare Entscheidungen 59.162
c) Weitere Vollstreckungstitel 59.163
6. Vollstreckungsklausel 59.164
7. Gegenstand der Zwangsvollstreckung 59.165
8. Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 59.166 – 59.170
a) Zwangspfändung 59.166 – 59.168
b) Zwangsverwaltung 59.169
c) Persönliche Haft 59.170
9. Die unmittelbaren Vollstreckungsarten 59.171 – 59.175
a) Herausgabe einer bestimmten beweglichen Sache oder einer Summe von bestimmten beweglichen Sachen (Art. 941 [1003] Abs. 1 griechische ZPO) 59.172
b) Herausgabe einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen oder von Schuldverschreibungen auf den Inhaber 59.173
c) Herausgabe von Grundstücken 59.174
d) Familienrechtliche Angelegenheiten 59.175
10. Zwangsvollstreckung bei Vornahme einer Handlung oder Unterlassung (bzw. Duldung) oder bei Abgabe einer Willenserklärung 59.176
11. Rechtsbehelfe des Zwangsvollstreckungsverfahrens 59.177
12. Vollstreckung ausländischer Titel 59.178 – 59.180
Gesetzesregister
Stichwortverzeichnis