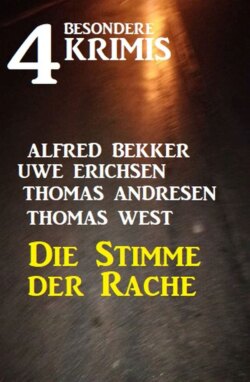Читать книгу Die Stimme der Rache: 4 besondere Krimis - Alfred Bekker - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление»Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Schalow«, sagte der stellvertretende Anstaltsleiter. Er hieß Effertz und war Regierungsrat.
Herr Schalow!
Schalow atmete langsam. Wie lange hatte niemand mehr Herr Schalow zu ihm gesagt! Er starrte auf die schlaffen Lippen des Mannes hinter dem zerkratzten Schreibtisch.
Der linke Mundwinkel hing ein wenig herab und zuckte hin und wieder.
»Ich hoffe, Sie nutzen Ihre Chance, Herr Schalow. Zwei Jahre hat das Gericht Ihnen erlassen. Ich will nicht sagen, geschenkt.« Effertz blickte an Schalow vorbei.
»Zu einer solchen Wortwahl bestünde auch keine Veranlassung«, sagte Schalow. Er wartete auf das Gefühl der Unsicherheit, auf den Ring, der seine Brust immer dann zusammenpresste, wenn er den Aufstand probte. Auf seine Weise. Mit ganz feinen Bemerkungen, die er sich hin und wieder leistete. Spitze, ironische Antworten, von denen er im stillen hoffte, dass die Aufseher sie nicht verstanden. Er war ein guter Gefangener gewesen. Er hatte so schnell wie möglich wieder herausgewollt.
Doch es hatte sich kaum gelohnt, dass er die Faust in der Tasche geballt hatte. Anderen Gefangenen, die sich nicht besser geführt hatten als er, hatte das Gericht sogar die Hälfte der zu bemessenen Strafzeit zur Bewährung ausgesetzt.
Ihm, Ernst Schalow, hatte man nur zwei von fünf Jahren erlassen.
Effertz' Blick wurde stechend. Der stellvertretende Anstaltsleiter hatte verstanden, was Schalow sagen wollte. Das Gefühl der Furcht blieb aus.
»Sie wissen Bescheid«, sagte der Regierungsrat unwirsch. »Ihr Anwalt hat Ihnen ja alles erklärt. Die Bedeutung der Bewährungsauflagen und so weiter.«
»Ja.«
Effertz wollte ihn los werden. Er unterschrieb einige verschiedenfarbige Formulare, die er Schalow anschließend in die Hand drückte.
Das eine musste er bei der Kleiderkammer vorlegen, das andere an der Kasse. Sechshundertvierzig Mark betrug sein Guthaben, ein Drittel dessen, was er während seiner Haftzeit verdient hatte und als Überbrückungsgeld zurücklegen musste.
Mit dem dritten Zettel konnte er seinen Anspruch auf eine Fahrkarte geltend machen. Bundesbahn oder ein vergleichbares öffentliches Verkehrsmittel, keine Barablösung.
Rot war der Wisch, den er am Tor abgeben musste. Der öffnete ihm die Tür in die Freiheit. Blieb noch der Entlassungsschein, den er dem Bewährungshelfer vorlegen musste.
»Sie sind noch jung, Herr Schalow, aber schon alt genug, um die Chance zu erkennen, die man Ihnen gibt.«
Schalow hörte nicht zu. Effertz spulte jetzt sein Programm ab. Es klang nicht sehr überzeugend, was er dem ehemaligen Strafgefangenen mit auf den Weg gab.
Schalow hatte mehrere ähnliche Instruktionen hinter sich. Erbauungsstunden nannten die anderen Gefangenen Vorträge dieser Art. Schalow hatte bald mit ihnen gefühlt, nachdem er erkannte, dass sie genauso litten wie er. Es spielte keine Rolle, ob einer zu Recht hinter Gittern saß oder nicht. Das Leiden einte sie. Dieses Gefühl der Solidarität hatte ihn die schreckliche Zeit leichter überstehen lassen.
Jetzt kam er endlich raus. Das erwartete Gefühl der Freude, diese Erregung, die er sich tausendmal in den letzten Tagen vorgestellt hatte, wollte sich jedoch nicht einstellen. Noch nicht.
Effertz stand auf. Mit den Händen schob er die Papiere auf seinem Schreibtisch hin und her. Erbringt es nicht fertig, dir die Hand zu geben, dachte Schalow.
»War's das?«, frage er.
»Ja, ja. Also noch einmal, alles Gute, Herr Schalow.« Effertz streckte die Hand aus. Schalow ergriff sie und drückte sie flüchtig.
*
Schalow sah sich um, als er die Justizvollzugsanstalt durch die eiserne Tür des Torhauses verließ. Er musterte die Fahrzeuge, die auf dem Besucherparkplatz standen. Ein roter Audi war nicht dabei. Seine Mutter hatte ihm bei ihrem letzten Besuch erzählt, dass sie immer noch den Audi führen.
Schalow ignorierte das Gefühl der Enttäuschung. Er hatte nicht wirklich erwartet, dass sein Vater ihn hier mit dem Wagen abholte. Der alte Herr konnte eben nicht aus seiner Haut. Vielleicht wartete er in Bonn am Bahnhof.
Mit dem kleinen Koffer in der Hand schlenderte er zur Bushaltestelle. Der Bus nach Bonn sollte in wenigen Minuten eintreffen. Die Entlassungsprozedur lief mit dem Fahrplan der Postbusse synchron.
Schalow sah an sich hinab. Der Anzug passte ihm noch genauso gut wie vor drei Jahren. Er war immer schlank und drahtig gewesen, und er hatte dafür gesorgt, dass er in der Haft weder seine Form noch seine Figur verlor.
Als er wieder aufsah, bemerkte er den dunkelbraunen Ford Granada mit dem Kölner Kennzeichen.
Der Wagen hatte eben noch auf dem Parkplatz vor der Anstalt gestanden. Jetzt rollte er langsam an Schalow vorbei. Keiner der beiden Insassen sah zu ihm her.
Schalow konnte den Mann am Steuer erkennen. Der Kerl hatte kurzgeschnittene Haare, ein nichtssagendes Gesicht und große Ohren.
Der Knilch im Fond sah ebenfalls starr geradeaus. Von ihm konnte Schalow kaum mehr als den Kopf und die Schultern erkennen. Das Haar war dünn, die Backen voll und rund, der kleine Mund wirkte verkniffen.
Hinter einer Biegung weiter unten entschwand der Wagen Schalows Blicken.
Er hinterließ ein Gefühl der Bedrohung.
*
Sein Vater stand nicht in Bonn am Bahnhof.
Schalow rief zu Hause an. Seine Mutter kam an den Apparat. Sie freute sich, jedenfalls hörte es sich ehrlich an, als sie immer wieder mit tränenerstickter Stimme seinen Namen stammelte.
»Mein Junge, ach Ernst, Junge ...«
»Ich hatte doch geschrieben«, sagte Schalow.
»Ach, Ernst! Vater konnte sich nicht losmachen, das musst du verstehen. Da ist irgendetwas mit den Tiefpumpen, er hat in der letzten Zeit viele Überstunden machen müssen.«
Er hat es nicht fertiggebracht, zu seinem Schichtmeister zu gehen und zu sagen, hören Sie, ich muss heute freinehmen, mein Sohn kommt aus dem Gefängnis. »Ja, ja, schon gut«, sagte er, weil seine Mutter sich bemühte, das Verhalten seines Vaters zu entschuldigen.
»Aber heute Abend essen wir schön zusammen. Ich habe dein Zimmer fertiggemacht. Vater hat es vorige Woche noch schnell neu tapeziert. Es ist hübsch geworden, Ernst.«
»Ich werde nicht bei euch wohnen«, sagte Schalow. Er sah auf den Münzschacht, durch den die Münzen klirrten. War das Telefonieren etwa schon wieder teurer geworden?
»Ernst!«
»Ich erkläre es euch nachher.« Viel zu erklären gab es nicht. Er wollte allein bleiben. Er wollte sich nach der sachlichen Fürsorge der Aufseher, die sich um alles kümmerten, was er tat, nicht der gefühlvollen Fürsorge seiner Mutter aussetzen. Und seinem Vater wollte er unnötige Peinlichkeiten ersparen. »Ich komme irgendwann am Abend. Vielleicht um sieben, spätestens halb acht. Ich muss erst nach Hürth zum Bewährungshelfer. Das will ich hinter mir haben.«
Und er wollte Monika sehen.
Oder doch wenigstens ihre Stimme hören.
»Ja, Ernst, das verstehe ich. Aber du schläfst doch wenigstens diese Nacht ...«
Die Verbindung riss ab, nachdem die letzte Münze verbraucht war.
*
Der Bewährungshelfer, dem er zugeteilt war, hätte ein Bruder des stellvertretenden Anstaltsleiters von Malldorf sein können. Ein mürrischer Behördenangestellter, um die fünfzig, mit ergrautem Haar, überarbeitet, unbeteiligt. Draußen an der Tür hing eine Karte mit seinem Namen und einem Kürzel, das den Dienstgrad angeben sollte. Schalow verstand die Bedeutung dieser Abkürzung nicht. Es war ihm auch vollkommen gleichgültig, ob der Mann nun Ober- oder sonst ein Inspektor oder Amtmann oder was auch immer war. Velten war ein berufsmäßiger Bewährungshelfer, ein Sozialarbeiter, Angestellter des Kreises.
Schalows Mitgefangene, die bereits über Erfahrungen mit Bewährungshelfern verfügten, bevorzugten die Berufsmäßigen. Die hatten, so lautete ihre einhellige Meinung, so viel zu tun, dass sie sich um einen einzelnen Schützling nicht übermäßig viel kümmern konnten.
Auch Ernst Schalow legte keinen gesteigerten Wert auf eine intensive Betreuung.
»Warten Sie draußen!«, sagte Velten etwas schärfer, als es nötig gewesen wäre.
Schalow zog seinen Kopf wieder aus dem Türspalt und schloss die Tür. Leise und behutsam. Er ärgerte sich im nächsten Moment darüber. An der Tür klebte ein rotes Stoppschild mit einer durchgestrichenen Zigarette.
Im Knast hatte er das Rauchen wieder angefangen, aber er hatte gelernt, die Sucht zu zähmen. Heute würde er erst nach dem Abendessen rauchen. Oder auch vorher, wenn er mit seinem Vater das erste Bier trank.
Wenn er Zigaretten bei sich gehabt hätte, hätte er sich jetzt jedoch eine angesteckt, um Velten die Bude zu verqualmen.
Velten holte ihn nach vier Minuten herein. Schalow gab ihm den Entlassungsschein. Der Bewährungshelfer deutete auf einen Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches, und Schalow nahm Platz. Velten ließ sich in einen bequemen Drehstuhl fallen, der leise quietschte, als er seinen Hintern hin und her bewegte.
Velten trug eine dicke Brille. Seine Lippen bewegten sich beim Lesen. Schließlich hob er den Kopf und äugte sein Gegenüber an.
»Ja, ich habe Ihre Akte gelesen, Schalow ...«
»Herr Schalow«, sagte Schalow. Sein flaches Gesicht mit der kleinen Nase und den geraden Lippen war hart und angespannt. Drei Jahre hatte er die Faust in der Tasche gelassen. Jetzt war er draußen. Wenn er hier auf seinem Recht bestand, konnten sie ihn deshalb nicht gleich wieder einlochen.
»Wie Sie wollen, Herr Schalow.« Velten bemühte sich, das Wort Herr nicht zu sehr zu betonen. Er lächelte dünn, aber seine Augen glitzerten. »Ich denke, wir werden miteinander auskommen. Ich betreue mehrere entlassene Gefangene, und den meisten habe ich ganz gut helfen können. Es liegt aber an Ihnen.«
»Natürlich.«
Immer lag es nur an ihm selbst. Er hätte nur die Namen seiner Komplizen zu nennen brauchen, dann hätte man über Hafterleichterungen reden können. Er sollte sich bescheiden aufführen, dann würde er während seines Aufenthalts in der JVA keine Schwierigkeiten bekommen. Immer lag es an ihm.
An wem sonst?
Sie hatten ihn verhaftet und auf die Rolle genommen. Aber es lag an ihm.
»Ja, da brauchen Sie gar nicht so ironisch zu reagieren. Ich habe auch Erfahrung mit Intelligenztätern, wie Sie einer sind.« Velten lehnte sich zurück. Sein beachtlicher Bauch stieß gegen die Schreibtischkante. Er rückte an seiner Brille.
»Ich bin weder ein Täter noch bin ich sonderlich intelligent«, sagte Schalow.
»Sie sind Ingenieur. Das ist doch was.«
»Einseitige Begabung. Dafür kann ich nicht einmal einen vernünftigen Brief schreiben oder eine formell richtige Eingabe an eine Behörde verfassen.«
Velten nickte jovial. Schalow gab eine Schwäche zu, das gefiel dem Beamten. Er klappte eine Mappe auf. Sie enthielt Schalows Akten. Das Urteil, die Beurteilung durch das Justizvollzugsamt über sein Verhalten während der Haft und das Protokoll des Gerichts über die Maßnahmen, die zu seiner vorzeitigen Entlassung geführt hatten. Und eine Aufzählung der Auflagen.
»Sie haben Ihre Täterschaft ja stets geleugnet«, bemerkte der Bewährungshelfer sinnend.
»Nein«, sagte Schalow.
»Was, nein?«
»Ich habe meine Täterschaft nie geleugnet.«
Veltens Kopf ruckte in die Höhe. Missbilligend starrte er Schalow an. Sein Hals rötete sich. »Aber hier steht ...«
»Ich konnte die Täterschaft oder Mittäterschaft, wenn sie sich schon auf die Protokolle in meiner Akte beziehen, weder leugnen noch zugeben. Ich hatte mit der Sache nichts zu tun.«
»Noch ein Justizirrtum«, seufzte der Bewährungshelfer.
»Ja, noch einer.«
»Was werden Sie jetzt tun? Auf die Barrikaden steigen? Ihre Unschuld beweisen?«
»Nichts dergleichen. Ich suche mir einen Job.«
»Das nenne ich vernünftig, Herr Schalow.« Eifrig wippte Velten nach vorn und durchstöberte den Inhalt eines Briefkorbes. »Ich habe mit dem Personalchef des Kraftwerkes Weilersdorf gesprochen. Er hat schon manchen meiner Schützlinge genommen. In Ihrem Fall hatte ich einige Schwierigkeiten, aber die konnte ich ausräumen.«
»Schwierigkeiten? Wieso? Ich habe auf Weilersdorf meine Lehre gemacht und dort als Elektriker gearbeitet.«
»Eben, das ist es ja. Sie haben auf Weilersdorf gelernt, dann haben Sie dort ein Jahr als Elektriker gearbeitet, ehe sie kündigten, um die Ingenieurschule zu besuchen. Sie haben das Examen mit gut bestanden, aber Sie haben keine Berufserfahrung als Ingenieur. Sie sind jetzt mit ...« Papier raschelte, »sechsundzwanzig auch schon recht alt für einen Berufsanfänger. Leider haben Sie ja auch ein Jahr ...« Velten suchte nach dem richtigen Wort, wobei er sichtlich Schwierigkeiten hatte.
»Herumgegammelt«, half ihm Schalow.
»Das haben Sie gesagt. Aber es trifft den Kern.«
In der Tat traf es den Kern. Er hatte dreieinhalb Jahre studiert. Geschuftet. Sich nichts gegönnt. Bevor der Ernst des Lebens begann und der Trott ihn gefangen nahm, hatte er sich noch einmal umsehen wollen. Er war durch England getrampt, hatte in Südfrankreich als Pferdebursche und Fremdenführer gearbeitet und schließlich einen halben Winter in der Türkei und die andere Hälfte in Griechenland verbracht. Er wollte keinen Tag dieses vergammelten Jahres missen.
»Also, Herr Schalow, Sie können auf Weilersdorf wieder als Elektriker anfangen. Mehr war für den Anfang nicht drin. Sie können den Job ablehnen, und ich würde Ihnen sogar helfen, eine passendere Stelle zu finden, aber wenn ich Ihnen raten darf, fangen Sie erst mal an. Sie können bei Ihren Eltern wohnen. Und zusehen, dass Sie Boden unter die Füße bekommen. Und dann bewerben Sie sich als Ingenieur. Ich werde für Sie bürgen. Nun, wie ist es?«
Die vergrößerten Augen hinter den Brillengläsern glotzten fragend. Schalow überlegte. Das kam alles so plötzlich. Er hatte sich erst einmal umsehen wollen. Ein paar Tage vielleicht. Monika treffen.
Monika.
Sein Herz zog sich zusammen.
»Nun?«, mahnte Velten.
»Wann soll ich anfangen?«
»Ich sagte es doch schon, möglichst bald. Ich habe dem Personalleiter gesagt, dass Sie am Mittwoch anfangen können. Er heißt Siebert. Ich glaube, Sie kennen ihn noch.«
Mittwoch. Das war übermorgen. Nun gut. Welche Rolle spielte es schon!
»In Ordnung«, sagte er.
Und dann: »Danke.«
»Nichts zu danken, Herr Schalow.« Velten wirkte erleichtert. Wahrscheinlich hatte er größere Schwierigkeiten erwartet. Schalow fragte sich, ob er nicht viel zu bescheiden und unterwürfig auftrat. Wahrscheinlich brauchte er längst nicht alles hinzunehmen.
Er würde dran denken.
Als er das Kreisgebäude verließ, war der braune Granada wieder da.
*
Schalow fuhr nach Köln. Der Koffer wurde ihm langsam lästig, aber er wusste nicht, wo er ihn lassen sollte.
Er stieg einmal falsch um und kam am Rudolfplatz raus. Er nahm die erste Straßenbahn, die zum Ebertplatz fuhr. An der Christophstraße stieg er aus und ging das Stück bis zur Einmündung der Von-Werth-Straße in den Hansaring zu Fuß.
Die Ecke hatte sich seit damals nur wenig verändert. Gerts Kneipe war noch da. Schalow sah an der schmutzig grauen Fassade eines älteren Mietshauses hinauf.
Im vierten Stock wohnte Monika.
Monika.
Er hatte sie kennengelernt, nachdem er aus Griechenland zurückgekommen war. Er sollte in zwei Monaten eine gute Stellung in Deutz antreten, und so hatte er für sein letztes Geld, das er zusammenkratzen konnte, einen Wagen gekauft. Autos waren seine Leidenschaft. Er war auf einen gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen BMW 2002 ti verfallen, der billig war, weil er gut einhundertfünfzigtausend Kilometer auf dem Tacho hatte. Schalow hatte ihn selbst ein wenig aufgemotzt. In der Werkstatt des Händlers, der ihm dafür sogar Werkzeug und eine Bühne überlassen hatte.
Bei ihm hatte es sofort eingeschlagen, bei Monika nur etwas später. Sie waren sich sehr schnell sehr nahegekommen, und sie hatten eine sehr schöne Zeit miteinander verlebt.
Drei Jahre hatte er von seiner Zeit mit Monika zehren müssen.
In den drei Jahren war Monikas Bild immer blasser geworden, bis er sich nur noch an ihr volles schwarzes Haar, die grün schillernden Augen und die kleinen Brüste erinnern konnte. Doch an die Stelle der bildhaften Erinnerung war etwas anderes getreten. Das schmerzende Wissen um leidenschaftliche Umarmungen, an eine bedingungslose Hingabe, wie er sie vorher noch nie erlebt hatte. Sie hatten viel Zeit füreinander gehabt, weil er noch nicht arbeitete und Monika manchmal ganze Tage und Nächte bei ihm verbringen konnte. Ihr Mann war viel verreist.
Schalow betrat Gerts Kneipe. Er bewegte sich unsicher. Gesichter wandten sich ihm zu. Damals hatte er hier manchmal auf Monika gewartet. Darauf, dass sie aus dem Eingang gegenüber trat und rechts in den Ring einbog. Dann war sie am Hansaplatz in seinen Wagen gestiegen und hatte gewartet, bis er kam.
Schalow kannte keins der Gesichter. Nur der Mann hinter der Theke war damals schon dort gewesen. Seinen Namen hatte er vergessen.
Er drängte sich hinter das kurze Ende der Theke, stellte den Koffer an die Wand und setzte sich auf einen freien Hocker.
Er bestellte Mineralwasser und sah nach draußen. Die zurückgezogene Haustür lag in seinem Blickfeld. Er würde Monika sofort erkennen. Nachmittags bummelte sie gern herum.
Als er nach links sah, zuckte er zusammen.
Gerade rumpelte der braune Granada auf den Gehsteig vor einem Hotel. Hastig trank Schalow, ohne den Wagen aus den Augen zu lassen.
Die hintere rechte Tür sprang auf, und zwei kurze Beine schwangen heraus, hingen einen Moment in der Luft, ehe die kleinen Füße das Pflaster berührten.
Der Mann, der sich jetzt aus dem Wagen schob, war klein und dick. Das schüttere Haar bedeckte die rosige Kopfhaut nur unzureichend. Der Mann sagte etwas zu dem Burschen am Steuer, ehe er die Tür zuwarf und sich umwandte.
Mit eiligen kurzen Schritten kam er auf die Tür der Kneipe zu. Für einen Moment entschwand er Schalows Blicken, dann betrat er das Lokal.
Er sah sich rasch um, streifte Schalow mit einem schnellen, abschätzenden Blick, ehe er seine Augen weiterwandern ließ und das andere Ende des Tresens ansteuerte. Dort stellte er einen seiner kleinen Füße auf die Trittstange und hielt sich am Handlauf fest, als ob er befürchtete, nach hinten überzuschlagen.
Er hatte runde Augen, die seltsam nackt wirkten und dunkel glänzten wie nasse Steine. Der hellgraue Anzug saß etwas knapp. Das Jackett war über dem kugelrunden Bauch zugeknöpft. Schalow konnte nicht ausmachen, ob der Dicke eine Pistole am Gürtel trug. Unter der Achsel bestimmt nicht, dafür spannte das Jackett zu sehr.
Der Dicke bestellte ein kleines Kölsch. Als der Barmann das Glas vor ihn hinstellte, rührte er es nicht an. Schalow kam es so vor, als musterte er jeden einzelnen Anwesenden. Als ob er sich die Gesichter ins Hirn brennen wollte, um sie später mit Fotos vergleichen zu können.
Schalows Herz pochte hart. Er kaufte eine Packung Zigaretten und zündete eine an. Das Herzklopfen blieb.
Monika kam nicht. Und wenn sie kam, würde er sie nicht ansprechen. Nicht, solange er den Dicken im Nacken hatte. Monika hatte mit der Sache nichts zu tun. Sie hätte ihm nicht einmal ein Alibi geben können. Deshalb hatte er sie damals nicht mit hineingezogen, und er würde auch nicht nachträglich die Geier auf sie loslassen. Es würde niemandem nützen und ihr nur schaden. Ihr Mann war zumindest wohlhabend, und er, Schalow, konnte ihr nichts bieten. Damals nicht, und heute schon gar nicht.
Es war jetzt halb sechs. Wenn er rechtzeitig bei seinen Eltern in Huckerath sein wollte, musste er spätestens gegen sechs hier raus.
Der kleine Dicke leerte sein Glas, bezahlte und verließ die Kneipe. Schalow sah ihm nach, bis er wieder in den Granada stieg. Der Wagen blieb vor dem Hotel stehen. Als stumme Drohung.
Um Viertel vor sechs bezahlte Schalow ebenfalls. Er ging zum Ring, wo er eine Telefonzelle betrat. Er suchte die Nummer heraus und steckte zwei Groschen in den Apparat. Der braune Granada glitt vorbei. Schalow stellte sich so, dass von außen nicht zu erkennen war, welche Nummer er wählte. Das Telefonverzeichnis klappte er wieder zu.
Nach dem zweiten Aufläuten wurde abgehoben.
»Ja, Heikaus!«, meldete sich eine barsche Stimme.
Monikas Mann!
Hastig legte Schalow den Hörer zurück. Er nahm seinen Koffer und verließ die Kabine. Der Granada wartete ein Stück weiter im Halteverbot. Schalow konnte das Gesicht des kleinen Dicken erkennen, der aus dem Rückfenster blickte.
Schalow ging zu Fuß zum Hauptbahnhof, wobei er Einbahnstraßen benutzte. In der verkehrten Richtung.
Den Granada sah er nicht mehr.
*
Sein Vater vermochte so etwas wie Wiedersehensfreude nicht einmal zu heucheln.
Steif saß er am Esstisch und aß sein Brot, wie er es immer tat. Seinen Sohn hatte er zweimal im Jahr besucht, insgesamt also sechsmal. Und das vermutlich auch nur, weil Ernsts Mutter darauf bestanden hatte.
»Du willst also wieder auf Weilersdorf anfangen«, sagte er endlich. Er öffnete eine Flasche Bier und goss die Gläser voll, wodurch er es vermeiden konnte, seinen Sohn anzusehen.
»Ja. Als Elektriker. Vorübergehend«, antwortete Ernst, dem die zähen Wortwechsel auf die Nerven gingen. Seine Mutter eilte emsig hin und her, lächelte ihrem Sohn zu, drückte seine Schulter.
»Die brauchen keine Ingenieure«, stellte Wilhelm Schalow fest. »Jedenfalls keine, wie du einer bist. Keine Schmalspuringenieure. Jünkerath, das ist der Betriebsratsvorsitzende in der Grube, weißt du, der sagt, dass die auf dem Kraftwerk nur noch Diplomierte einstellen. Die treten sich schon gegenseitig auf die Füße und nehmen sogar schon den Meistern die Arbeit weg.«
»Da sind die selbst schuld. Ich bleibe auch nicht auf dem Kraftwerk. Ich versuche es in Köln. Im Schaltschrankbau, oder in der Klimatechnik. Mal sehen.«
»In Köln? Ja, willst du denn jeden Tag nach Köln fahren?«
»Nein.« Jetzt war es Ernst, der nach dem Glas griff, um seine Verlegenheit und Unsicherheit zu überspielen.
Seine Mutter schwirrte umher. Warnend sah sie Ernst an, dann lachte sie nervös. »Er will nicht bei uns bleiben«, sagte sie.
»Warum nicht? Was gefällt dir hier nicht? Ich kann ja verstehen, dass du nicht jeden Tag nach Köln fahren willst. Aber hier draußen kannst du billiger leben. Und außerdem ... darfst du denn überhaupt nach Köln ziehen? Ich meine ...«Er verstummte und sah hilfesuchend seine Frau an.
»Ich darf, Vater. Ich darf mich nur nicht mit meinen ehemaligen Komplizen treffen.«
Ernst leerte sein Bierglas. Er ignorierte die beunruhigten Blicke seiner Mutter. Sie tat ihm leid. Sie würde es ausbaden müssen, wenn er seinen aufgestauten Aggressionen nachgab.
Das Gesicht seines Vaters lief rot an. »Du hast es gerade nötig, dich über uns lustig zu machen! Ein wenig Bescheidenheit stünde dir gut an!«
»Wieso? Jetzt sag bloß, nach allem, was du für mich getan hast!« Ernst spürte, wie sich die Wut in seinem Magen zu einem Klumpen verdichtete. Er wusste, dass er jetzt ungerecht sein würde. Sein Vater trug genauso wenig Schuld an dem Geschehen wie er, Ernst Schalow, selbst. Aber drei Jahre lang hatte er dem Zorn keine Chance geben dürfen.
»Ja, nach allem, was wir für dich getan haben ...«
»Vom ersten Lehrjahr an habe ich Geld abgegeben. Danach habe ich ein Jahr lang gut verdient, ehe ich zum Bund musste. Mein Studium habe ich mit BAföG und Ferienarbeit finanziert. Davon habe ich sogar noch sparen können. Seit ich siebzehn war, habe ich dich keinen Pfennig mehr gekostet.«
»Du darfst das alles nicht so materiell sehen.«
»Wie denn?«
»Du musst wissen, dass wir viel durchgemacht haben deinetwegen. Wir leben nun einmal auf dem Dorf. Du warst das Tagesgespräch. Ein Terrorist in Huckerath ...«
Ernst wurde blass. »Da hatte ich doch schon 'ne Ewigkeit in Köln gelebt«, stieß er gepresst hervor.
»Aber hier haben die Reporter herumgelungert! Die Polizei hat mein Haus durchsucht!« Wilhelm Schalow richtete sich kerzengerade auf. Seine Augen blickten starr.
»Ich habe euch immer gesagt, ich habe ...«
»Kein Rauch ohne Feuer«, unterbrach Wilhelm Schalow bedächtig seinen Sohn. »So denken die Leute hier eben. Und ich kann's ihnen nicht einmal verübeln.«
»Du bist wie sie. Du glaubst mir nicht.«
»Die Polizei hat eine Pistole bei dir gefunden. Wieso hattest du eine Pistole, wenn du nichts mit diesen Verbrechern zu tun hattest?«
Der Klumpen in Ernsts Magen löste sich langsam auf und machte einem Gefühl hilfloser Bitterkeit Platz.
»Die habe ich in Griechenland gekauft. Für wenig Geld. Ich konnte eben nicht widerstehen. Das habe ich alles erklärt.«
»Ja, du hast so vieles zu erklären gewusst, aber längst nicht alles. Auch dieser ... dieser Wissmeyer ...«
»Gerd.«
»Wie bitte?«
»Er heißt Gerd. Du hast ihn immer Gerd genannt.«
»Also, auch dieser ... Gerd war ein paarmal hier und hat versucht, gut Wetter für dich zu machen. Er war dein Freund. Nun schön, sein Verhalten spricht für ihn. Aber woher sollen wir, deine Mutter und ich, wissen, was wahr ist? Die Zeitungen schrieben über dich. Es waren schlimme Sachen. Weiß Gott, sehr schlimme waren dabei. Ich hatte eine verdammt schwere Zeit auch in der Kolonne.« Wilhelm Schalow nickte bekräftigend.
»Die Berichte in den Zeitungen waren gelogen. Jedenfalls die, auf die du jetzt anspielst.«
»Aber es stand da. Es hieß, du seist in einem Palästinenserlager gewesen, wo man dich zum Guerilla ausgebildet habe.« Wilhelm Schalow sah seinen Sohn an. »Den Bericht hat mir der Meister unter die Nase gerieben, und ich habe gesagt, das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein.«
»Ich konnte nachweisen, dass ich nie im Libanon war oder wo immer sich das Lager befunden haben soll«, entgegnete Ernst müde. »Das haben sogar die vom Verfassungsschutz zugeben müssen. Auch in Jugoslawien habe ich mich nicht mit internationalen Terroristen getroffen, wie es einmal hieß. Ich bin nur durchgefahren. Aber lassen wir das, es ist vergangen.«
Es war nicht vergangen.
Der braune Granada bewies, dass die drei Jahre nichts bedeuteten für sie. Und andere würden sich vielleicht auch an seine Fersen heften. Sein Anwalt hatte ihn gewarnt. Von der Beute war bisher keine Mark wieder aufgetaucht.
Auch sein Vater gab noch nicht auf.
»Das Gericht hat dich für schuldig befunden«, sagte er störrisch.
»Das Gericht! Das Gericht! Vater, die Justiz ist Bestandteil dieses Systems! Sie bedeutet eine ständige Drohung, sie ist ein Mittel der Repression ...« Mein Gott, dachte er betroffen, jetzt rede ich wie sie, wie einer von denen, für die ich gehalten werde. Am nachdenklichen Blick in den Augen seines Vaters erkannte er, dass er dasselbe dachte.
Steif sagte Wilhelm Schalow: »Als du schon längst verurteilt warst, kamen diese Männer immer noch. Ich weiß nicht, wer sie waren.«
»Verfassungsschutz, Vater. Sie waren auch ein paarmal bei mir. Haben versucht, mich umzudrehen. Ich sollte meine Komplizen nennen. Sie würden mich schon vor deren Rache schützen und dafür sorgen, dass ich ein neues Leben irgendwo anders anfangen könnte. Sie wollten mir sogar Geld geben.«
»Und? Hast du ihnen ...«
Ernst sprang auf. Die Bierflasche kippte um.
»Ja, verstehst du mich denn nie, Vater? Rede ich denn immer an dir vorbei? Ich habe gesagt, dass ich mit der Sache nichts zu tun hatte! Ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin! Es war blinder Zufall! Gottverdammter blinder Zufall!«
Ernst wandte sich um und stürmte hinaus. Er war dabei, seine Fassung zu verlieren.
Er ging durch den Garten. Allein. Der Rasen war sauber geschnitten. Die beiden Apfelbäume und die Kirschbäume hingen voller kleiner grüner Früchte.
Er drehte sich nicht um, als er die Schritte seines Vaters hörte. Schweigend gingen sie nebeneinanderher.
»Entschuldige«, sagte Wilhelm Schalow endlich. »Ich werde nicht mehr darüber sprechen. Aber du musst wissen, dass ich dich den Nachbarn und meinen Kollegen gegenüber immer in Schutz genommen habe.«
»Ja, ja.« Du kannst nichts dafür, du bist nun mal so, dachte er. Laut fuhr er fort: »Du hast eben von Gerd gesprochen. Weißt du, wo er jetzt wohnt?«
Gerd Wissmeyer und Beate Duven hatten ihn am Anfang zweimal in der JVA besucht. Da hatten sie dann über Verschiedenes gesprochen. Über Heuchelei und darüber, dass der Kontakt mit Freunden ihm manches noch schwerer machte. Sie hatten versprochen, Freunde zu bleiben, bedingungslos, aber sie wollten einander nicht sehen und sich auch nicht schreiben. Sie hatten sich daran gehalten.
»In Köln wohnt er, nehme ich an.«
»Nein.«
»Weißt du denn, ob sie verheiratet sind? Gerd und Beate, meine ich.«
»Die heiraten doch nicht! Das sind doch so welche, die ...« Wilhelm Schalow bemerkte gerade noch rechtzeitig den Blick seines Sohnes, um den Satz abzubrechen. »Deine Mutter hat dein Zimmer in Ordnung gebracht. Sie hat sich so auf deine Rückkehr gefreut.«
»Ich weiß. Aber morgen suche ich mir ein Zimmer.«
»Morgen schon? Aber ich dachte, du wolltest erst ausziehen, wenn du die Stelle in Köln gefunden hast.«
»Ich suche mir ein Zimmer in der Nähe. Vielleicht in Oberaußem. Dann habe ich es näher zur Arbeit.«
»Ist es wegen eben? Wegen mir, meine ich?«
»Nein. Jedenfalls nicht nur. Ich muss mein Leben endlich selbst bestimmen können.«
»Du musst es wissen, Junge. Nur ...« Er sah zu Boden und suchte nach Worten.
»Ja? Was denn?«
»Mach keine Dummheiten mehr, verstehst du?«
»Keine Sorge, Vater. Kann ich morgen deinen Wagen haben? Ich bringe dich zur Schicht und hole dich wieder ab.«
»Nicht nötig. Ich kann mit einem Kollegen fahren. Du kannst ihn gern haben, bestimmt.«
Ernst sah seinen Vater an. Stumm betrachtete er das Gesicht. Es war faltig und streng. Er ist alt geworden, dachte Ernst. Er sah es an den müden Augen. Oder er sah es deshalb, weil sein Vater ein Fremder für ihn war.