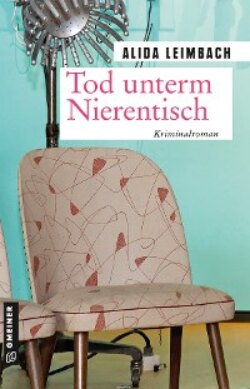Читать книгу Tod unterm Nierentisch - Alida Leimbach - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Kapitel
ОглавлениеFritz Starnke war dazu übergegangen, mit Klebestreifen vorsichtig die Fingerspuren abzunehmen und sie anschließend auf weißes Papier zu kleben. Das nahm einige Zeit in Anspruch.
»Was geschieht nun mit ihm?«, fragte Bettine und deutete auf den Toten.
Conradi verstaute seine Kamera in der ledernen Fototasche und schlug ein dünnes Filztuch darüber, ehe er den Reißverschluss schloss. »Haben Sie einen Fernsprechanschluss?«
»Ich habe Sie doch angerufen.«
»Verzeihung.« Conradi schlug sich gegen die Stirn.
»Folgen Sie mir bitte!« Bettine beeilte sich, vor ihm ins Büro zu gehen, das sich neben einem der beiden Lagerräume hinter dem grünen Samtvorhang befand. Er wartete, bis sie den Raum verlassen hatte, und schloss die Tür hinter ihr. Die Wählscheibe des schwarzen Telefons schnarrte, als er auswendig die Nummer der Vermittlung anwählte. Er ließ sich mit einem Osnabrücker Bestattungsunternehmen verbinden.
Nach etwa einer halben Minute meldete sich ein Bestatter aus der Martinistraße. Conradi erteilte ihm den Auftrag, eine Leiche in der Johannisstraße abzuholen und in die Gerichtsmedizin zu bringen.
*
Bettine atmete auf, als die Polizei endlich verschwunden war. Sie klopfte an der Tür ihrer Großmutter und gab Bescheid, dass sie noch einmal das Haus verlassen müsste. Erstaunt blickte sie auf Karl, der auf Wilmas roséfarbenem Sessel saß und in der »Hörzu« blätterte. Seit Neuestem war darin nicht nur das Rundfunk-, sondern auch das Fernsehprogramm zu finden, was ihn brennend interessierte, obwohl er außer der Tagesschau bisher keine einzige Sendung gesehen hatte. »Was machst du hier?«, wollte sie von ihm wissen. »Wo warst du die ganze Zeit?«
»Hier, warum?«
»Du weißt genau, was ich meine.«
»Nee, weiß ich nicht. Ich war arbeiten und dann im Bett. Ich bin erkältet.« Er hustete demonstrativ.
Sie sah ihn düster an. »Aha.«
»Jetzt willst du noch mal fort?«, fragte Wilma Müller, erwartete aber keine Antwort.
»Ist die Polizei noch da?«, fragte Karl ängstlich.
»Gerade gegangen.«
»Haben sie schon etwas rausgefunden?«
»Nein, gar nichts.«
»Was hast du denen gesagt?«
»Nichts. Das heißt, doch: Ich habe von Erwin Bartsch erzählt.«
Er atmete auf. »Das klingt gut. Den können sie gerne mal verhören. Wer weiß, vielleicht ist der Fall dann ja ratzfatz gelöst.«
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht.« Bettine warf ihm einen herausfordernden Blick zu und schloss behutsam die Tür. Auf Socken schlich sie die Treppe herunter, zog sich erst unten die Schuhe an und verließ den Friseursalon durch die Hintertür.
Im Hof stand ihr Fahrrad. Gut, dass ihr Bruder erst am Vortag die Reifen aufgepumpt und ein neues Kleidernetz angebracht hatte. Es war lästig, mit Röcken und Kleidern Fahrrad zu fahren. Da hatten es die Jungs bedeutend leichter. Viel lieber hätte auch sie Hosen getragen. Neulich hatte sie ein Mannequin damit in der »Constanze« gesehen. So eine Hose würde ihr auch gefallen, an den Fesseln schmal und oben weiter geschnitten, aber damit durfte sie ihrer Mutter und Großmutter nicht kommen. Seit Wochen kämpfte sie für einen modernen Kurzhaarschnitt, denn sie hatte ihre langen, pflegeintensiven Haare satt. Und unmodern waren sie sowieso. Wenn sie erst einmal volljährig war, in weniger als zwei Jahren, würde sie tun und lassen können, was sie wollte, enge Hosen und kurze Haare tragen, rauchen und Cocktails mit Alkohol trinken, aber bis dahin war es noch lange hin. Vor allem wollte sie so schnell wie möglich heiraten, damit sie ausziehen und auf eigenen Füßen stehen konnte.
Ihr Weg führte sie quer durch die zerstörte Stadt. Noch immer hatte sich Bettine nicht an den Anblick der Häuserruinen und Bruchsteinberge gewöhnt, auch wenn sie allmählich kleiner wurden. Es ging langsam, viel zu langsam voran. Sie fragte sich, wie die Alten so viel Geduld aufbrachten. Sie hatte diese Geduld nicht. Es sollte alles wieder so aussehen wie vor dem Krieg! Die Häuser sollten gefälligst heil und schön sein wie in der Straße, in der Edmund lebte. Dort war alles unverändert. Als hätte es den Krieg nie gegeben. Nur dort kam Bettine zur Ruhe, nur dort konnte sie aufatmen, an eine Zukunft glauben und sich auf sie freuen!
Als sie ihr schwarzes Damenfahrrad gegen die Mauer lehnte, bemerkte sie, dass sich im oberen Stock die Gardine bewegte. Sie blickte hoch und sah Edmund am Fenster stehen. Schnell schloss er die Gardine wieder, noch ehe sie zum Gruß ansetzen konnte. Edmund Kettler wohnte in einem herrschaftlichen Gründerzeithaus in der Friedrichstraße, mit Dienstboten und einem parkähnlichen Grundstück dahinter. Geduldig wartete sie vor der Tür, bis er ihr öffnete. »Was ist passiert, Daisy?«, fragte er, als er ihr Gesicht sah. »Hast du geweint?« Er nannte sie bei diesem Kosenamen, weil sie bei ihrer ersten Begegnung wie die Comicfigur eine große Schleife im Haar getragen hatte.
»Er ist tot«, sagte sie und hoffte, dass er sie in den Arm nehmen würde.«
»Wer?«
»Rolf.«
»Rolf? Oh nein! Wie das? Was ist passiert?«
Sie erzählte es ihm. »Darf ich hereinkommen?«
»Es geht nicht, Tine. Wir haben Besuch, und außerdem wollen meine Eltern nicht, dass du herkommst. Sei nicht traurig, Daisy-Liebes, ein anderes Mal, ja?«
Fassungslos musterte sie seine Mimik. »Und du? Was willst du?«, fragte sie ängstlich.
Er wand sich. »Ich habe dich gerne um mich«, sagte er verlegen. »Das weißt du ja. Du bist wie die süße kleine Schwester, die ich gerne gehabt hätte. Aber vielleicht lieber woanders? Bei euch zu Hause? Das wäre mir lieber. Hier ist es nicht so günstig.«
Süße kleine Schwester, hatte er das wirklich gesagt? Meinte er das so? »Aber warum?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Ich erwarte ein Kind von dir, Edmund!«
Er seufzte leise. »Ich weiß.«
»Ja, aber ich hatte das Gefühl, du hast die Nachricht gar nicht richtig aufgenommen. Zumindest hast du nicht einen Funken Freude gezeigt.«
»Ja … doch, klar freue ich mich. Ich liebe kleine Kinder!«
»Du hast gesagt, du heiratest mich!«
Er seufzte. »Daisy, mein Liebes, was mache ich nur mit dir? Na, dann komm halt mit rauf«, sagte er schließlich, sah sich nach allen Seiten um und schloss rasch die Tür hinter ihr. »Meine Eltern sind ja zum Glück beschäftigt und werden es nicht merken. Ich kann dir ein neues Stück auf dem Saxofon vorspielen. Ich habe es selbst komponiert. Es klingt ein wenig traurig. Magst du es hören?«
»Nach Herzschmerz?«
»Ja, vielleicht auch das.«
*
»Und Ihnen ist nichts aufgefallen?« Johann Conradi befragte den siebten Nachbarn von Rolf Schmalstieg, einen hageren älteren Herrn, der seine Brötchen mit dem Schneidern von Oberhemden verdiente.
»Nein, absolut nichts. Ich habe das Fußballspiel am Radio verfolgt und nebenbei genäht. Im Moment habe ich viel zu tun. Die Herren der Schöpfung leisten sich wieder etwas. Durch das Rattern der Maschine höre ich nichts von der Straße. Und das Radio habe ich laut gestellt, damit ich überhaupt etwas mitbekomme. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann.«
Johann Conradi und Fritz Starnke bedankten sich und gingen ein Haus weiter, in dem mehrere Parteien wohnten. Aber auch hier Fehlanzeige. Schließlich klingelten sie bei einer Maßschneiderin. Die Frau winkte ab. Sie habe nichts gehört und nichts gesehen. Ihr strubbeliger kleiner Terrier kläffte während der kurzen Befragung die Beamten wütend an. Er wollte nicht aufhören mit dem Gebell, bis die Schneiderin schließlich in die Küche ging und ihm ein Stück trockenes Brot zuwarf. Endlich war Ruhe. Das brachte die Kommissare aber nicht weiter. Wenige Minuten später gingen sie wieder, klingelten an Wohnungstüren und befragten die Bewohner. Sie waren nicht mehr allein. Über Funk hatte Conradi in der Zwischenzeit Kollegen angefordert, die bereits ausgeschwirrt waren, um sich auf die Suche nach verdächtigen Personen und Zeugen zu begeben. Sie gingen von Haus zu Haus, suchten in Mülleimern, Hausecken und Vorgärten nach Spuren. Fast wollten sie aufgeben, da bekamen sie von einem Steinmetz den Hinweis, er habe beim Nachhausekommen vom Gesangsverein einen schwarzhaarigen Mann auf einem Moped gesehen, der aus der Hofeinfahrt neben dem Friseursalon gekommen sei und ihn fast überfahren habe. »Passen Sie doch auf, Sie Lümmel«, habe er hinter ihm hergerufen, aber der Motorradfahrer schien ihn gar nicht wahrzunehmen, als wäre er betrunken. Johann Conradi bedankte sich für den Hinweis und machte sich Notizen. Er wollte wissen, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelte, aber darauf hatte der Zeuge leider nicht geachtet.
Auf dem Rückweg zum Salon fiel Conradi ein kleiner Zettel im Rinnstein auf. Als er ihn aufhob, sah er, dass es die Visitenkarte eines Arztes in der Lotter Straße war. »Dr. Bernhard Ritter«, stand in feiner Schrift auf der geknickten Karte, »Facharzt für Nerven- und Gemütskrankheiten«. Conradi steckte sie in seine Jackentasche und leuchtete vorsorglich mit seiner Taschenlampe den Rinnstein bis zum Neumarkt ab. Starnke nahm sich die entgegengesetzte Richtung bis zum Rosenplatz vor. 90 Minuten später trafen sie sich wieder und brachen die Suche ab.
*
Die Straßenbahn hatte glücklicherweise drei Minuten Verspätung. Im Laufschritt erreichte Conradi sie. Er war auch schon einmal besser in Form gewesen, stellte er fest, als er sich schnaufend vor Anstrengung auf den Einzelsitz hinter dem Fahrer gleiten ließ. Dabei ignorierte er das Schild Platz freizuhalten für Gebrechliche und Kriegsversehrte. Sollte jemand mit einem Krückstock oder einer Armbinde kommen, die ihn sichtbar als Blinden auswies, würde er den Platz räumen. Aber das war um die Uhrzeit eher ungewöhnlich.
Regentropfen perlten von den beschlagenen Scheiben, als Johann Conradi ein Stück freiwischte, um hinauszusehen. Es war ein Tag im Juni, einer der längsten Tage des Jahres, die Bäume standen in vollem Laub, in den sattgrünen Mittelstreifen des Heger-Tor-Walls blühten Levkojen, Bartnelken, Lilien und Rosen und weckten die Vorfreude auf einen schönen Sommer. Aber der wollte sich einfach nicht einstellen. Conradi schob seine trübe Stimmung auf das Wetter. Dabei wusste er genau, dass es den geringsten Anteil daran trug. Müde fühlte er sich, gehetzt und abgespannt.
Als die Tram vom Wall in die Lotter Straße einbog, stieß sie fast mit einem schwarzen VW Käfer zusammen, dessen Fahrer beim Hupton erschrocken das Lenkrad verriss. Der Straßenbahnführer drosselte das Tempo, leierte das Fenster herunter und brüllte ein paar derbe Schimpfwörter. Auch das Vierergespann, das direkt vor ihnen herfuhr und Bierfässer transportierte, war aus dem Takt geraten. Die Pferde wieherten und brachen aus. Der Bierkutscher hatte Mühe, sie wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Auf der Höhe des Königlichen Realgymnasiums, in dem Conradi die letzten Jahre seiner Schulzeit verbracht hatte, zockelte die Bahn in einem gemächlichen Tempo weiter. Das Gespann mit den vier kräftigen Friesen war in die Bergstraße zur Brauerei abgebogen. Der kräftige Malzgeruch des Osnabrücker Bergquellpilseners wehte für einen Moment durch die gekippten Fenster und weckte Conradis Lust auf ein Feierabendbier.
Kurz hinter Feinkost Remme vertiefte er sich in die Osnabrücker Tagespost. Er wollte die Ruine nicht sehen, konnte es nicht ertragen, dass sein früheres Glück nur noch aus einem Haufen Steine bestand. Ein einziges Mal war er noch an dieser Stelle gewesen, kurz nach seiner Ankunft in Osnabrück vor etwa fünf Wochen, hatte vor den Trümmern gestanden, die Augen geschlossen und wie ein kleines Kind gebetet, dass alles lediglich ein Albtraum war. Erst als ihm schwindlig wurde, fasste er sich ein Herz, näher heranzutreten. Seine alte Wohnung lag im Erdgeschoss. Der früher gepflegte Rasen im Vorgarten war von Disteln und Unkräutern überwuchert. Fenster und Türen waren kaputt und notdürftig mit Pappe vernagelt, Möbel gab es kaum noch, die brauchbaren waren offenbar geplündert worden, aber die Tapeten … zumindest die Reste davon … Ihm war es gelungen, an jedem Fenster ein Stück Pappe zu entfernen. Am meisten schmerzte die bunte Kindertapete mit dem Schneewittchen-Motiv. Er konnte kaum hinsehen, musste seine aufsteigenden Tränen unterdrücken. Auch das Badezimmer mit den schwarzen Fliesen weckte Erinnerungen in ihm. Im rosafarbenen Handstein hatte seine Frederike vor Jahren das Baby gebadet. Es hatte gejuchzt und mit Ärmchen und Beinchen gestrampelt. Nur beim Herausnehmen aus dem herrlich warmen Nass hatte es mit Geschrei protestiert. Ruhe stellte sich erst wieder ein, als Frederike es in ein auf dem Ofen vorgewärmtes Badetuch wickelte, herzte und küsste. Jeden Sonnabend heizten sie den hohen Kupferboiler an, um nacheinander in der freistehenden Badewanne ein Vollbad zu nehmen. Als Lilly größer wurde, durfte sie als Erste rein. Dann gab es Abendessen, zu dritt in der Wohnstube mit der hellen Streifentapete. Während Frederike die Kleine zu Bett brachte, machte er Feuer im Kamin. Der Anblick des ursprünglich weinroten Sofas mit der geschwungenen Holzlehne, auf dem er beim gemütlichen Licht der Stehlampe mit Frederike gesessen, Radiomusik gehört und gelesen hatte, während sie handarbeitete, war fast unerträglich. Schutt lag auf dem Sofa, zerschlissen war der Stoff, zerbrochen die Holzumrandung, vor lauter Dreck war die Farbe undefinierbar geworden, sah nun eher aus wie braungrau. Dann das Zimmer zum Osten hin mit der Veilchentapete … Sein Herz machte einen Satz. Oft hatten sie sich am späten Abend in dem großen massiven Ehebett geliebt. Die Schlafzimmermöbel hatte Frederike von ihren Großeltern geerbt, aber die zartblaue Tapete hatten sie gemeinsam ausgesucht. In Fetzen hing sie von der Wand und erinnerte an eine glücklichere Zeit. Möbel waren nicht mehr vorhanden, bis auf einen Schemel mit drei Beinen. Es zerriss etwas in ihm, das alles in diesem Zustand zu sehen und endgültig Abschied zu nehmen. Er hatte versucht, noch einmal, ein letztes Mal, in die Wohnung zu gelangen und einen Gegenstand zu retten, ein Erinnerungsstück, aber es hatte keinen Zweck – die wenigen Sachen, die noch da waren, waren unbrauchbar geworden, und er wollte sie ohnehin eigentlich gar nicht. Nicht nur das Haus war ein Trümmerhaufen, sondern auch der alte Hühnerstall im Garten, in dem Lilly vor dem Abendbrot mit Begeisterung Eier gesucht hatte. Die Erinnerung an unbeschwerte Tage war fast körperlich greifbar, und er fühlte einen bohrenden Schmerz, der wie ein Messer in seine Brust schnitt. Nicht nur das Haus, sondern sein Leben war ein Trümmerhaufen.
Damals hatte er nicht geahnt, dass die Zeit mit Frederike und Lilly die schönste in seinem Leben gewesen war. Der Höhepunkt auf seiner Lebensleiter war sang- und klanglos verstrichen, und er hatte es nicht einmal bemerkt. Sie hatten es schön miteinander gehabt, eine gute Zeit, aber viel zu kurz. Vorbei, es war vorbei. Johann Conradi hätte gerne an der Uhr gedreht, alles auf Anfang gesetzt und jeden Tag, jede Stunde und jede Minute zurückgeholt. Nun blieb ihm nur, die Augen zu schließen und seinen Kopf wegzudrehen, wenn die Straßenbahn die frühere Adresse passierte.
Ich kann nicht mehr lieben, dachte er, mein Herz ist tot, und das ist kein Wunder. Ich bin einsam, wie ich es noch nie in meinem Leben war, und ich werde für immer einsam bleiben.
Sein neues Zuhause war nur eine Haltestelle entfernt. Es fiel ihm wieder ein, dass er Geburtstag hatte, knapp zwei Stunden noch. Viel Zeit blieb ihm nicht, um noch etwas daraus zu machen. Er war allein und sah keinen Grund zu feiern. Vielleicht wäre es bei sommerlichen Temperaturen einfacher gewesen.
An der Haltestelle Depot stieg er aus. Am Kiosk kaufte er nicht nur die Abendzeitung wie gewöhnlich, sondern außerdem eine kleine Flasche Kupferberg Gold, eine Tafel Schokolade und eine Zigarre. Hinter ihm wartete eine Frau, die damals mit Mann und Kind auf der gleichen Etage gewohnt hatte. Er lupfte seinen Hut, wusste aber nicht, was er sagen sollte, und wollte auch nichts sagen. Sie schaute ihn unter ihrem schwarzen Regenschirm verdutzt an, grüßte aber nicht zurück. Wahrscheinlich hatte sie ihn nicht erkannt. Kein Wunder, er war lange nicht in seiner Heimatstadt gewesen.
Während er die Lotter Straße entlangschlenderte und der Regen ihm in den Kragen rann, fragte er sich, ob ihm seine Wirtin etwas vom Abendessen übriggelassen hatte. Ob sie an die Buttercremetorte gedacht hatte? Lieber wäre ihm ein Schokoladenkuchen, aber das hatte er sich nicht zu sagen getraut.