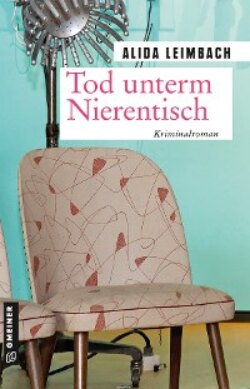Читать книгу Tod unterm Nierentisch - Alida Leimbach - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. Kapitel
ОглавлениеIn Hedwig Westermanns Wohnung brannte noch Licht. Die Witwe ging selten vor Mitternacht zu Bett, oft wartete sie noch auf ihn und freute sich über seine Gesellschaft und die Möglichkeit, vor dem Schlafengehen gemeinsam einen Eierlikör zu trinken. Kaum hatte er die Wohnungstür aufgeschlossen, stand sie schon im Flur, wie immer in ihrer schwarzen Witwentracht. Die dünnen weißen Haare hatte sie zu einem Kranz geflochten und um den Kopf gelegt. Ihre Augen lachten hinter den kleinen runden Brillengläsern.
»Endlich sind Sie da, Geburtstagskind, ich warte seit Stunden auf Sie! Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Inspektor Conradi!«
Sie führte ihn in die Küche. Auf dem gescheuerten Holztisch stand ein Gugelhupf mit vier Kerzen und sieben Pralinen. »Die Kerzen stehen für jedes Lebensjahrzehnt«, sagte sie und zündete sie an. »Die Pralinen für die Jahre dahinter. Dann passt das!«
Es duftete nach Kohlrouladen. Stundenlang musste sie das Essen auf dem Herd warmgehalten haben. Conradi lief das Wasser im Munde zusammen. Mit dem Handrücken fuhr er sich über die feuchten Augen und schüttelte immer wieder den Kopf. »Frau Westermann«, sagte er gerührt, »dass Sie daran gedacht haben!«
»Natürlich! Ihren Geburtstag habe ich in meinem Kalender notiert! Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich nicht auf Sie gewartet habe. So spät würde mir das Essen nicht bekommen. Nun setzen Sie sich aber fix hin, bevor die Kohlrouladen noch zerfallen.«
Er ließ sich auf dem knarzenden Holzstuhl nieder und sie bediente ihn. »Mussten Sie unbedingt vor dem Essen rauchen?« Angewidert rümpfte sie die Nase.
»Ich bekenne mich schuldig«, sagte er lachend und wischte sich verstohlen eine Träne weg. »Aber ich konnte nicht ahnen, was mich zu dieser späten Stunde erwartet.« Der Tisch war hübsch gedeckt, feines Porzellan, kristallgeschliffene Weingläser, gestärkte Stoffservietten, frische Nelken in einer Vase.
»Ich weiß ja, wie Ihnen heute zumute ist«, meinte sie und schenkte ihm Rotwein ein, wenn ihm auch Bier lieber gewesen wäre. »An solchen Tagen denkt man immer an die Menschen, die nicht mehr da sind. Das geht mir mit meinem Karl-Heinz auch so. Besonders schlimm ist es an Weihnachten. Da denke ich nicht nur an ihn, sondern auch an meine lieben Eltern. Ich träume davon, wie schön es doch wäre, wenn wir alle wieder in der guten Stube beieinandersäßen! Aber, Herr Conradi, das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Was sollen wir machen, jammern hilft nicht, wir müssen da durch. Vermissen Sie Ihre Frau und Ihr Kind denn immer noch so sehr oder geht es inzwischen?« Sie schaufelte eine Kohlroulade mit viel brauner Sauce und zwei handgerollte Knödel auf den Teller.
Conradi blickte auf die Knödel und lächelte. Ihre Frage ließ er unbeantwortet im Raum stehen. Er wollte mit ihr nicht über seine Gefühle sprechen, nicht an diesem Tag.
Nebenan hörte er jemanden niesen.
»Oh, Verzeihung, Herr Conradi, eine Sache habe ich glatt vergessen. Ich habe Ihnen gar nicht erzählt, dass lieber Besuch da ist.« Sie ging in den angrenzenden Raum. Als sie zurückkam, brachte sie eine junge Frau mit.
»Das ist Fräulein Hubschmied, meine Nichte«, sagte sie strahlend. »Sie ist ab heute Ihre Zimmernachbarin, wohnt direkt gegenüber. Machen Sie sich doch mal gegenseitig bekannt! Ich will Ihnen noch schnell ein Geheimnis verraten: Für Sie beide habe ich zum Nachtisch eine Buttercremetorte im Keller stehen!«
»Nein! Frau Westermann, ich muss doch sehr bitten«, sagte er mit einem Seitenblick auf die junge Frau, »Sie mästen mich! Schauen Sie mich mal an, mein Hemd spannt bereits!«
»Da haben Sie nicht ganz unrecht. Aber mein Karl-Heinz war auch gut gepolstert. Mir gefällt das! Da hat man was zum Anpacken, ich will doch nicht harte Rippen zu fassen kriegen! Na ja, inzwischen hat sich das erübrigt. Aber früher war ich kein Kind von Traurigkeit.«
Erst jetzt fiel ihm auf, dass er die junge Dame ungeniert angestarrt hatte. Wenn der erste Eindruck zählte, dann gefiel sie ihm nicht. Eine markante Hornbrille dominierte das schmale Gesicht. Ihre mittelblonden Haare hatte sie am Hinterkopf zusammengesteckt, was ihr ein strenges Aussehen verlieh. Ihre Kleidung war bieder, sah noch sehr nach 40er-Jahre aus. Sie trug einen fast knöchellangen Faltenrock, einen kurzärmligen Pullover mit Puffärmeln und altmodische Schuhe. Steif streckte sie ihm die Hand entgegen, und er stand auf, um sie mit einer knappen Verbeugung zu ergreifen. Ihre Haut war kalt und feucht.
»Pauline Hubschmied«, sagte sie kühl. »Sekretärin, aber derzeit leider arbeitslos.«
Conradi nickte höflich, kam um den Tisch herum, um ihr einen Stuhl zurechtzurücken. Dann nahm er seinen Platz wieder ein und räusperte sich nach einem kurzen Blickwechsel mit seiner Vermieterin.
»Sie freuen sich sicherlich, dass Sie nun etwas Gesellschaft haben, nicht wahr?« Die alte Dame füllte zwei weitere Gläser mit italienischem Wein. »Dann wollen wir mal auf Ihren Geburtstag anstoßen«, sagte sie feierlich und hob ihr Glas. »Zum Wohl, lieber Herr Conradi, auf Ihre Gesundheit!«
»Von mir auch«, sagte Pauline Hubschmied schüchtern. Sie prostete ihm zu.
Johann Conradi bedankte sich höflich, trank einen Schluck und nahm dann sein Besteck auf. Der Wein schmeckte süß, zu lieblich für seinen Geschmack.
»Sie haben schon gegessen?«, wandte er sich an die junge Frau.
»Vor mehr als drei Stunden«, meinte sie lächelnd. Aber von der Buttercremetorte würde ich noch ein Stück nehmen.«
»Gefällt Ihnen Ihr Zimmer?«, begann er schwerfällig die Konversation. Lieber hätte er seine Ruhe gehabt. Er war müde nach dem langen Tag und verspürte nicht die geringste Lust auf belanglose Gespräche.
»Ich bin froh, dass ich es habe. Meine Eltern leben nicht mehr. Ich habe eine Weile bei Verwandten in Hamburg gelebt, wollte aber lieber zurück nach Osnabrück. Zum Glück hat meine Tante noch ein Zimmer frei gehabt.«
»Meine Abstellkammer«, sagte Hedwig Westermann augenzwinkernd, »aber meine Nichte ist genügsam. Meine Koffer und die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck durften sogar drinbleiben.«
Johann Conradi suchte etwas in Pauline Hubschmieds Augen, etwas, das ihn fesselte, reizte, seine Neugier weckte, aber da war nichts. Sie wirkte zu bemüht und angestrengt, um locker mit ihm zu plaudern. Sie hatte nichts Interessantes zu erzählen und stellte ihm keine Fragen, die ihn unter Umständen angeregt hätten, von sich zu berichten. Er seinerseits war zu abgespannt nach den ersten Ermittlungen, die der neue Fall mit sich gebracht hatte.
Beim zweiten Glas Rotwein zeigte sie dann doch Interesse. Ihre Tante ging in den Keller, um die Torte zu holen.
»Sie sind Kommissar, habe ich gehört«, sagte Pauline. »Was macht ein Kommissar den ganzen Tag? Gibt es viele Verbrecher in Osnabrück?«
Er schmunzelte. »Wo gibt es die nicht?« Niemals redete er über einen Fall, das hatten sie ihm in der Polizeischule eingetrichtert.
»Als der Krieg vorbei war, dachte ich etwas naiv, wir wären endlich in Sicherheit«, sagte sie, »aber das war trügerisch, da ging es erst richtig los mit Plündereien, Wohnungseinbrüchen und so weiter. Wer von Bombenangriffen verschont geblieben war, wurde plötzlich Opfer von Straftaten. Es hört nicht auf. In den Köpfen vieler Menschen ist immer noch Krieg. Sie morden und rauben und tun sich gegenseitig Gewalt an. Und die Polizei sieht tatenlos zu! Die Mörder laufen frei herum, gehen ihrem Alltag nach und tun so, als hätten sie alles richtig gemacht.«
Conradi schwieg betroffen. Pauline hatte leider recht. Die Besatzer machten ihnen das Leben schwer, mischten sich in ihre Belange ein und wollten überall mitreden. Die Polizei war nicht mehr das, was sie mal gewesen war. Sie müsste sich von Grund auf neu strukturieren. So schnell würde sich nichts ändern. Und ausgerechnet heute hatte sich eine weitere Gewalttat ereignet. Er würde sich hüten, davon zu erzählen. Wenigstens war die Polizei wieder bewaffnet. Auch das war kurz nach dem Krieg verboten gewesen.
»In meinem Zimmer in Hamburg wurde ich nachts überfallen«, fuhr Pauline fort. »Ein maskierter Mann hat mir das Wenige genommen, was mir geblieben war. Er hätte mir sogar Schlimmeres angetan, wenn meine Nachbarin nicht wach geworden wäre. In Osnabrück soll es nicht viel besser aussehen. Wann hört das endlich auf?«
Johann Conradi faltete seine Serviette und legte sie ordentlich neben dem Teller ab. »Wir geben uns Mühe, glauben Sie mir bitte, Fräulein Hubschmied. Leider waren wir in den ersten Nachkriegsjahren unterrepräsentiert. Viele ehemalige Kollegen kommen jetzt erst aus der Gefangenschaft zurück oder sind noch nicht rehabilitiert. Auch war es so, dass der britische Sektor uns ins Heft diktieren wollte, wie wir uns zu strukturieren hatten. Es ging drunter und drüber, das muss ich zugeben. Wobei ich selbst erst seit wenigen Wochen zurück im Dienst bin. Wir sind guten Mutes. Wir werden uns neu sortieren und in naher Zukunft von den Besatzungsmächten emanzipieren. Eine Weile wird das leider noch dauern, bis es so weit ist. Aber dann wird Osnabrück wieder ein sicherer und guter Ort zum Leben sein. Das verspreche ich Ihnen!«
»Schön, dass Sie sich rehabilitieren konnten«, sagte sie und griff nach ihrem Weinglas. »War es schwer? Konnten Sie den Engländern beweisen, dass Sie eine weiße Weste haben?«
»Nun, ich konnte zumindest beweisen, dass ich kein Nazi war. Ich wollte mit denen nichts zu tun haben. Das war nie meine Welt.«
»Ich glaube Ihnen sogar«, sagte Pauline. Nach einer kleinen Pause fügte sie hinzu: »Ich würde Sie gerne einmal unter vier Augen sprechen.«
»Tun wir das nicht gerade?«
»Länger als im Moment. Wäre das möglich?«
»Gewiss«, sagte er unmotiviert. »Wir werden die Gelegenheit dazu sicher bald haben. Heute war ein anstrengender Tag, ich bin in Gedanken noch bei der Arbeit.« Er milderte seine kleine Abfuhr mit einem Zwinkern ab.
Hedwig Westermann kehrte zurück, schaufelte großzügig bemessene Tortenstücke auf Kuchenteller und stellte sie vor sie hin. »Lassen Sie es sich schmecken!«
Das taten sie, wobei Conradi ab der Hälfte mit der zuckrigen, buttrigen Masse zu kämpfen hatte.
Noch einmal stieß er mit Pauline Hubschmied an und sagte nicht sonderlich charmant, dass er bereits zwei Fräuleins sehe und gedenke, sich auf sein Zimmer zurückzuziehen.
*
Als die anderen Familienmitglieder längst ins Bett gegangen waren, saßen Bettine und ihre Mutter im Wohnzimmer bei einem Glas heißer Milch mit Honig beisammen. Das Licht war gedämpft und die Radiostation sendete ruhige Musik zur Nacht.
»Mutti, ich frage mich, ob es nicht Vater gewesen sein kann. Er muss Rolf doch gehasst haben! Stell dir mal vor, wie es dir gehen würde, wenn du nach langer Zeit nach Hause zurückkehrst, und dann ist da ein anderer Mann, nein, eine andere Frau bei deinem Mann, ich komme ganz durcheinander. Wie würde es dir da ergehen?«
Lieselotte schwieg und zupfte an ihren manikürten Fingernägeln. »Natürlich nicht gut«, sagte sie leise.
»Siehst du, und Vater ging es sicher ähnlich, als er das mit dir und Rolf erfahren hat! Kannst du dir vorstellen, wie groß seine Wut gewesen ist? Du hast seine Hoffnung zerstört und damit sein Leben!«
Lieselotte schluckte. Harte Linien traten in ihrem Gesicht hervor.
Bettine setzte sich aufrecht hin. »Was willst du eigentlich, Mutti? Möchtest du, dass Vater zurückkommt und wieder bei uns lebt?«
»Nein, auf keinen Fall. Das ist alles zu lange her. Ich habe mich richtig entwöhnt nach so langer Zeit, er ist mir fremd geworden.«
»Mir auch«, gab Bettine seufzend zu. »Ich habe ihn überhaupt nicht wiedererkannt, als er plötzlich im Laden stand. So hatte ich ihn nicht in Erinnerung. Er sah aus wie ein Bettler oder Hausierer. Ich wollte ihn nicht einmal bedienen, so abstoßend fand ich ihn!«
»Ja, so sehen Kriegsheimkehrer nun einmal aus. Sie haben jahrelang nicht genug zu essen bekommen und konnten Krankheiten nicht richtig auskurieren, das hinterlässt Spuren. Ein wöchentliches Vollbad war sicherlich auch nicht drin. Und was sie erlebt haben, an der Front und in der Gefangenschaft, darüber sprechen sie nicht. Es müssen grauenhafte Dinge gewesen sein. Deswegen wissen wir Frauen gar nicht, wie ihnen zumute ist und warum sie so merkwürdig geworden sind. Frau Huber und Frau Ritter erzählen das Gleiche von ihren Männern. Sie erkennen sie nicht wieder, vom Aussehen her nicht und auch nicht vom Wesen. Am liebsten würden sie sich scheiden lassen.«
Nachdenklich trank Bettine einen Schluck Milch und wischte sich anschließend den Mund ab. »Was meinst du, wird die Polizei ihn vernehmen?«
»Ich weiß es nicht. Es tut mir leid für ihn und ich habe Schuldgefühle ihm gegenüber. Lassen wir ihn am besten in Ruhe.«
Bettine warf fast ihr Glas um. »Wie meinst du das, was verstehst du unter Ruhe?«
»Wir müssen nicht unbedingt erwähnen, dass Otto wieder da ist, oder? Nur wir beide wissen davon und Oma. Aber ihr ist klar, wann sie den Mund zu halten hat. Die kennt sich aus mit Obrigkeiten.«
»Wenn du meinst …«
»Auch Karl brauchst du es nicht zu sagen, wer weiß, wie er damit umgeht. Nachher zieht es ihn zu Vater hin, die beiden hatten früher ein besonderes Verhältnis. Das will ich nicht. Auf keinen Fall. Und Karin und Peter kennen ihn nicht einmal. Für sie ist er ein Fremder. Ich will das alles nicht, es überfordert mich. Wäre er bloß nicht wiedergekommen!«
»Gut«, sagte Bettine, »machen wir es so, wie du willst.«
Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Der Wellensittich im Käfig schlief längst, und die Wanduhr schlug zur halben Stunde. »Komm, Kind«, sagte Lieselotte, »trink deine Milch aus und dann gehen wir in die Falle. Es ist weit nach Mitternacht durch, halb eins schon. Morgen steht uns ein anstrengender Tag bevor, ich muss Karl auf die Polizeiwache begleiten.«
Bettine rieb sich die Augen, stand auf und stellte das Radio aus.
*
Liebe Frederike,
meinen Geburtstag habe ich halbwegs überstanden. Nun ist er zum Glück vorbei, es ist halb eins in der Nacht, und er war nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Natürlich grummelt mein Magen von der Buttercremetorte, aber ich bin heimlich an Frau Westermanns Medizinschränkchen gegangen und habe etwas von ihren Hoffmannstropfen genommen.
Trotzdem geht es mir nicht gut. Du fehlst mir, Fredi, und wie du mir fehlst! Ich dachte, es würde irgendwann aufhören oder zumindest besser werden. Es heißt ja, die Zeit heile alle Wunden. Aber für mich ist das Gegenteil der Fall, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Ich fühle mich wie in zwei Teile zerbrochen, seit du aus meinem Leben verschwunden bist. Du warst für mich der wichtigste Mensch, mein Lebensmittelpunkt. Allein bei dir zu sein war genug, mehr brauchte ich nicht zum Glücklichsein. Ich fühlte mich wohl mit dir zusammen in der winzigen Küche, am warmen Ofen, vor dem wir gegessen und geplaudert haben.
Eine Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben, daran musste ich gerade heute wieder denken. Wir saßen unter der Petroleumlampe, weil der Strom ausgefallen war, und haben Krabben gepult, weißt du noch? Das heißt, ich habe dir gezeigt, wie es geht, denn du konntest nichts damit anfangen, wusstest nicht einmal, wie die Dinger schmecken und ob du sie magst. Und sie schmeckten dir himmlisch! So oft musste ich sie dir danach von Remme mitbringen, und bald konntest du sogar schneller pulen als ich.
Ich vermisse dich so, meine Zauberfrau. Als ich dich das erste Mal sah, wie du zwischen den Kaffeetischen im Schweizer Haus hin und her gingst, auf der Suche nach einer Freundin, mit der du verabredet warst, wusste ich sofort, dass ich dich eines Tages heiraten würde. All meinen Mut habe ich zusammengenommen und dich angesprochen, dir meine Karte gegeben. Eine Woche später hast du mir einen kurzen Brief geschrieben. Alles war gleich klar zwischen uns. Ein Leben ohne den anderen war fortan nicht mehr möglich.
Lilly war dann die Krönung für unser Glück. Sie hat uns mit ihrer Leichtigkeit und Fröhlichkeit angesteckt. Du ahnst nicht, wie sehr auch sie mir fehlt.
Als wir uns das letzte Mal sahen, warst du verzweifelt. Du brauchtest neue Schuhe für die Kleine, weil ihre Füße so schnell gewachsen waren. Es gab nirgendwo welche, es gab in den Geschäften überhaupt nichts mehr zu kaufen. In den Schaufenstern standen Pappschilder oder es fanden sich nur alte, gebrauchte Sachen zum Tauschen darin. Du hast schließlich Schuhe für Lilly gefunden, die ihr noch viel zu groß waren. Es ging nur mit drei Paar Socken übereinander. Dafür hast du schweren Herzens einen Ring und eine Brosche deiner Großmutter hergegeben. Wenn du wüsstest, wie voll die Geschäfte nun wieder sind, wie prächtig die Auslagen der Schaufenster, wie groß die Augen der Passanten, die davorstehen.
Du fehlst mir so, Fredi. Deine Güte und Milde fehlen mir, deine warmen Augen, dein sinnlicher Mund, deine Grübchen, wenn du lachst, deine weiche Haut, deine schönen Kurven, deine zärtlichen Hände.
Mit dem Gedanken daran schlafe ich nun ein, traurig und ein wenig getröstet zugleich. Dein dich liebender Johann