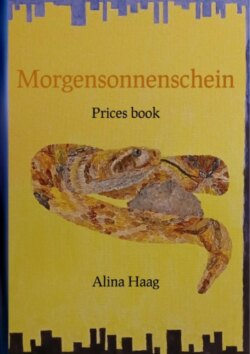Читать книгу Morgensonnenschein - Alina Haag - Страница 9
Kapitel 8
ОглавлениеFrüher hatten meine Schwester und ich, als wir noch nicht in der Schule waren, immer in der Nähe der Fabrik gespielt, in der meine Mutter tagsüber arbeitete. Dort hatten wir uns in einer Ecke eine Höhle gebaut, in der wir uns bei Regen aufhielten. Diese war auch nicht weit entfernt von der Schule und so war ich nach wenigen Minuten dort und setzte mich noch rechtzeitig in den kleinen Raum aus Holz und Wellpappe, bevor mich die Tränen übermannten. Wie konnte ich nur so dumm sein, wie konnte ich nur! Ich hatte, ohne es zu bemerken nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Familie aufs Spiel gesetzt. Warum hatte ich die Beherrschung verloren, warum nur? Hätte ich nicht darauf vorbereitet sein können, dass es auch Preisrichter aus niederen Schichten gab? Nun war alles aus, unser Glück zerstört. Ich gab mir vielleicht noch einen Tag, dann würden mich die Preisrichter holen, um mich zu einer von ihnen zu machen. Schließlich war es für den Preisrichter ein leichtes gewesen, meine Überraschung und anschließende Wut darauf zurückzuführen, dass ich des Zahlensehens mächtig war. So saß ich nun da, auf der festgetretenen Erde, zusammengekauert und tränenüberströmt. Ich hatte jedes Gefühl für Zeit verloren, bald verdunkelte sich der Himmel, dann begann es zu regnen. Dicke Tropfen drangen durch das löchrige Dach, fielen auf meine leichten Klamotten, die alsbald durchnässt waren und ließen mich frösteln und schließlich beschloss ich, dass es keinen Zweck hatte, es weiter hinauszuschieben. Ich musste meiner Mutter die Wahrheit erzählen, bevor es die Preisrichter tun würden. Ich stand auf, streckte meine steifen Glieder und machte mich durch den Regen auf den Weg nach Hause, eine dunkle Gestalt auf grauem Hintergrund.
Glücklicherweise war es noch nicht allzu spät, als ich mich unserem Haus näherte, vielleicht drei oder vier Uhr. Der Glockenturm war schon vor langer Zeit baufällig gewesen und so war es kein Wunder, das auch die darin eingebaute Uhr kurz darauf ihren letzten Schlag getan hatte, was aber nicht weiter schlimm war, da sich die meisten Leute eh mehr auf die Sonne, als auf ein von den Preisrichtern kontrolliertes Messgerät verließen. Zu Hause angekommen, befreite ich mich im engen Flur zuerst von den nassen, schlammigen Schuhen und der dünnen Jacke, bevor ich unsere Wohnung betrat. Wie erwartet war meine Mutter noch nicht zu Hause und nur meine Schwester saß an dem kleinen Holztisch in der Küche, ihre Schulsachen vor sich ausgebreitet; wir nutzten eben jede Minute aus, in der wir einmal Strom hatten. Als sie mich bemerkte, hob sie den Kopf und ich sah in ihren Augen Erleichterung. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen. Keine einzige Minute hatte ich daran gedacht, dass meine Schwester sich sicherlich Sorgen machen würde, wenn ich zum Schulende nicht am Schultor erscheinen würde, um mit ihr nach Hause zu laufen. Tausende Entschuldigungen rasten mir durch den Kopf. Ich hatte nacharbeiten müssen, ich war noch einkaufen gegangen… Doch keine dieser Ausreden schien der Wahrheit gerecht zu werden. Ich hatte mir vorgenommen mein Geheimnis zu offenbaren, mich der Wahrheit zu stellen. Warum sollte ich also nicht jetzt anfangen? Erschöpft setzte ich mich auf den Stuhl ihr gegenüber und begann mit matter Stimme zu sprechen. „Hi, wie war dein Tag?“
Sie hob abermals den Kopf, dieses Mal ein spöttisches Funkeln in den Augen. „Gut. Und wie war der Vortrag des Preisrichters? War er so schlecht, dass du danach gleich fliehen musstest?“, fügte sie sarkastisch hinzu.
Ich bewunderte meine Schwester immer wieder dafür, wie sie immer sofort ins Schwarze traf und ärgerte mich gleichzeitig darüber, dass ich nicht bedacht hatte, dass meine plötzliche Flucht in Verbindung mit der vorausgegangenen Rede des Preisrichters eine explosive Tratschmischung abgab, die dazu führte, dass die ganze Schule binnen weniger Minuten über meinen Abgang Bescheid wusste und dass meine Schwester zur ganzen Schule zählte.
„Nicht direkt“, beantwortete ich wage ihre letzte Frage, dann holte ich tief Luft. „Ich habe heute etwas sehr Dummes gemacht…“
„Das sehe ich auch so“, sagte eine Stimme hinter mir.
Erstaunt fuhr ich herum und sah meine Mutter im Türrahmen stehen, auf dem Gesicht eine Mischung aus Sorge und Wut. Meine Mutter war bei einer ihrer Kundinnen gewesen, als deren Tochter von der Schule nach Hause gekommen war und erzählt hatte, dass ich die letzte Stunde Kunst geschwänzt hatte. Für die Lehrer an unserer Schule war es normal, dass der ein oder andere gelegentlich Schulstunden schwänzte, doch meine Mutter war bei dieser Information hellhörig geworden, da es normalerweise so gar nicht meine Art war, einer Stunde fernzubleiben. Also hatte sie auf dem Nachhauseweg einen Abstecher zur Schule gemacht, um dann dort zu erfahren, dass wir in den nächsten Tagen mit Besuch zu rechnen hatten. Meine Mutter hatte eins und eins zusammengezählt und stand nun mit einem heißen Tee in der Hand an die Küchenzeile gelehnt da und erwartete von mir eine Erklärung. Aber wie sollte man bei so einer Sache anfangen? Schließlich beschloss ich der Vollständigkeit zuliebe mit dem Tag anzufangen, an dem ich meine Gabe entdeckt hatte. Ich war gerade einmal fünf gewesen, als ich zum ersten Mal einen Preis gesehen hatte. Damals waren wir ganz frisch in diese Wohnung eingezogen, die Wände waren noch weiß und ich die einzige Tochter meiner Mutter gewesen, da meine Schwester erst ein Jahr später dazugekommen war. So hatten wir also auch noch mehr Geld gehabt und meine Mutter hatte mir eines Tages am Markt ein kleines Amulett gekauft. Wenn man dieses öffnete, hatte man einen kleinen von grünen Ranken umgebenen in das Metall eingelassenen Spiegel gesehen, der gerade wegen seiner Größe ideal für mich gewesen war. Ganz aufgeregt hatte ich mich zu Hause auf einen Stuhl gesetzt und meinen Blick auf den Spiegel gerichtet. Ich hatte mein Spiegelbild betrachtet, die schmalen Lippen, die rosigen Wangen, die großen erwartungsvollen Augen mit den langen Wimpern. Als ich zu meiner Stirn gekommen war, hatte ich dann aber etwas gesehen, was dorthin eigentlich nicht gehörte, nämlich eine grünflammende Zahl, die Zahl 222. Damals hatte ich mich sehr erschrocken und fortan Spiegel gemieden, doch als ich in die Schule gekommen war, hatte ich die Preisrichter durchgenommen, meine mit ihren Fähigkeiten verglichen und war zu dem Schluss gekommen, dass ich wohl selbst eine Preisrichterin war. Glücklicherweise war ich damals schon klug genug gewesen, mein Geheimnis für mich zu behalten und hatte stattdessen begonnen, mehr über meine Begabung zu erfahren. Ich fand heraus, dass die meisten Preisrichter zuerst ihren eigenen Preis sahen und dass sie sich selber als Preisrichter melden mussten und nicht anhand ihres Preises als ein solcher erkannt werden konnten und versuchte, dieselben flammenden Zahlen im Stirnbereich anderer Menschen zu sehen, was nach viel Übung auch mit ersten Erfolgen gekrönt wurde.
Meine Mutter und meine Schwester lauschten stumm meinem Bericht und für lange Zeit war meine Stimme das einzige, was im Raum zu hören war. Als ich geendet hatte, trat eine undurchdringliche Stille ein und mein Magen zog sich vor Aufregung über die Reaktionen meiner Familie zusammen. Nach einer halben Ewigkeit regte sich meine Mutter schließlich. Sie richtete ihren Blick auf einen Punkt irgendwo hinter mir und sagte mit ausdrucksloser Stimme: „Jemand muss Leo von den Nachbarn holen.“
Ohne auf eine Reaktion von Dora zu warten, verließ ich den Raum. Draußen angekommen lehnte ich meinen Kopf an die dreckige Wand des Ganges. Ich war auf alles gefasst gewesen, Wut, Geschrei, nur nicht auf dieses stumme Entsetzen, diesen leeren Blick in den Augen meiner Mutter, der mir ein schwarzes Loch in den Bauch riss. Mein Kopf schwirrte, schwarze Pünktchen tanzten vor meinen Augen und ich sackte restlos zusammen. Nur einmal zuvor hatte ich diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen, damals, als sie mir von meinem Vater und meinem Bruder erzählt hatte. Doch diese abgeschwächte Form war Nichts gegenüber dem Heutigen gewesen. Nach ein paar Minuten riss ich mich zusammen, setzte ein Lächeln, das wohl etwas schief aussah, auf und klopfte an der hellblauen Tür der Nachbarn. Dort empfing mich Frau Son, eine kleine rundliche Frau mittleren Alters. Sie erwiderte mein Lachen und bat mich zu sich herein. Frau Son war Mutter zweier Kinder, einem vierjährigen Mädchen und einem zweijährigen Jungen. Ihr Mann arbeitete in einer Fabrik für Straßenbahnteile am anderen Ende von Limestone und war selten zu Hause anzutreffen, da er frühmorgens das Haus verließ und erst spät am Abend heimkehrte. Meine Mutter brachte Leo an Tagen, an denen sie Hausbesuche machte, zu ihr, für eine kleine Summe Betreuungsgeld, und holte ihn gegen Nachtmittag wieder ab. Unsere Nachbarin lebte von solch kleinen Gefallen, die sie der ganzen Nachbarschaft gab, da sie selbst nicht Arbeiten ging, aber bei dem kleinen Einkommen ihres Mannes mitverdienen musste. So lag Leo vergnügt in einem Bettchen, umringt von mehreren kleinen Kindern, die abwechselnd die Rassel schüttelten, was ihnen ein freudiges Glucksen entlockte und Leo zum Lachen brachte. Frau Son bot mir einen Tee an, den ich dankend annahm und wir saßen einige Zeit einfach nur da und betrachteten die glücklichen Kinder. Ich war froh, dass unsere Nachbarin nie allzu redselig war und wusste, wann andere Leute ihre Ruhe brauchten. Denn dieser kleine Abschnitt des Tages war meine einzige kurze Atempause, da es mir beim Kindergelächter leichter fiel, die düsteren Gedanken in eine Ecke zu schieben und mein Inneres mit der goldenen Farbe des Glücks zu bemalen, die nach dem Besuch wieder abblättern würde. So wurde ich, als ich mit dem schlafenden Leo auf dem Arm im Gang stand, wieder von Empfindungen und Ängsten durchflutet und eine Frage, die Frage aller Fragen, schob sich in den Vordergrund: Wann würden die Preisrichter kommen, um mich zu holen?