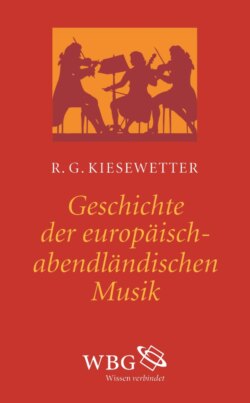Читать книгу Geschichte der europäisch-abendländischen Musik - Andreas Kiesewetter - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Periode:
ОглавлениеVon dem ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung bis gegen Ende des IX. Jahrhunderts.
Es ist eine vorgefassle, eben so allgemein verbreitete als tief eingewurzelte Meinung, dass unsere heutige Musik aus jener der alten Griechen ausgebildet, dass sie eben nur die Fortsetzung derselben sei; wie denn auch die Schriftsteller bis auf unsere Zeit gewöhnlich von dem „Wiederaufleben“ der (alten) Musik im Mittelalter sprechen. Nun gab es zwar eine Zeit, in welcher die christliche Musik des europäischen Occidents sich bei jener Raths erholte; und lange — sehr lange — wurden die Aussprüche der griechischen Schriftsteller als die Quelle aller musikalischen Theorie angesehen: Die Wahrheit aber ist, dass die neue Musik nur in dem Maasse gedieh, als sie sich von den ihr aufgedrungenen griechischen Systemen zu entfernen anfing; und dass sie einen bedeutenden Grad von Vollkommenheit erst damals erreichte, als es ihr gelang, sich auch noch der letzten Ueberbleibsel (wirklicher oder conventionell dafür gehaltener) altgriechischer Musik vollends zu entledigen. Mit dieser hatte sie schon sehr lange, ich möchte sagen von jeher, kaum mehr als das Substrat — Ton und Klang — gemein. Aus der altgriechischen Musik wäre, wenn Alt-Hellas ungestört noch durch zwei Jahrtausende fort geblüht hätte, eine Musik, der unsrigen ähnlich, nimmermehr hervorgegangen: in den Systemen, in welchen sie dort durch die Autorität seiner Weltweisen, durch das Herkommen, ja selbst durch bürgerliche Gesetze, im eigentlichen Sinne fest gebannt war, lag das unübersteigliche Hinderniss ihres Wachsthumes*). Sollte die schöne Kunst der Töne sich dereinst noch zu jener Vollkommenheit entfalten, deren Keim wohl überall in ihr lag, so musste sie dort untergehen, und anderwärts, ein andres Wesen, neu geboren werden. Die altgriechische Tonkunst starb in ihrer Kindheit; ein liebenswürdiges Kind, aber schon prädestinirt nie zur Reife zu gelangen. Für die Menschheit war ihr Untergang kein Verlust.
Die neue Musik, wenn man sie in ihrem Ursprunge schon so nennen will, war, noch in der Periode des bereits merklich eingerissenen Verfalles der griechischen, unbeachtet, in niedern Hütten, ja in verborgenen Höhlen, entstanden: es gestaltete sich in den Versammlungen der ersten Christen — meist armer, ungelehrter, in den sublimen Kenntnissen griechischer Musik schon zumal gar nicht eingeweihter schlichter Leute — ein höchst einfacher, kunst- und regelloser Naturgesang, welcher nur allmählig gewisse Accente oder Inflexionen bleibend annahm, in dieser Gestalt durch öfteres Anhören sich in den Gemeinden feststellte, und von deren einer zur andern sich fortpflanzte. Dass sich noch damals griechische, oder auch wohl jüdische Melodien, unter den Christengemeinden eingeschlichen hätten (wie einige Schriftsteller angenommen haben), ist durchaus nicht glaublich: wären auch jene guten Leute fähig gewesen, griechische Melodien zu fassen, und mit ihren wenig geübten Organen nachzusingen, so war ihr Abscheu gegen Alles, was an Heidenthum erinnern konnte, nach dem Zeugnisse der ältesten Schriftsteller, zu gross, als dass sie Gesänge aus den Tempeln oder Theatern der Heiden zugelassen hätten; eben so wollten sie von dem Judenthume sich durchaus sondern (ne videantur judaizare, wie ein alter christlicher Schriftsteller es ausdrückt); und überhaupt war es ihnen ganz eigentlich darum zu thun, eine von den Weisen jedes andern Cultus verschiedene, ihnen eigene Art des Gesanges zu stiften; was ihnen auf ihrem Wege vielleicht nur zu gut gelungen seyn mochte.
Wie dieser neue Gesang der Christen immer beschaffen gewesen sein mag, so ist es begreiflich, dass bei gänzlichem Mangel einer Regel in demselben, in dem Maasse, als die Gemeinden zahlreicher wurden, die so sehr erwünschte Gleichheit und Uebereinstimmung in den Weisen zu erlangen, immer schwerer, und endlich unmöglich werden musste.
Im IV. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, als schon Tempel, Sprengel und Oberhirten entstanden waren, und Männer von wissenschaftlicher Bildung das Christenthum angenommen hatten, unternahmen es daher einige fromme und gelehrte Bischöfe, im Orient und im Occident, den Gesang zu ordnen, und in gewissen Modulationen festzustellen. Diess konnte nun nur mittelst einer geregelten Tonleiter, und mittelst gewisser Formeln bewerkstelligt werden, durch welche die Stelle, wo der Fortschritt in der Stufenleiter mit einem halben Tone einzutreten hätte, bestimmt werden musste. Es entstand nun erst das Bedürfniss eines Systemes. Nichts natürlicher, als dass man jetzt in dem Nachlasse der griechischen, damals bekannten musikalischen Schriftsteller, der Grammatik einer schon damals todten Sprache, Rath suchte. Nun fand man dort eine allerdings sehr scharfsinnige, aber auch sehr verwickelte immense Theorie, davon der bei weitem grösste Theil für den vorliegenden Zweck überflüssig, ja nur störend gewesen wäre. Ihr chromatisches und enharmonisches Klanggeschlecht schon zumal, mit Fortschreitungen, die das geübte Ohr kaum am Monochord erkennt, das Stimmorgan aber mit aller Uebung nicht vernehmlich angeben kann, mussten ohne weiteres aufgegeben werden; mit ihrer Semeiographie, d. i. mit der Unzahl ihrer Tonzeichen, hielt man gar nicht für rathsam sich einzulassen: ihre 15 Tonarten, nach unsern Begriffen nur eben so viel Transpositionen einer und derselben Tonleiter, waren vollkommen überflüssig, wo es sich nur um den Typus für die Eine handelte, deren Wesen durch höhere oder tiefere Intonation sich ja gar nicht änderte; — ihre musikalische Rechenkunst (Canonik) konnte höchstens dem Lehrer und Theoretiker nützen, für die Praxis war sie ein Unding; ihre Rhythmopöe und Melopöe, die interessantesten Theile ihrer gesammten Theorie, wollten sich auf die bereits ziemlich ausgearteten alten Sprachen, und auf die Prosa, welche gesungen werden sollte, gar nicht mehr anwenden lassen. Dahingegen fand man dort eine gut genug geregelte Tonleiter des diatonischen Klanggeschlechtes, welche von einem mit musikalischem Sinne leidlich begabten Menschen leicht begriffen, und von einem nur etwas bildungsfähigen Stimmorgane ohne besondere Schwierigkeit ausgeübt werden mochte; man fand dort ferner eine (ob zwar mehr conventionelle, als in der Natur begründete) Abtheilung der diatonischen Leiter in Tetrachorde, welche, in ihrer Fortsetzung über einander gestellt, die gesuchte Tonleiter, und zwar eine Tonleiter von zwei Octaven bildeten, in welcher jede Tonstufe ihren zwar zeilenlangen, daher beschwerlichen, doch bestimmt bezeichnenden Namen hatte; — man fand endlich bestimmte Tonreihen, welche bald als sogenannte Tonarten (Modi), bald als Octavengattungen (species diapason) einer Tonart, unterschieden wurden. Von diesen Dingen liess sich Einiges recht füglich zur Regelung eines so einfachen Gesanges, als es jener der christlichen Kirche werden sollte, in Anwendung bringen.
Wie von da an die Kirchen im Orient in dieser Periode ihren Gesang eingerichtet haben mochten, hat uns die Geschichte nicht aufgeklärt; wohl aber sagt sie uns, dass gegen Ende des IV. Jahrhunderts (374 bis 397) S. Ambrosius, Bischof zu Mailand, einen Typus der Kirchengesänge eingeführt habe, indem er vier diatonische Tonreihen auswählte, welche von ihm, mit Beseitigung der auch ohnehin unpassenden altheidnischen Namen (dorisch, phrygisch, lydisch, äolisch, jonisch u. dergl.) die Namen des ersten, zweiten, dritten und vierten Tones erhielten, und sich nur eben durch den Ort der Halbtöne in der Stufenreihe unterschieden. Es sollen dies folgende gewesen sein:
Mögen diese Tonreihen als entlehnt aus der Theorie der alten Griechen angesehen werden, der lebende Hauch altgriechischer (oder römisch-griechischer) Musik konnte in die Gesänge der Christen nicht mehr übergehen; sie war bereits verhallt, oder nur in ausgearteten und in Verachtung gesunkenen Ueberbleibseln noch vorhanden.
Sanet Gregor der Grosse, welcher in den Jahren 591 bis 604 die christliche Kirche regierte, widmete dem Kirchengesange seine besondere Obsorge, und ward in mehr als einer Beziehung der Reformator desselben; er sammelte die vorhandenen Weisen, verbesserte dieselben, vermehrte sie mit vielen neuen, und gab die Sammlung mit ihren Singweisen als unabweichliche Vorschrift für alle christliche Kirchen heraus. Sein Antiphonar wurde vor dem Altare S. Peters, an einer Kette befestiget, niedergelegt, um etwaige Abweichungen in der Zeitfolge nach demselben zu berichtigen. Er gründete nicht nur ein neues System der Tonarten, sondern in der That ein neues System der Tonleitern, neue Benennungen der Töne, und eine neue vereinfachte Tonschrift.
Er behielt nämlich die bereits vorgefundenen (Ambrosianischen) vier Kirchentöne bei, fügte aber diesen vier andere hinzu, welche aus jenen, durch Versetzung der Tonreihe in die Unterquarte hervorgingen; wobei also der Hauptton, welcher dort als der erste erschien, in die Mitte, und eigentlich als der vierte in der Reihe zu stehen kam; die hinzugekommenen vier Kirchentöne wurden die plagalischen genannt, zum Unterschiede von jenen älteren vier, welche den Namen der authentischen erhielten. Somit wurde nun auch deren Ordnung verrückt. Folgendes sind die acht Kirchentöne, welche, als solche, in dem liturgischen Gesange der römischen Kirche, den man von seinem Stifter den Gregorianischen nennt, noch fortleben:
Man bemerkt gleich, dass diese Kirchentöne oder sogenannten Tonarten sich zuerst durch die Stelle des Halbtones unterscheiden; dann durch die Stelle, welche der Hauptton, oder eigentlich die beiden Haupttöne, nämlich der Grundton der authentischen Reihe, und dessen Quinte (später Dominante benannt) einnehmen; die Uebereinstimmung aber, welche dabei zwischen der authentischen und der ihr verwandten plagalischen obwaltet, besteht darin, dass beide (mit Rücksicht auf die Lage der in ihnen enthaltenen Halbtöne) aus einerlei Gattung von Quarten und Quinten zusammengestellt sind; jedoch so, dass, wenn die eine die Quinte in dem untern Theile, die Quarte in dem obern hatte, die andere (plagalische) die Quarte in dem untern, die Quinte in dem obern Theile erhielt.
Wie diese Kirchentöne in der Zeitfolge (seit Glarean, im XVI. Jahrhunderte) zu den in jeder Hinsicht unpassenden Namen der dorischen, phrygischen, lydischen und mixolydischen gekommen seien, wird an einem andern Orte erklärt werden.
Eine wichtige Verbesserung S. Gregors bestand darin, dass er das unpractische System der Tetrachorde der altgriechischen Musik aufgab, und dagegen jenes der Octaven zum Grunde legte; das einzige, das die Natur andeutet, das die griechischen Scholastiker zwar auch kannten, aber sonderbarer Weise missachteten.
Eine eben so wichtige Verbesserung S. Gregors, im Zusammenhange mit seinem Systeme der Octave, war ferner die Einführung einer höchst vereinfachten Benennung der sieben Töne der Octave, nämlich vermittelst der sieben ersten Buchstaben des lateinischen Alphabetes:
Diese sieben Buchstaben setzte S. Gregor an die Stelle der unglaublich schwerfälligen Benennungen der altgriechischen Tonreihe, oder an die Stelle jener 17 oder 18 Buchstaben, welche Boethius, der lateinische Commentator der mittlerweile verlornen altgriechischen musikalischen Theoretiker (römischer Consul, enthauptet zu Pavia im Jahre 524), nicht in der Absicht, eine neue Tonbenennung einzuführen, sondern um seine Feder und des Lesers Lunge zu schonen, im Texte seines Werkes, statt der altgriechischen Namen und Zeichen, sich erlaubt hatte. (Die Idee S. Gregors war demnach allerdings eine ganz andere und durchaus neue.)
Was die Tonschrift S. Gregors betrifft, so war bisher die Meinung allgemein, dass er hiefür dieselben sieben Buchstaben eingeführt habe. Gewiss konnten sie recht füglich dazu dienen, und es ist glaublich, dass sie in den Singschulen — bei Erklärung des Tonsystems ein notwendiges Vehikel — auch als Tonschrift gebraucht wurden: ich habe aber in einer eigenen Abhandlung (Ueber die Tonschrift P. Greg. M. in der Leipz. musikal. Zeitung v. J. 1828 Nr. 25, 26, 27.) angezeigt, dass noch nirgend ein mit den Buchstaben notirter Codex der römischen Liturgie aufgefunden worden; dass kein alter Schriftsteller von der Einführung jener Buchstaben als Tonschrift etwas ausgesagt; dass hingegen das älteste, bis jetzt irgend woher beigebrachte Monument notirten lateinischen Kirchengesanges, nämlich das zu S. Gallen verwahrte, dem Gregorianischen Musterexemplare vor dem Altare S. Peters nachgebildete Antiphonar, ein Exemplar, welches einer der von P. Hadrian I. an Kaiser Carl den Gr. gesendeten römischen Sänger (um das Jahr 780) dahin gebracht hatte, mit den sogenannten Neumen notirt ist, jener von den Annalisten sogenannten nota romana, welche, so weit man sich bisher umgesehen, die einzige in der römischen Kirche eingeführte Tonschrift, und mit geringen Aenderungen bis in das XIV. Jahrhundert in den liturgischen Büchern üblich war; daher man annehmen dürfe, dass schon S. Gregor auch diese Schrift eingeführt oder doch autorisirt haben müsse*).
Wenn zwar S. Gregors Kirchentöne, um auch uns für Tonarten zu gelten, den Mangel haben, dass, in mehreren derselben, der Hauptton des Subsemitoniums entbehrt, welches uns zur Anerkennung einer Tonreihe als einer Tonart unentbehrlich dünkt; so haben doch, wenn ich sie richtig erkläre, jene Tonreihen schon etwas von dem Charakter wirklicher (neuer) Tonarten, oder doch den Keim von solchen, in sich, insofern in jedem dieser Kirchentöne nicht nur ein herrschender Hauptton deutlich hervortritt, sondern auch die verwandten Tonstufen bezeichnet sind, in welche der Gesang in den Einschnitten übergehen konnte oder übergehen musste, und welche mit unsern Dominanten und Medianten übereinkommen. Als daher in der Zeitfolge der Gesang in mehreren Stimmen, oder der sogenannte Contrapunkt in die Kirche aufgenommen, und auf jene Weisen angewendet wurde, wodurch Sänger und Tonsetzer nothwendig dahin vermocht wurden, den Tonarten, als solchen, durch die Subsemitonien ihr Recht anzuthun; so konnte es nicht fehlen, dass aus dem 1. und 2. Tone unser D moll, aus dem 3. und 4. unser A moll (später auch wohl E moll), aus dem 5. und 6. durch Verminderung des h in b (wegen Vermeidung des unharmonischen Tritons F zu H), unser F dur, aus dem 7. und 8. unser G dur, ferner, in Folge der früh eingeführten Transpositionen der Kirchentöne in deren Quarte oder Quinte, unser C dur, G moll, A moll, endlich durch die Fingirung anderer Haupttöne, nämlich durch Intonation von jeder möglichen Tonstufe in der Leiter, unsere heutigen 12 Dur- und 12 Molltonleitern herauswachsen mussten.
Alles dies aber ist und war schon im Ursprunge mehr, als die in ihre Systeme eingezwängten Griechen jemals kannten oder nur ahneten. Fürwahr, S. Gregor und die Gehilfen, deren er sich zur Entwicklung eines neuen Systemes bediente, mussten tiefere Blicke in das Wesen einer wirklich practischen Musik gethan haben, als je vor ihnen geschehen war; und es gereicht ihnen zum grössten Ruhme, dass sie sich selbst durch ihren gelehrten Vorgänger Boethius nicht auf jene Abwege und zu jenen Irrthümern verleiten liessen, welche, in der Folgezeit erneuert, dem Gedeihen unserer Musik so lange hinderlich geworden sind. Das System S. Gregors, in seiner Einfachheit dem Anscheine nach nicht so sinnreich, als die idealen Theorien der griechischen Scholastiker, war ohne Vergleich vernünftiger und praktisch tüchtiger, als diese. Sein System der in der fortgesetzten Tonreihe von 7 zu 7 diatonischen Stufen verjüngt wiederkehrenden Töne, nämlich das System der Octaven, muss jeder Unbefangene für folgerechter erkennen, als jenes der altgriechischen Tetrachorde**), und seine 7 Buchstaben zur Benennung der Töne für zweckmässiger, als jenen wunderlich zusammengesetzten Wortschwall, mit welchem jeder der 18 Töne der griechischen Tonreihe, ohne Rücksicht auf die Verwandtschaft und vielmehr Identität der Octaven bezeichnet wurde; —auch seine Tonschrift, die Nota romana, jene Neumen, welche, wenn gleich vor Einführung der (später dabei angebrachten) Linien, noch sehr unvollkommen, doch schon ein Bild des Steigens oder Fallens der Stimme in der Seele des Beschauenden anregten, war immer viel inniger, als jene Unzahl durchaus nur willkürlicher Zeichen, jene geraden, gestürzten, schief gelegten, verstümmelten oder missgebildeten Buchstaben der altgriechischen Semeiographie.
Das von S. Gregor hinterlassene System war jeder höheren Ausbildung fähig, und es hätte, unter nur einiger Maassen günstigen Verhältnissen, aus demselben eine vollkommene Musik, gleich unserer heutigen, unmittelbar abgeleitet werden können. Doch so gut sollte es der Menschheit vorerst noch nicht werden: die Unbilden der nachgefolgten Zeit brachten S. Gregors gutes System bald in Verfall und in Vergessenheit, seine Gesänge selbst, nur durch Ueberlieferung nach Gehör und Gedächtniss fortgepflanzt, waren in Gefahr, völlig auszuarten und verloren zu gehen. Diesem Uebel zu steuern, nahmen sich einige gelehrte und eifrige Geistliche der nun verwaisten Kirchenmusik an, und suchten sie durch eine, wenn auch nur nothdürftige, wissenschaftliche Begründung vor gänzlichem Verfalle zu bewahren. So löblich dies Bestreben war, so sehr ist es zu bedauern, dass sie — anstatt den leicht wieder aufzufindenden, noch nicht völlig verödeten Pfad zu verfolgen, den S. Gregor ihnen vorgezeichnet hatte — jenen verhängnissvollen Boethius mit seinen griechischen Systemen wieder hervorholten, um so gut, oder so übel es gehen wollte, auf Gregorianischen Kirchengesang jene unpassenden Systeme zu übertragen. Einige derselben versuchten, mit schlechtem Erfolge, glücklicher Weise aber auch ohne Nachahmer zu gewinnen, sogar neue, zum Theil absurde Tonschriften, mit gänzlicher Ignorirung der vortrefflichen Gregorianischen Buchstaben, sogar ohne Rücksicht für die durch die Kirche geheiligten, einer bedeutenden Verbesserung sehr wohl fähigen Neumen, (Hucbaldus, Hermannus Contractus*). Unter eines Guido von Arezzo Autorität wurde später, an die Stelle des in der letzten leidigen Zeit erneuerten Tetrachordes, sogar ein sein sollendes Hexachord eingeführt, das, sonderbar genug, die allezeit fertigen Commentatoren, aus purem Respecte für Guido, nun auch aus ihrem Boethius, als gegeben heraus zu demonstriren wussten **).
Es sollte noch übler kommen: die seit Jahrhunderten vergrabenen und für verloren geachteten Tractate der griechischen Autoren über Musik waren wieder aufgefunden worden, wurden nun übersetzt und vielfältig commentirt. Es war in der eben eingetretenen Periode des Wiederauflebens der Künste und der Wissenschaften in Europa, wo man allerdings viel den Griechen zu danken hatte, und noch mehr danken zu müssen glaubte, eine natürliche Folge der ungemessenen Vorliebe und Verehrung für alles Altgriechische, dass man jetzt auch alle musikalische Kunst und Wissenschaft nur bei den Griechen suchte, und es war vielleicht nicht blos die gelehrte Sucht, sondern wirklich der Wille, das Menschengeschlecht zu beglücken, dass hundert wackere Gelehrte, und unzählige ihnen nachbetende Musiker, sich abmühten, die alte griechische Musik (nach ihrer Meinung) in den christlichen Tempeln, und, wo möglich, auch bald in Theatern, wieder aufleben zu machen. Indess kamen sie bei den widerstrebenden Elementen der christlichen Kirchenmusik, auf welche sie jene zu impfen meinten, damit immer nicht zu Stande, und es hatte ihr Bemühen keinen andern Erfolg, als, dass dadurch der Fortgang der in der Periode eines P. Gregors in ein so gutes Gleis eingeleiteten neuen Musik um Jahrhunderte verzögert wurde.
Wenn solchergestalt das Zeitalter an einer Musik laborirte, welche nicht durchaus mehr die neue, aber eben so wenig die vermeinte altgriechische war, so ward dagegen die abweichende Richtung der sich mächtig durcharbeitenden europäisch-occidentalischen Musik (wie ich sie nennen muss) von jener aller alten Völker erst dann recht bedeutend, als in ihr die Harmonie, oder der sogenannte Contrapunkt, d. i. Gesang mehrer, zugleich in verschiedenen Intervallen tönender Stimmen, eingeführt wurde; obgleich eben von da an das hindernde Element der ihr aufgedrungenen griechischen Theorie am meisten fühlbar ward.
Diese von uns so genannte Harmonie (denn bei den Griechen war das Wort Harmonie mit Melodie dem Sinne nach ungefähr gleichbedeutend*), ist ganz und allein unserer Musik eigen. Sie ist in dieser so wesentlich geworden, dass wir, unter Harmonien aufgewachsen, uns eine Musik ohne sie als etwas höchst Armseliges vorstellen, ja deren Mangel kaum begreifen können. Und doch war sie (in unserm Sinne) weder den alten Völkern bekannt, noch findet man sie bis heute bei den seit Jahrtausenden civilisirten, im Besitze recht sinnreich (nach ihrer Weise) ausgebildeter musikalischer Theorien befindlichen, und ihre Musik leidenschaftlich liebenden Völkern Asiens. Die alten Griechen kannten allerdings die Symphonie der Quarte, der Quinte und der Oktave; ob sie die Harmonie in unserm Sinne kannten, ist unter den Gelehrten noch nicht völlig entschieden; Ueberbleibsel, welche davon die Ueberzeugung gäben, haben sich nicht vorgefunden, und nur einige Stellen in den hinterbliebenen Schriften derselben können zur Noth dahin gedeutet werden. Bei den heutigen Griechen, unter welchen so etwas wie Harmonie — wenn die Altvordern sie getrieben hätten — sich durch Tradition, wenn auch entstellt, in irgend einer Gestalt erhalten haben könnte, ist von ihr keine einheimische Spur zu finden; sie singen und musiciren durchaus nur eintönig, und begleiten den Gesang, selbst auf Harfen, oder andern ähnlichen Instrumenten, welche mit beiden Händen gespielt werden, nie anders als im Unison und in Octaven.
Der Gebrauch der Harmonie in unsrer europäischen neueren Musik führte in dieser nothwendig ein wesentlich geändertes System der Tonarten und der Tonleitern herbei. Mit Rücksicht auf die neuen Tonarten und Tonleitern gewann die Melodie eine Bestimmtheit, und zugleich durch die harmonische Begleitung eine Mannichfaltigkeit der Bedeutung, deren der einfache Gesang an und für sich immer ermangelt haben musste. Der besonders in der Schule des obligaten Contrapunktes vollends ausgebildeten Harmonie danken endlich die Instrumente, der Stolz und die Zierde unsrer Musik, theils ihre Entstehung, theils ihre Vervollkommnung und letzte Veredlung.
Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, beginnt die Geschichte unsrer Musik in der That erst mit jener Epoche, in welcher die ersten Spuren von Versuchen im Gebrauche der Symphonien (Consonanzen, Diaphonien oder Polyphonien) entdeckt werden; dahingegen der einfache Kirchengesang der früheren Jahrhunderte höchstens als die Vorschule betrachtet werden kann, und jedenfalls eine eigene Periode bildet.
Leider waren aber die ersten Versuche, Consonanzen zu verbinden, verfehlte Versuche, indem man, den gesetzgebenden griechischen Scholastikern mehr als dem guten Gehöre folgend, nur die Quarte, Quinte und Octave als Consonanzen anzusehen sich unterstand, die von jenen als Dissonanzen verschrienen Terzen und Sexten aber noch für harmonisch unbrauchbar hielt. Jahrhunderte verflossen wieder, bis der rechte Weg gefunden ward, — bis die Accorde, welche, nicht nur einzeln, sondern auch im Zusammenhange der folgenden, eine angenehme Wirkung erzeugen, ausgemittelt waren, bis man es wagte, — wirkliche Dissonanzen mit guter Wirkung einzumengen, indem man das Mittel ausfindig machte, das durch die Dissonanz beunruhigte Gemüth durch deren Auflösung zu befriedigen, endlich selbst die herberen Dissonanzen durch Vorbereitung dem Gehöre empfänglich, bei erfolgender Auflösung sogar angenehm zu machen. Von dieser Seite betrachtet, reicht unsre harmonische Musik kaum über das XIII. Jahrhundert zurück, und ist also eine erstaunlich junge Kunst. Erwägen wir aber, dass diese durchaus neue, früher noch nirgends geahnte Kunst der Vorbilder entbehrte, deren die Schwesterkünste, theils in der lebenden Natur, theils in den überlieferten Werken des Alterthums (Classikern, Antiken, Gebäuden und Monumenten) sich zu erfreuen hatten; dass sie sich, unter immerfort störenden Einwirkungen, ganz und allein aus sich selbst herausbilden musste; so müssen wir, anstatt deren anscheinend langsames Fortschreiten in ihren ersten Epochen zu beklagen, uns vielmehr wundern über den schnellen Aufschwung, den sie nahm, als es ihr gelungen war, sich von ihren hellenisirenden Hofmeistern zu emancipiren, und sie nun, der eigenen Kräfte sich bewusst, Werke zu schaffen begann, zur Bewunderung der Zeitgenossen und zum Schrecken der Scholastiker, welche sich bald entschliessen mussten, neue Theoreme in den Produkten ihrer vermeinten Zöglinge aufzusuchen, und, so gut es gehen mochte, in ihre noch immer griechisch sein sollende Doctrin einzufügen.
Die Schriftsteller, welche die Geschichte der Musik behandelt haben, haben dieselbe gewöhnlich nach weltgeschichtlichen Perioden, oder nach den Regierungsperioden der Könige des Heimathlandes, auch nach Ländern und Provinzen, und zum Theil nach sogenannten Schulen abgetheilt. Ich bin der Meinung, dass die Kunst in ihren Schicksalen sich selbst ihre eigenen Geschichtperioden bildet, welche in der Regel mit jenen der allgemeinen Welt- und der besonderen Staatengeschichten nicht zusammen treffen, auch mit diesen in der That nichts gemein haben; dass die Kunst, ein Gemeingut der Menschheit, auch mit der politischen Eintheilung der Reiche nicht zusammenhängt, und dass die Eintheilung nach Kunstschulen (in jenen Perioden nämlich, wo von solchen nur überhaupt eine Rede sein kann) in der Geschichte der Musik die unbrauchbarste und trügerischeste von allen ist, weil die Gränzen der (wirklichen oder vorgeblichen) Schulen nach Zeit und Ort, ja zum Theil deren Existenz, als solcher, schwer oder gar nicht zu erweisen sein möchte, und weil diese Eintheilung den Historiker allzu oft in die Verlegenheit setzt, zumal bei Mangel zuverlässiger und vollständiger Nachrichten, auf Kosten der eigenen Ueberzeugung, somit auch der Wahrheit, Data anzunehmen oder zu ergänzen, um nur Alles in eines der vorgezeichneten Fächer zu zwängen.
Aber auch die Eintheilung in eigentliche grosse Kunstperioden schien mir für die Kunstgeschichte nicht die am glücklichsten gewählte zu sein; sie erschwert die Uebersicht der gleichzeitigen Begebenheiten (die Synchronistik), und führt den minder bewanderten oder minder kritischen Leser leicht irre, wenn er z.B. in einem und demselben Hauptabschnitte einen Okenheim als Haupt der niederländischen und einen Palestrina als Haupt der römischen Schule angezeigt findet, welche nur eben ein Jahrhundert von einander entfernt stehen. Irre ich nicht, so ist es nur dieser Methode, die Kunstgeschichte abzuhandeln, zuzuschreiben, dass die frühzeitige Entwickelung des Contrapunktes in den Niederlanden, und die Einwirkung der niederländischen Meister auf die Kunstbildung der übrigen europäischen Nationen so lange und bis zu unsern Tagen gänzlich übersehen worden war.
Mir schien die einfachste, daher natürlichste, und die zuverlässigste Uebersicht gewährende Eintheilung der Geschichte der Musik die nach Epochen zu sein. Diese Epochen sollten von einem der berühmtesten Männer der Zeit ihren Namen erhalten, und zwar von demjenigen, welcher auf die Kunstbildung und den Geschmack seiner Zeitgenossen am kräftigsten eingewirkt, und entweder durch neue Entdeckungen, durch Einführung neuer Gattungen, oder eines neuen Styles, oder durch bedeutende Verbesserungen der vorgefundenen Setzarten, durch Beispiel oder Lehre, die Kunst erweislich auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit gefördert hätte. Die längere oder kürzere Dauerzeit einer solchen Epoche sollte dabei kaum in Erwägung kommen; eine Epoche kann die Dauer eines Jahrhunderts umfassen, eine andere nach wenigen Decennien der folgenden den Platz räumen; nur muss jede durch irgend ein Ergebniss von Wichtigkeit bezeichnet sein; dieses, mit seinen unmittelbaren, und als nachhaltig dauernd zu erweisenden Wirkungen darzustellen, den Standpunkt, auf welchen die Kunst in jeder Epoche überhaupt, und gleichzeitig in verschiedenen Ländern gediehen, im Vergleiche gegen die vorigen Epochen zu bestimmen, und solchergestalt die allmählige stufenweise Entwickelung der Tonkunst bis auf unsre Zeit gleichsam in einem Cyclus von Vignetten, mit wenigen aber kräftigen Strichen anschaulich zu machen, dies sollte die Aufgabe sein.
Musikalische Theorie, Literatur und Künstlergeschichte sollten in einer übersichtlichen Geschichte, wie die gegenwärtige sein soll und sein will, nur so weit in Betrachtung kommen, als sie, bei Erklärung der Fortschritte der Musik als Kunst und als Wissenschaft nothwendig angezeigt werden müssten. Wer sich über jene Fächer musikalischer Gelehrtheit näher unterrichten will, kann in den schon vorhandenen denselben gewidmeten Lehr- und Handbüchern die gewünschte Belehrung leicht finden, die ihm hier nur auf Kosten der Klarheit der allgemeinen Kunstgeschichte hätte verschafft werden können. Von der Biographie der „Epochen-Männer“ soll übrigens das Nöthige angezeigt, auch die gleichzeitig berühmteren jedes Faches wenigstens nach Gebühr erwähnt werden.
Meine Absicht ist nur die: der achtungswürdigen zahlreichen Klasse der Musiker und der Musikfreunde ein Werk zu liefern, welches — ohne sie erst durch das Nebelland der (todten) Musik der alten Völker, oder wenigstens jener der alten Griechen zu führen (von welcher letzteren sie doch auch das Nothwendigste zu beliebigem Vor- oder Nachlesen in einem Anhange mit bekommen) — in einem mässigen Bande beendiget, ihnen von der Geschichte ihrer Kunst eine klare Ansicht gewähre, die sie in Burney’s grossem, überall seltenem, und schon in der fremden Sprache Wenigen zugänglichem Werke entweder nicht suchen, oder vor Menge des Stoffes kaum erlangen, und in Forkels Geschichte, welche, mit dem zweiten Bande noch unvollendet, nicht über das Jahr 1500 reicht, schon aus diesem Grunde vermissen würden, in jenen niedlichen Büchelchen aber, welche in verschiedenen Sprachen mit dem vielversprechenden Titel: Geschichte (Histoire, History) der Musik“ erschienen und übersetzt worden sind, schwerlich finden dürften.
Da übrigens dieses Werk dem Inhalte so wenig, als dem Plane nach, ein Auszug aus Burney’s oder Forkels Geschichten, oder aus dem Buche sonst irgend eines mir bekannten Autors, sondern das Resultat mannichfaltiger Lectüre, selbst eigener Forschungen und Bemühungen um Quellen, selbst gepflogener Einsicht in eine grosse Zahl zum Theil sehr seltener Werke der musikalischen Literatur, und jedenfalls eigener Kritik ist; so mag es wohl sein, — und ich besorge, es möchte oft so kommen — dass ich mit den Ansichten und Behauptungen der genannten sehr achtbaren Autoren, und mit manchen allgemein gangbaren Meinungen und Traditionen nicht übereinstimme; ich darf aber mit gutem Gewissen betheuern, dass ich von der eitlen Sucht der Neuerung, und von dem Geiste des Widerspruches mich immer frei erhalten habe, und dass ich wenigstens für die Richtigkeit der Thatsachen (so weit als man den Historiker auch für Traditionen der Vorgänger mit Billigkeit verantwortlich machen darf) getrost einstehen kann, meine Urtheile, als Folgerungen aus jenen, für untrügliche zu geben, konnte ich ohnehin nicht gemeint sein.
*) Das Nothwendigste zur Kenntniss der Theorie der altgriechischen Musik findet der geehrte Leser in dem den Anmerkungen gewidmeten Auhnnge, unter Nr. 1.
*) Unter dem Buchstaben B ist ursprünglich überall der Ton zu verstehen, den wir H (die Engländer richtiger B, die Franzosen Si) nennen. In der Ausübung des Choralgesanges musste aber der Euphonie zu Lieb’ (wegen Vermeidung des hässlichen Tritonus gegen F) in einigen Tonarten und in besonderen Fällen jener Ton alterirt werden, und so entstand ein zweifaches B, nämlich das B rotundum (b) und ein B quadratum , welches Letztere dann eigentlich unser hist.
*) Anmerkung Nr. II. Ueber die Neumen.
**) Man sehe den Anhang, Anmerkung I. über die griechische Musik, daselbst den Absatz b, Systeme.
*) Anmerkung Nr. 111. Hucbaldus und Hermannus Contractus
*) Anmerkung Nr. IV. Hexachord.
*) Anmerkung Nr. V. Harmonie, Melodie.