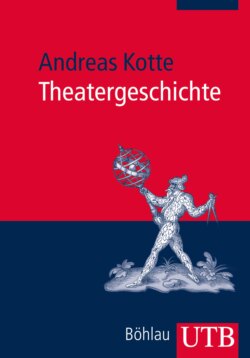Читать книгу Theatergeschichte - Andreas Kotte - Страница 13
1.2.3 Dionysos in der aristotelischen Tragödienentstehungshypothese
ОглавлениеÜber 200 Jahre trennen Aristoteles vom Gegenstand, denn die Poetik wird auf die Jahre um 335 datiert. Im vierten Abschnitt (1449a) beschreibt der Autor die Entstehung der Tragödie wie auch der Komödie aus Improvisationen; die Tragödie entwickelte sich für ihn aus dem dithyrambischen Chorlied, die Komödie aus den Phallos-Liedern und -Umzügen, wie sie auch weiterhin noch in manchen Städten üblich seien. Danach entfaltet er sein eingängiges Modell:
„Aischylos hat als erster die Zahl der Schauspieler von einem auf zwei gebracht, den Anteil des Chors verringert und den Dialog zur Hauptsache gemacht. Sophokles hat den dritten Schauspieler und die Bühnenbilder hinzugefügt. Was ferner die Größe betrifft, so gelangte die Tragödie aus kleinen Geschichten und einer auf Lachen zielenden Redeweise – sie war ja aus dem Satyrischen hervorgegangen – erst spät zu Feierlichkeit, und hinsichtlich des Versmaßes ersetzte der jambische Trimeter den trochäischen Tetrameter. Denn zunächst hatte man den Tetrameter verwendet, weil die Dichtung satyrspielartig war und dem Tanze näher stand; als aber der gesprochene Dialog aufkam, wies die Natur selbst auf das geeignete Versmaß.“43
Aristoteles betont hier die Aufführung gegenüber den Inhalten. Ihm ist es egal, ob sich in den Frühformen dionysosfremde Stoffe finden, solange das Satyrhafte, das dithyrambische Chorlied und der Tanz aufführungsseitig Ausgangspunkte bleiben. Einer wie auch immer erfolgten Einführung der Rede, die bei Else den problematischen einmaligen Schöpfungsakt der Tragödie begründet44, widerspricht Aristoteles nicht. Aber er bezeugt neben den Homer-Rhapsoden weitere Theaterformen, die die [<< 39] Tragödie beeinflusst haben können. Während eine literaturhistorische Argumentation die Heroenlegenden der Epen des Homer in den Vordergrund rückt, wird in einer kulturhistorischen Argumentation das von Aristoteles aufgeworfene Problem des Satyrhaften, Satyrischen (nicht zu verwechseln mit der Spätform Satyrspiel) ernst genommen.45
Der Zusammenhang zwischen dem Gott Dionysos und der Tragödie stellt sich dann her erstens über einen Gott nicht nur des Weines, sondern auch der Verwandlung, der Wiedergeburt und der Maske, der von den Ägyptern Osiris gleichgesetzt wurde, zweitens über den Dithyrambos, das „Herrscher-Dionysos-Lied“46, das Chorlied zu Ehren des Dionysos, das zum Wechselgesang Exarchon-Chor ausgebildet wird, und drittens über die Dionysien als Feste sowie speziell die Städtischen Dionysien als kultischer Rahmen für Dithyramben-, Komödien- und Tragödien-Wettbewerbe.47
Historisch war der Dithyrambos eine Hymne an Dionysos, von einem Chor gesungen. Etwa 50 Männer oder Knaben standen im Kreis um den Altar. Der Preis bei den Dithyramben-Wettbewerben war ein Stier. Höchstwahrscheinlich stiftete der Dichter, der ihn erhielt, den Stier für ein Festessen, an dem seine Freunde teilnahmen. Gleichzeitig war dies ein Opfer für den Gott. Der Dichter fungierte als Exarchon, als Vorsänger, Anführer. Bei den Städtischen Dionysien trug der Staat alle Ausgaben für die Dithyramben-Wettbewerbe bis auf eine Ausnahme: Der Dichter musste den Flötenspieler selbst bezahlen. Dies könnte ein Hinweis sein, dass er in der Frühzeit selbst Flöte gespielt hat und den Chor anführte. Er improvisierte die Zeilen und begleitete den Refrain mit seinem Flötenspiel. Er könnte deshalb ursprünglich der Priester gewesen sein, der den Dionysos darstellte. Wenn die Tragödie im Zusammenhang mit dem Dithyrambos entstanden sein sollte, wie Aristoteles es will, erklärt das Fest durchaus das „Tänzerische“ und das „Satyrhafte“, es ergäbe sich für die Tragödie vor Aischylos etwa folgendes Modell:
Die Tänzer betreten singend den Platz, die spätere Orchestra (Parodos).
Sie stellen sich um den Altar herum auf und singen das erste Standlied (Stasimon) – aber nicht bewegungslos.
Der Dichter erscheint, der den Gott oder einen Helden darstellt.
Er führt einen Dialog mit dem Chor und tritt danach ab.
Der Chor singt das zweite Standlied. [<< 40]
Der Dichter kehrt zum Beispiel als Bote zurück. Er bringt die Nachricht vom Kampf oder vom Tode des Helden oder des Gottes.
Alle zusammen singen ein Klagelied und verlassen damit den Platz bzw. die Orchestra (Exodos).
Der gemeinsame Auftritt der Tänzer und ihr gemeinsamer Abgang gemahnen strukturell noch an pompé und kômos, die Auseinandersetzung, der Tod, das, was verhandelt wird, von fern an den agón.48 Der kultische Zusammenhang ergibt sich aus dem Wechselverhältnis von Mythos und Ritus. Mythos meint den erzählerischen kollektiven Erfahrungsschatz, der historische und vorgestellte Ereignisse verknüpft, Ritus das Ausagieren, Darstellen, samt der Ordnung sich bezüglich des Mythos wiederholender Handlungen. Wenn Kult den Erzählfundus und den Vorgang vereint, so ergibt sich folgendes Fazit: Es werden eher rituelle als mythische Elemente aus dem städtischen Dionysoskult für die Tragödie entlehnt, weil vor allem der Umzug, der Opfergang und die Rückkehr, begleitet von Gesängen, im Einzug und im Auszug des Chores ihre Entsprechung finden.