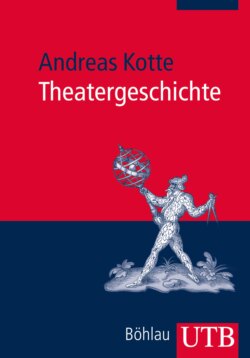Читать книгу Theatergeschichte - Andreas Kotte - Страница 19
1.3.4 Pantomimus als selbstständige Theaterform
ОглавлениеAb 364 v.Chr werden Pantomimen zu den Römischen Spielen zugelassen. Etruskische Tänzer, bezahlt aus der Staatskasse, führen ihre Szenen mit Tanz und Musik pantomimisch auf. Unter Augustus (31 v. Chr. – 14 n. Chr.) wird die Ausbildung des darstellenden Tanzes zu einer selbständigen Kunstgattung besonders gefördert. Man unterscheidet mit Pylades, einem Schauspieler aus Kilikien, sowie Bathyllus aus Alexandria zwei Hauptgattungen des Pantomimus. Der von Bathyllus eingeführte komische Pantomimus ist dem burlesken griechischen Tanz Kordax verwandt. Göttermythen der alten und mittleren Komödie, vielleicht auch direkte Parodien von Tragödien, bilden die Stoffe. Im tragischen Pantomimus des Pylades werden die wirksamsten Momente einer tragischen Handlung in einer Reihe von lyrischen Soli zusammengefasst, die ein einziger Pantomime darstellt, der sowohl männliche als auch weibliche Rollen hintereinander geben muss. Den Text über tragische Liebesabenteuer der Götter singt der Chor. Die Einheit des Ortes macht Kulissenwechsel entbehrlich. Pylades führt statt der Flöte ein stark instrumentiertes Orchester ein. Er ordnet Musik und Gesang dem Tanz unter, wobei Maske und Kostüm meist für jede Rolle gewechselt werden. Nur beim Gewand- oder Manteltanz erfolgt für neue Rollen lediglich eine andere Drapierung mit demselben Gewand. Der Pantomimentanz ähnelte heutigem Ausdruckstanz. Die am meisten gefeierten Schauspieler gehörten häufig zum kaiserlichen Hause und genossen, ungeachtet ihrer den Sklaven ähnlichen rechtlichen Stellung, ein allgemeines Ansehen. Kaiser Nero verehrte zum Beispiel den Pantomimen Paris. Allerdings liess er ihn nach elf Jahren Dienst im Jahre 67 n. Chr. hinrichten, denn er selbst wollte fortan in der Kunst des Tanzes glänzen.66[<< 50]
Parallel zum wachsenden Desinteresse an der Tragödie gewinnen Mimus und Pantomimus an Boden, Ersterer stärker in den unteren, Letzterer in den höheren Gesellschaftsschichten, bis beide das Theaterangebot dominieren. Der Mimus überlebt sowohl die literarisch anspruchsvollere Alte attische Komödie als auch die zur Zeit Alexanders durch Menander repräsentierte Neue Komödie. Diese gelangte als eine Art Lustspiel im 2. Jahrhundert v. Chr. von Griechenland nach Italien. Sie wurde in Rom als Palliata vertreten durch Plautus (254 – 184 v. Chr.) und Terenz (um 190 – 159 v. Chr.). Die Togata, die lateinische Komödie in römischem Milieu, gespielt von Privatpersonen in Ziviltracht, verschwindet in der Kaiserzeit als weitere literarische Variante ebenfalls in der Bedeutungslosigkeit, und auch die Atellane tritt zugunsten von Mimus und Pantomimus zurück.67
Diese Entwicklungen reichen in das 5. und 6. Jahrhundert hinein und werden oft nur beiläufig erwähnt, da die Kenntnisse hierüber auf nur wenigen zuverlässigen Nachrichten und Textzeugnissen beruhen. Zwar liegen mit Tertullians De spectaculis (198) und den Reden des Johannes Chrysostomos vom Ende des 4. Jahrhunderts ausführliche Beschreibungen der römischen spectacula vor (Wagenrennen, Athletenwettkampf, Gladiatoren- und Tierkampf, Reste der Tragödie, Mimus, Pantomimus), aber diese reflektieren ausschließlich die ablehnende Perspektive des Frühchristentums. Inwiefern die rhetorischen Angriffe tatsächlich Wirkungen hervorbrachten und wie breit sie überhaupt zur Kenntnis genommen wurden, ist für jede der genannten Theaterformen gesondert zu erforschen. Für den Mimus, den Tertullian neben der Atellane, dem Pantomimus sowie der literarischen Tragödie und Komödie ausdrücklich erwähnt, führt dies zur Auseinandersetzung mit dem Werk des Altphilologen Hermann Reich: 1903 versucht er, entgegen der in der Theatergeschichtsschreibung weit verbreiteten Annahme eines Theatervakuums zwischen etwa 530 – 930, die Kontinuität des Mimus durch alle Zeiten und Räume nachzuweisen.