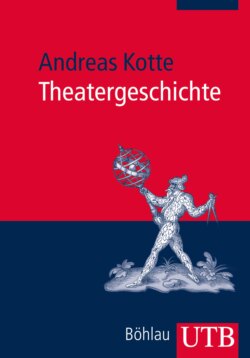Читать книгу Theatergeschichte - Andreas Kotte - Страница 18
1.3.3 Atellane
ОглавлениеDer entwicklungsgeschichtliche Ansatz leitet die Atellane von der griechischen Phlyakenposse ab. Die Osker hätten in Kampanien eine nach der Stadt Atella benannte Form des Mimus entfaltet, die schon seit Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. allmählich Einfluss auf die Bühnen in Rom erlangte. Dort wurden sie in einer Abwandlung später auch als lateinische Volksposse von römischen Bürgern aufgeführt. Diese literarische Variante existierte zu Sullas Zeit (ca. 100 – 80 v. Chr.).61 Livius berichtet, daß die römische Jugend ihren alten Brauch der Scherz- und Spottverse nie aufgab, sondern in der Form von Nachgesängen (exodia) beibehielt, die insbesondere eben mit den oskischen Atellanenspielen verknüpft wurden und später wohl ganz mit ihnen zusammengefallen sind.62 Die Atellani erreichten gegenüber anderen Schauspielern einen Sonderstatus, [<< 48] weil sie Masken trugen und weil, anders als im Mimus, Männer auch die Frauenrollen übernahmen. In den Masken wird der Einfluss der griechischen Phlyakenposse gesehen. Der Phallus verschwindet, stereotype Charaktere werden ausgebildet. Hinzu kommt möglicherweise ein etruskischer Einfluss über kultische Maskentänze, mit denen man Totengeister zu beschwören und zu bannen trachtete. Der Bezug auf mimische Leichenspiele könnte im Wiedergeburtsmotiv der Atellane erhalten geblieben sein. Im Allgemeinen wird improvisiert. Eine kurze, übersichtliche Handlung knüpft sich an vier stehende Masken, welche sich ohne direkte Verbindung eineinhalb Jahrtausende später ähnlich in den Prototypen der Commedia dell’arte wiederholen.
| Figuren der Atellane | Bezüge im 16. Jahrhundert | ||
| Maccus | Narr, gewitzter Vielfraß | zwei Zanni | Harlekin |
| Bucco | Maulheld, Fresser | Hanswurst | |
| Pappus | einfältiger, betrogener Alter | Pantalone | |
| Dossennus | pfiffiger Buckliger, Gelehrter, Schulmeister, Wahrsager | Dottore |
Die zahlreichen erhaltenen Titel von Atellanen der literarischen Variante offenbaren die beliebtesten Gegenstände. Um 90 v. Chr. stehen die beiden Atellanendichter Lucius Pomponius aus Bologna und Novius auf der Höhe ihres Schaffens. Vom ersten sind 71 Titel und 191 Fragmente, vom zweiten 113 Fragmente und 44 Titel erhalten. In 18 Titeln erscheint eine der vier festen Figuren. Meist umschreibt ein Attribut die komische Grundsituation: Maccus als Wirt, Maccus als Verbannter, Maccus als Soldat, Maccus als Jungfrau; Bucco als Gladiator, Bucco als Adoptivsohn, Der kleine Bucco; Die zwei Dossenni; Pappus als Landwirt, Pappus als Wahlverlierer (zweimal), Das Bruchleiden des Pappus, Die Braut des Pappus. Auch das Palliatenmotiv der Verwechslung begegnet mehrfach: Die Brüder, Die Zwillinge.63
Der spätere römische Mimus ist ebenso kurz wie die Atellane, kommt aber ohne ihre stehenden Masken aus. Er wird entweder von wandernden Mimen, Straßenkomödianten und Histrionen auf Märkten gegeben oder aber als Nach- oder Zwischenspiel anderer Aufführungen anlässlich von Festen in ephemeren, später in steinernen Theatern und Amphitheatern. Häufig gibt man persiflierend Götter dem Gelächter preis.64 In einem Mimus, aufgeführt im Beisein Vespasians im Theater des Marcellus, spielt ein [<< 49] Hund die Hauptrolle, der ein narkotisches Mittel verabreicht bekommt. Er soll sowohl das Einschlafen als auch das Erwachen überzeugend dargestellt haben. Am häufigsten zeigt man jedoch Liebeshändel, Ehebruchsszenen und plötzliche Schicksalswechsel: Bettler erlangen Reichtum, Reiche fliehen. Der Slang der untersten Gesellschaftsschicht dominiert. Schimpfreden und Prügel werden eingeflochten. Skurrile Gebärden und groteske Tänze mit Flötenbegleitung bestimmen das Spiel.65 Daneben existiert eine sozialkritische Variante des Mimus: Sklaven führen während der sizilianischen Aufstände (136 – 132 v. Chr.) in den besetzten Städten Szenen über den Abfall von ihren Herren auf.