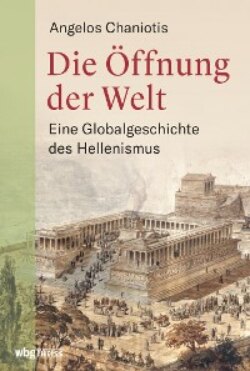Читать книгу Die Öffnung der Welt - Ангелос Ханиотис - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Das „alte“ Griechenland im kurzen 3. Jahrhundert: ein Kampf um Überleben, Freiheit und Vorherrschaft Die Allgegenwart des Krieges
ОглавлениеWelche Ereignisse sieht man heute als Meilensteine in den 60 Jahren zwischen der Konsolidierung der hellenistischen Staaten um 275 v. Chr. und dem ersten Krieg zwischen einem hellenistischen Königreich und Rom? Mit Sicherheit, dass eine Gruppe von etwa 70 hebräischen Gelehrten in Alexandria auf Einladung eines Königs, der Sage nach Ptolemaios’ II., das Alte Testament übersetzte; dass ein Mathematiker in Syrakus aus einer Badewanne sprang und „Heureka!“ rief; und dass ein Astronom behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne. All das, geschehen im „kurzen 3. Jahrhundert“, veränderte die Weltkultur. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, erlaubte es Nichtjuden, mit der Heiligen Schrift vertraut zu werden. In Syrakus entdeckte Archimedes ein Prinzip, das noch heute seinen Namen trägt und die Berechnung des Volumens unregelmäßiger Objekte ermöglicht. Aristarchos von Samos schuf die Grundlagen für eine heliozentrische Weltsicht.
Es lassen sich dem weitere, weniger bekannte, aber ebenso glückliche Momente aus Wissenschaft und Kultur dieser Jahre hinzufügen: zum Beispiel die verblüffend genaue Berechnung des Erdumfangs durch Eratosthenes – er schätzte ihn auf 250.000 Stadien (damit lag er nur 1675 km über dem tatsächlichen Wert); oder die Erfindung der hydraulis, einer frühen Form der Pfeifenorgel, durch Ktesibios um 270 v. Chr.; oder dass der Arzt Erasistratos, geboren auf der kleinen Insel Keos, entdeckte, dass das Herz nicht das Zentrum der Empfindungen ist, sondern vielmehr wie eine Pumpe funktioniert; oder die Tatsache, dass Zenodotos von Ephesos, Bibliothekar in Alexandria, die erste kritische Ausgabe der homerischen Epen besorgte und das Prinzip einführte, eine Bibliothek nach Sachgebieten und innerhalb der Fächer alphabetisch nach Autorennamen zu ordnen; er erfand auch das Schildchen mit den wesentlichen Identifikationsangaben (Autor, Titel und Thema), das von nun an am Ende einer jeden Schriftrolle angebracht wurde. Es ist kein Zufall, dass die meisten dieser Dinge in Alexandria entwickelt wurden, dem führenden kulturellen Zentrum der Welt.
Nur wenige Zeitgenossen realisierten vermutlich die volle Tragweite dieser Ereignisse. Und noch weniger schenkten wohl den Taten König Ashokas in Indien Beachtung: Der hatte auf beinahe dem ganzen indischen Subkontinent ein Reich etabliert (269–232 v. Chr.), konvertierte dann zum Buddhismus und entsandte Missionare in den Westen. Nur die westlichen Griechen nahmen wohl den Krieg zur Kenntnis, der zwischen Rom und Karthago geführt wurde und als Erster Punischer Krieg (264–241 v. Chr.) in die Geschichte einging. Und verständlicherweise wusste niemand von den Kriegen in Fernost, die 221 v. Chr. zur Vereinigung Chinas unter der ersten Kaiserdynastie der Qin führten. Die Griechen des 3. Jahrhunderts waren zu sehr damit beschäftigt, um die Grenzen von Königreichen, Städten und Städtebünden zu kämpfen, als dass sie über die Grenzen ihrer eigenen Welt hätten hinausblicken können.
Der Krieg dominierte die öffentlichen und privaten Erinnerungen im kurzen 3. Jahrhundert. Er beeinträchtigte das Leben aller; er war die einprägsamste Erfahrung, die ein Mensch machen konnte – ungeachtet seines Status, Alters oder Geschlechts. Das Grab eines gewissen Apollonios von Tymnos, der nicht in der Schlacht fiel, sondern um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. an Altersschwäche starb, war mit dem Symbol geschmückt, das einst seinen Schild geziert hatte: mit einer Schlange. Sein Epitaph erwähnt die Ereignisse, von denen er anscheinend gern erzählte: die Schlachten, die er für sein Vaterland geschlagen hatte, und die zahllosen Speere, die er „fest in das Fleisch seiner Feinde gestoßen hatte“. Menschen gedachten eines Vaters, eines Sohnes, eines Bruders oder eines Freundes, der in der Schlacht gefallen war; der Tochter, die von Piraten entführt worden war; des Verwandten, der sich im Krieg ausgezeichnet hatte. Erinnerungen an den Krieg waren unterschiedlicher Natur. Sie reichten vom Grabmal eines jungen Soldaten, das von seinem Vater errichtet wurde, und einer Weihung eines Kriegers nach seiner sicheren Heimkehr nach einem Feldzug bis zu einem langen Dekret zu Ehren eines Offiziers, der Beschreibung einer Schlacht durch einen Historiker und den res gestae eines siegreichen Königs. Es ist nicht möglich, die Kriege dieser Epoche in ihrem ganzen Umfang darzustellen (s. die Zeittafel, S. 465–467), doch bevor wir eine Auswahl der bedeutendsten von ihnen näher betrachten, sollen kurz die Hauptursachen dieser Kriege geschildert werden.
Der Aufstieg der hellenistischen Königreiche war mit Sicherheit die bedeutendste Ursache, und zwar aus drei Gründen: Erstens schränkten die Expansionen der Königreiche das Territorium, die Freiheit und die Autonomie griechischer poleis ein; immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergab, rebellierten die Städte, um ihre Autonomie zurückzugewinnen. Zweitens versuchten die Könige permanent, das eigene Territorium auf Kosten anderer Königreiche zu vergrößern. Und drittens verlor der Typus des „Abenteurer-Königs“ eines Pyrrhus, Demetrios oder Agathokles zwar an Bedeutung, verschwand jedoch nicht vollständig, und mehrere Abenteurer, in der Regel Mitglieder einer Dynastie, Usurpatoren oder abtrünnige Statthalter, versuchten, sich eigene Königreiche aufzubauen. Die Monarchie war zwar ein neuer Faktor, der Kriege verursachte, die Konflikte zwischen und innerhalb von Städten waren allerdings so alt wie die griechische polis selbst. Viele kleine und große Kriege hatten ihren Ursprung in Gebietsstreitigkeiten und den Bestrebungen größerer Städte, ihre kleineren Nachbarn zu kontrollieren. Gebietserweiterung und Hegemoniestreben waren auch für Städtebünde typisch: In der Folge kam es vermehrt zu kleineren Kriegen um die Aneignung von Land oder um die Unterwerfung eines Gemeinwesens. Invasionen größeren Ausmaßes durch Barbaren, wie die der Kelten 280 v. Chr. oder der Parther 238 v. Chr., waren weniger häufig, sie hatten jedoch dramatische Auswirkungen.