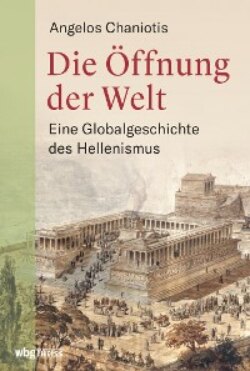Читать книгу Die Öffnung der Welt - Ангелос Ханиотис - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cherchez la femme: der Laodike-Krieg (246–241 v. Chr.) und die Locke der Berenike
ОглавлениеMit dem Tod Ptolemaios’ II. im Januar 246 v. Chr. ging eine Ära zu Ende, eine Zeit, die vom Einfluss des Ptolemäerkönigs auf die „internationale Politik“ geprägt war. Vielleicht erkannte Antiochos II. nun eine Chance, auf Kosten ptolemäischen Territoriums außerhalb von Ägypten zu expandieren. Doch auch Ptolemaios III. hatte gute Gründe, einen Krieg zu beginnen: Der Frieden von 253 v. Chr. hatte dem ptolemäischen Einfluss in Kleinasien und in der Ägäis immens geschadet, und das rechtfertigte sein Bestreben, die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen und seine Herrschaft durch militärische Leistungen zu legitimieren. 246 v. Chr. hielt sich Antiochos II. in Kleinasien auf, vermutlich nachdem er sich mit der in Ephesos lebenden Laodike ausgesöhnt hatte. Er hatte eine Heirat mit einer ägyptischen Prinzessin abgelehnt, was das Friedensabkommen beeinträchtigte; somit muss er sich auf einen Krieg vorbereitet haben. Doch auch Ptolemaios III. war nicht unvorbereitet; seine Armee operierte in der Nordägäis bereits in einer frühen Phase des Konflikts.
Im August 246 v. Chr. starb Antiochos II. plötzlich – womöglich hat Laodike ihn ermordet; sie übernahm umgehend die Führung des Königreichs, ließ ihren ältesten Sohn Seleukos II. zum König ausrufen und fädelte in der seleukidischen Hauptstadt Antiochia die Ermordung von Berenikes Sohn und später der Königin selbst ein. Für Ptolemaios III. war der Krieg nicht nur eine Frage der Gebietsverteidigung oder -eroberung, sondern es ging ihm zunächst auch um den Schutz seiner Schwester und seines Neffen, und später um Rache für deren Tod. Sein Erfolg war beeindruckend. Er führte einen Feldzug ins Herz des Seleukidenreichs, eroberte die Hauptstädte Seleukeia und Antiochia, überquerte dann den Euphrat und zog bis nach Mesopotamien weiter. Dass Ptolemaios III. bis nach Südmesopotamien gelangte, war ein großes Wagnis, aber auch ein grandioser Erfolg. Von dort aus hatte beinahe 80 Jahre zuvor sein Großvater, der Weggefährte Alexanders, seine Reise nach Alexandria begonnen. Als der Statthalter von Ephesos zu Ptolemaios überlief, ging die bedeutendste Stadt Kleinasiens in ptolemäische Kontrolle über.
Bis zu diesem Punkt war der Krieg ein Konflikt zwischen den Ptolemäern und den Seleukiden gewesen; doch wie so oft in dieser Epoche löste er einen Dominoeffekt aus. Als Ainos in Thrakien, eine Stadt von strategischer Bedeutung für den Seehandel in der Nordägäis, unter ptolemäische Kontrolle kam, alarmierte dies Antigonos Gonatas, den traditionellen Rivalen der Ptolemäer in der Ägäis. Mit seinem Eintreten in den Kampf wurde der „Laodike-Krieg“ zu einem der hellenistischen Weltkriege. Der makedonische König, der jüngst seine Hauptstützpunkte in Südgriechenland verloren hatte, witterte die Chance, die Kontrolle über die Kykladen zurückzugewinnen. In einer großen Seeschlacht bei Andros wurde die ptolemäische Flotte 246 oder 245 v. Chr. geschlagen.
Ptolemaios III. musste den Feldzug um 243 v. Chr. abbrechen, vermutlich weil es in Ägypten aufgrund seiner langen Abwesenheit zu Unruhen gekommen war. Seleukos II. konnte in Kleinasien und Syrien wieder Boden gutmachen, jedoch nicht ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen: Er musste seinen jüngeren Bruder Antiochos Hierax (der Habicht) als Mitregenten akzeptieren; dieser erklärte sich später, um 240 v. Chr., in Kleinasien zum König. Was Antigonos Gonatas betrifft, so wurden die Auswirkungen seines Erfolgs in Andros schon bald beinahe vollständig wieder zunichtegemacht. Aratos befreite 245 v. Chr. Korinth und Akrokorinth von der makedonischen Besatzung. Unter seiner Führung verbündete sich der Achäische Bund mit Ptolemaios III., der 243 v. Chr. zu dessen hegemon auf Land und See erklärt wurde.
Praktisch gesehen hatte diese Position nur wenig Bedeutung – Ptolemaios III. hatte nie das Kommando über achäische Truppen oder Schiffe inne. Sie sandte jedoch eine politische Botschaft. Es war nicht das erste Mal, dass ein Städtebund einen König zu seinem militärischen Führer wählte: Es handelte sich um die Position, die Philipp II. im Hellenenbund innehatte, wie später auch die Antigoniden Antigonos Doson und Philipp V. bei dessen Wiederbelebung 224 v. Chr. Zum ersten Mal übernahm jetzt allerdings ein König, dessen Reich sich außerhalb Griechenlands befand, diese Funktion, was weitreichende politische Ansprüche sowohl aufseiten des Ernennenden, Aratos, als auch aufseiten des Ernannten, Ptolemaios III., erkennen lässt. Wir können annehmen, dass der Achäische Bund aus Aratos’ Sicht in die Fußstapfen des Hellenenbundes trat. Es wäre überraschend, wenn ein Staatsmann seines Formats, der über Weitblick und ein Bewusstsein seiner historischen Rolle verfügte – Aratos verfasste als einer der ersten Staatsmänner Memoiren –, dies nicht realisiert hätte. Und es wäre ebenso überraschend, wenn Ptolemaios über frühere Bündnisse mit panhellenischen Ansprüchen und die Bedeutung seiner Position als hegemon einer Allianz in Griechenland im Unklaren gewesen wäre. Auch Ptolemaios III. war sich seiner historischen Rolle bewusst: Er hinterließ uns kurze Berichte seiner Taten in einer Inschrift, in der er stolz von seinen beispiellosen Errungenschaften (s. S. 98f.) erzählt. Damit soll nicht gesagt werden, dass Ptolemaios III. den Traum von einer Nachfolge Alexanders in Europa und Asien wiederbelebte. Dennoch lassen sich Kontinuitäten bei der Wahl der von Königen und führenden Staatsmännern angewandten Instrumente politischen Handelns nicht leugnen. Es lässt sich ein wiederkehrendes Muster erkennen: Eine Gruppe griechischer Städte, die sich zusammengeschlossen hatten, um sich einer Bedrohung ihrer Unabhängigkeit entgegenzustellen, akzeptierte einen Monarchen als ihren Führer, dessen Politik ihrem Plan zu diesem Zeitpunkt zuträglich schien; und ein Monarch akzeptierte die Führungsrolle, nicht aus Freiheitsliebe, sondern um auf der panhellenischen Bühne Berühmtheit zu erlangen.
Der Laodike-Krieg dauerte bis 241 v. Chr., als Seleukos II. und Ptolemaios III. schließlich ein Friedensabkommen schlossen. Ptolemaios’ größter Erfolg bestand darin, dass er nicht nur Koilesyrien halten konnte, sondern auch sein Reich erweitert hatte, indem er den bedeutendsten Hafen Syriens, Seleukeia Pieria, eingenommen hatte. Durch seine Kontrolle über Zypern, mehrere ägäische Inseln, Küstenstädte in Thrakien und Städte in Kleinasien festigte Ägypten unter Ptolemaios III. seine Position als bedeutendste Macht im östlichen Mittelmeerraum. Ptolemaios’ Vorherrschaft wurde auch durch die politischen Probleme begünstigt, mit denen sich seine wichtigsten Gegenspieler konfrontiert sahen. Der größte Verlierer des Krieges war Seleukos II. Nach einem Bürgerkrieg herrschte sein Bruder Hierax über weite Teile Nord- und Westkleinasiens als unabhängiger König. Und in Pergamon nahm der lokale Dynast Attalos I. nach einem großen Sieg über die keltischen Stämme 238 v. Chr. in Nordwestkleinasien den Königstitel an. Um 228 v. Chr. vertrieb er Hierax aus Kleinasien. Hierax setzte seine Abenteuer zunächst in Mesopotamien und dann in Thrakien fort, wo er 226 v. Chr. getötet wurde. Im Osten hatte Andragoras, der Statthalter von Parthien, Seleukos’ II. Beteiligung am Laodike-Krieg zu seinem Vorteil genutzt und regierte seine Provinz als unabhängiger König (ca. 245–238 v. Chr.). Als der Nomadenstamm der Parner – später als Parther bekannt – in die östlichen Provinzen der Seleukiden einmarschierte und ganz Parthien besetzte (238–209 v. Chr.), konnte Seleukos II. den Satrapien nicht den Schutz bieten, den diese von einem König erwarteten. In der Folge erklärte sich Diodotos, der Satrap von Baktrien, für unabhängig und gründete das Griechisch-Baktrische Königreich (s. S. 231). Als Seleukos II. 226 v. Chr. vom Pferd stürzte und starb, war sein Königreich nur noch beinahe halb so groß wie das seines Vaters.
Ptolemaios hatte allen Grund zum Feiern. Kurz nach dem Krieg gab er den Bau eines riesigen Throns in Auftrag: Er wurde bei Adulis, dem südlichsten Teil seines Reiches, am Erythräischen Meer, dem heutigen Roten Meer, errichtet. Eine auf Griechisch und Ägyptisch verfasste Inschrift verkündet stolz Ptolemaios’ Errungenschaften. Ein Mönch, Kosmas Indikopleustes (der, der nach Indien segelte), sah diesen Text 525 n. Chr. und hinterließ uns eine Zeichnung von Thron und Text:
Nachdem König Ptolemaios der Große … von seinem Vater die Königsherrschaft über Ägypten, Libyen, Syrien, Phönizien, Zypern, Lykien, Karien und die Inseln der Kykladen übernommen hatte, zog er nach Asien mit Infanterie, Kavallerie, einer Flotte und Elefanten aus dem Land der Troglodyten und aus Äthiopien, die sein Vater und er selbst als Erste aus diesen Ländern gejagt und nach Ägypten gebracht hatten, wo sie sie zu Kriegszwecken ausrüsteten. Nachdem er die Macht erlangt hatte über das ganze Gebiet diesseits des Euphrats, Kilikien, Pamphylien, Ionien, den Hellespont, Thrakien, alle Streitkräfte in diesen Ländern sowie die indischen Elefanten, und nachdem er alle Herrscher dieser Gegenden zu seinen Untertanen gemacht hatte, überschritt er den Fluss Euphrat, und nachdem er sich Mesopotamien, Babylonien, Sousiane, Persis, Medien und das ganze restliche Land bis Baktrien unterworfen hatte, und nachdem er alle heiligen Objekte ausfindig gemacht hatte, die von den Persern aus Ägypten fortgeschafft worden waren, und sie zusammen mit den anderen Schätzen aus diesen Gegenden wieder nach Ägypten gebracht hatte, schickte er seine Streitkräfte durch die gegrabenen Flüsse [Kanäle] …
Ptolemaios III. Euergetes (der Wohltäter) präsentierte sich hier selbst als Garant dynastischer Legitimität, als Herrscher über mehr Länder als jeder andere König nach Alexander, als Krieger, der den Spuren des großen Eroberers bis nach Baktrien folgte, als militärischer Erneuerer sowie als Rächer des Unrechts, das der Perserkönig Kambyses 525 v. Chr. gegen die ägyptischen Tempel begangen hatte. Auch wenn er übertrieb, war er in der Tat der mächtigste Mann im östlichen Mittelmeerraum. Es überrascht vielmehr, dass Ptolemaios III. sich nicht dazu entschied, seinen klaren Vorteil gegenüber Gonatas und Seleukos II. dazu zu nutzen, eine aggressivere Politik zu betreiben. War er der einzige hellenistische König, der aus den Fehlern der Diadochen gelernt und begriffen hatte, dass sich seine Feinde gegen ihn zusammenschließen würden, wenn er zu viel Macht erlangte? Oder sehnte er sich nach einem weniger abenteuerlichen Leben in Ägypten? Insofern man von seinen Taten auf seine Absichten schließen kann, war Ptolemaios daran interessiert, ein Gleichgewicht der Mächte aufrechtzuerhalten, wobei er jene unterstützte, die seine Gegner schwächten – öfter durch finanzielle Mittel als durch Streitkräfte. Eine weniger aggressive Politik bedeutete auch weniger Risiken, und im Gegensatz zu seinen Gegnern, die bis zu ihrem Tod permanent in Kriege verwickelt waren, verbrachte Ptolemaios III. die letzten 20 Jahre seiner Herrschaft in Ägypten und richtete seine Aufmerksamkeit auf sein väterliches Erbe. Er ist der erste ptolemäische König, für den die ägyptischen Priester Inschriften mit langen Ehrendekreten auf Griechisch, in ägyptischen Hieroglyphen und auf Demotisch errichteten; er reformierte auch die Verwaltung der Provinzen. Von Alexandria aus konnte er die Auseinandersetzungen in Griechenland, Kleinasien, Mesopotamien und im fernen Osten bequem im Auge behalten.
Die Erinnerung an Laodike und ihren Krieg begann zu verblassen. Ein kleiner Zwischenfall hat jedoch für immer seine Spuren am Sternenhimmel hinterlassen: Als Ptolemaios III. 243 v. Chr. in Mesopotamien Krieg führte, gelobte seine junge Frau Berenike, dass sie ihr langes blondes Haar Aphrodite darbringen würde, wenn die Göttin den König beschützte und ihn ihr wieder zurückbrächte. Ptolemaios kehrte heil zurück, und Berenike erfüllte ihr Gelübde und deponierte ihr Haar im Tempel der Aphrodite. Als dieses am nächsten Tag nirgends mehr zu sehen war, brachte der Hofastronom folgende Erklärung dafür vor. Er identifizierte das Haar mit einem Sternbild und behauptete, die Göttin der Liebe habe sich so sehr über die Opfergabe gefreut, dass sie das Haar der Berenike ans Firmament gesetzt habe, wo es immer noch mit bloßem Auge zu erkennen ist. Der Hofdichter Kallimachos verfasste ein von diesem Vorfall inspiriertes Gedicht. Das meiste davon ist heute verloren, abgesehen von Versfragmenten auf einem Papyrus. Doch hat sich eine lateinische Übersetzung in Catulls Carmen 66 erhalten, ein wunderbarer Lobpreis der Liebe. War Berenikes Liebe stärker als der Drang nach Eroberung? Ist es das, was Ptolemaios in Ägypten hielt und ihn der Versuchung widerstehen ließ, neue Eroberungen in Angriff zu nehmen? Diese Hypothese wird niemals bewiesen oder widerlegt werden können; sie bleibt ein netter, wenn auch unwahrscheinlicher Gedanke, ein heiteres Intermezzo zwischen einer Reihe von Kriegen und der nächsten.