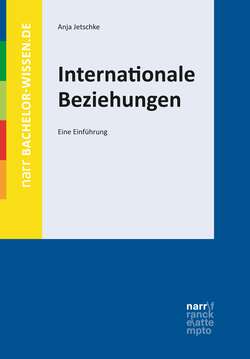Читать книгу Internationale Beziehungen - Anja Jetschke - Страница 34
Die Verbreitung autoritärer StaatenAutoritarismus in der Dritten Welt
ОглавлениеDie Dekolonisation von Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika hatte indessen nicht den Effekt, dass diese Staatengruppe sich zu stabilen demokratischen Staaten entwickelte.Dekolonisation und innerstaatliche Entwicklung In vielen Staaten führte der Abzug der Kolonialmacht unmittelbar in den Bürgerkrieg, weil innerstaatliche politische Gruppierungen um die Nachfolge in der politischen Herrschaftsausübung konkurrierten und Kolonialmächte auf einflussreiche innerstaatliche Gruppen Einfluss nahmen, um ein Ergebnis in ihrem Sinne herbeizuführen. Obwohl einige Staaten Erfahrungen mit demokratischen Systemen machten, beispielsweise Indien, Malaysia, Sri Lanka, die Philippinen oder auch Nigeria als größter afrikanischer Staat, etablierte sich in keinem der neuen Staaten langfristig ein demokratisches, pluralistisches System. Stattdessen wurden politische Regierungsumstürze und die Einparteienherrschaft zur Norm, die oftmals durch das Militär politisch abgestützt wurdeVerbreitung autoritärer Einparteienregierungen.
Dieser Trend hatte zwei Ursachen. Beide stehen in einem Zusammenhang mit zentralen entwicklungspolitischen Leitbildern, die in Bezug auf die sogenannten Entwicklungsländer existierten: Viele Staaten orientierten sich an einem sozialistischen Entwicklungsmodell. Die Sowjetunion mit ihrem Schwerpunkt auf zentralstaatlicher Planung und kapitalintensiver Industrialisierung in großem Maßstab galt zu Beginn der 1950er Jahre aufgrund ihres hohen Wirtschaftswachstums als Erfolgsmodell unter internationalen Entwicklungsorganisationen und den Entwicklungsländern, das viele Regierungen folglich übernahmen (Bruton 1998). Afrikanische Eliten fanden davon abgesehen die „sozialistische, die Ordnungsaufgabe des Staates und eine ‚wissenschaftliche‘ Gesellschaftsplanung betonende Visionen genuin attraktiv.“ (Jansen/Osterhammel 2013: 105) Schließlich übte die kommunistische Ideologie mit den Ideen der Befreiung von Unterdrückung eine starke Anziehungskraft aus.
In westlich orientierten Staaten war dieses Phänomen das Ergebnis der politischen Entscheidung für eine militärisch angeleitete Entwicklungsstrategie. Diese zielte darauf ab, sowohl kommunistische Bewegungen innerstaatlich einzudämmen als auch die als entwicklungshemmend empfundenen traditionellen Gesellschaftsstrukturen zu modernisieren (Simpson 2008). Sowohl Clan-, Cliquen- und ethnische als auch religiöse Organisationsformen anderer Kulturen und Zivilisationen galten aufgrund ihres anti-modernen und nicht-säkularen Charakters als modernisierungshinderlich. Gleichzeitig galt das Militär als Bollwerk gegen kommunistische und islamistische Bewegungen. Westliche Entwicklungsorganisationen und Regierungen sahen in der Stärkung des Militärs mit seiner hierarchischen Entscheidungsstruktur und einem bürokratischen Apparat eine dem westlichen Staat durchaus Unterscheidung von Militär- und Entwicklungsdiktaturenvergleichbare Organisation, aus der staatliche Strukturen herauswachsen hätten können. Die meisten Staaten entwickelten sich folglich entweder zu autoritär regierten Militärdiktaturen – wobei die politische Einmischung des Militärs variierte – oder Entwicklungsdiktaturen, das waren die durch Einheitsparteien regierten Staaten. In beiden Staatengruppen waren die Bürger- und Freiheitsrechte eingeschränkt. Dies führte zu wechselseitiger Kritik der Bündnissysteme aneinander und gab Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International Auftrieb, die die Menschenrechtslage in beiden Lagern gleichermaßen kritisierten (vgl. Einheit 12).
Merke
DekolonisationDekolonisation und innerstaatliche Strukturen
Unter den neu entstandenen Staaten der Dritten Welt entwickelte sich die Einparteienherrschaft zur Norm für innerstaatliche Parteiensysteme. Keiner der neuen Staaten entwickelte dauerhaft pluralistische, innerstaatliche Strukturen.
Sowohl aus der Perspektive westlicher als auch aus planwirtschaftlicher Entwicklungsplanung war diese Entwicklung gewollt, da man davon ausging, dass die Einschränkung pluralistischer Strukturen die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt.
In Bezug auf die Entwicklung innerstaatlicher Strukturen war die Welt 1972 zweigeteilt: Demokratien finden sich in Nordamerika und Westeuropa, der Rest weist mehr oder weniger starke Einschränkungen politischer Freiheitsrechte auf.
Abbildung 2.3 und 2.4 zeigen, wie sich demokratische Staaten zu zwei Zeitpunkten, 1950 und 1972 weltweit verteilen. Die Messung der Demokratie beruht auf einem Index von 10 (für die höchsten Demokratiewerte) bis -10 (für die niedrigsten Demokratiewerte). Deutlich zu sehen ist die Autokratisierung Afrikas, Lateinamerikas aber auch Südostasiens zwischen diesen beiden Zeitpunkten.
Globale Demokratiewerte 1950
1950 / 1972
Demokratie-Skala
Autokratisch Demokratisch
ohne Einfärbung = keine Daten vorhanden
Globale Demokratiewerte 1972