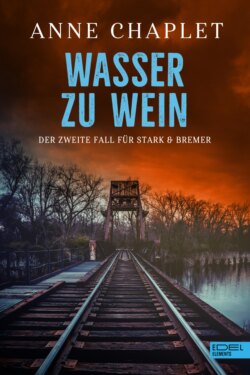Читать книгу Wasser zu Wein - Anne Chaplet - Страница 11
6
ОглавлениеKlein-Roda in der Rhön
Ein durchdringendes Schreien durchkreuzte den wattewarmen Traum, der Paul Bremer eben noch in Visionen von Liebe und Schönheit gewiegt hatte, und zwang ihn, die Augen zu öffnen: einem milchigen Himmel entgegen und der frischen Landluft, die durch das offene Fenster wehte und ihm Gülledüfte, Schweinegestank und den Geruch von halbvergorener Silage servierte. Im Wohnzimmer unten schlug die Uhr sechs. Es war kalt und ungemütlich, und draußen wütete das Leben. Alles wie gewohnt. Bauer Knöss fuhr Gülle. Willi fütterte seine tobenden Schweine. Die Gänse, die sich Ortsvorsteher Wilhelm vor wenigen Monaten zugelegt hatte, schrien im Chor mit den drei Dorfkötern, die abwechselnd heulten und bellten. Bremer zog sich die Decke über den Kopf. Aber das half nichts. Gegen das morgendliche Pandämonium in Klein-Roda war nicht anzukommen. Nach fünf Minuten warf er die Decke von sich und fügte sich der ländlichen Ordnung: Sie duldete keine Langschläfer.
Benommen ging er ins Bad. Ein Blick in den Spiegel überzeugte ihn von der Nutzlosigkeit einer Rasur. So lange hielt er diesen Anblick nicht aus. Er ging wieder ins Schlafzimmer, zog sich an, stieg die Treppe hinunter und ließ Wasser für den Tee in den Wasserkocher laufen. Vor der Haustür balgten sich bereits Nachbars Katzen. »Erst ich, dann ihr«, brummte er, goß den Tee auf, ließ ihn ein Weilchen ziehen und trank den ersten Becher im Stehen. Dann holte er eine Dose aus dem Regal und den Dosenöffner aus der Schublade und schloß die Haustür auf. Die Katzenbande warf sich ihm entgegen. Bremer war der beliebteste Dosenöffner der Katzenbevölkerung von Klein-Roda. Dazu gehörte nicht viel. Er war schließlich der einzige.
Er gähnte, während er auf die verfressenen Kerle hinabblickte, die schmatzend um die beiden Futternäpfe hockten, die er ihnen gefüllt und vorgesetzt hatte. Manchmal war die Fütterung der Raubtiere das einzige gesellige Ritual am Tag. Dennoch verschwendete er schon lange keinen Gedanken mehr an die Alternative: an ein Leben in der Großstadt. Jeden Tag im Büro zwischen intriganten Kolleginnen und eitlen Kollegen? dachte er voller Widerwillen. Jeden Abend in die Kneipe? Inmitten der blöde gackernden Schickeria aus Börsianern, Bankern, Juristen und ›Kreativen‹? Er schüttelte sich. »Und jedes Wochenende ein tiefes, schwarzes Loch? – Nie wieder!« murmelte er und schob mit der Schuhspitze den einen der beiden Freßnäpfe wieder an seinen Platz.
Statt dessen bestellte er seinen Garten, fütterte fremder Leute Katzen, schrieb mäßig erfolgreiche Bücher, führte Selbstgespräche und fuhr Fahrrad. »Heute Depression gehabt«, würde ein regelmäßig wiederkehrender Eintrag in seinem Tagebuch lauten, wenn er denn eines führte, was er aus guten Gründen nicht tat. »Danach Fahrrad gefahren.« Wonach es ihm meistens besser ging. Er gab sich einen Ruck, ging wieder nach oben und zog die Fahrradklamotten an. Er wußte, daß man ihn im Dorf milde belächelte, wenn er zwar auch am Sonntag seine Alltagsjeans trug, aber ausgerechnet zum Fahrradfahren die Kleidung wechselte. Das ist eben mein Gottesdienst, dachte er. Erst wenn er sich auch noch einen dieser windschnittigen Helme aufsetzte, unter denen sich die Städter so dynamisch fühlten, würden seine Nachbarn ihn endgültig für verloren erklären. Bis dahin war man tolerant.
Er fuhr bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit: Wenn der Regen mit feinen Nadelspitzen in seine Haut drang. Durch knirschenden Schnee. Bei Westwind. Im rötlichen Schein der aufgehenden Sonne. Und spät an Sommerabenden, wenn sich die Eulen von ihren Schlafbäumen schwangen und mit leisem Flug auf Beutezug gingen. Auf dem Fahrrad ordnete sich sein Leben, wurden die Gedanken klar, hatte er Eingebungen, fanden sich Lösungen wie von selbst ein: vor allem, wenn es bergauf ging.
Bremer schloß die Haustür, holte sein Rennrad aus dem Schuppen und schob es zum Gartentor hinaus. Marianne fegte die Gass', sogar morgens schon in kurzen, knappen Hosen und im weit ausgeschnittenen Spitzenhemdchen. Irgendwie war ihr nie zu kalt. Er sah sie gern so.
»Grüß mir die Heimat!« rief sie ihm zu.
»Jeden Meter!« Paul grinste zurück und nickte zu Erwin hinüber, der, wie jeden Morgen, mit den ersten Zigaretten des Tages gegen reißende Hustenanfälle ankämpfte und gerade noch ein mattes »Gude« zuwege brachte. Dann stieg er in die Pedale.
Seine Laune hob sich schon am Ortsausgang, sobald er mit angehaltenem Atem durch die Ammoniakschwaden aus dem Schweineknast von Bauer Knöss gefahren war. Was hielt ihn in Klein-Roda? Gute Frage. Vielleicht die Katzen. Vielleicht die Rosen in seinem Garten, deren Duft sich im Sommer auf unnachahmliche Weise mit den Gerüchen des Landlebens vermischte, mit dem Geruch von Pferdeäpfeln und Kuhfladen auf heißem Asphalt, mit dem Duft von Johannisbeertorte, Mariannes Spezialität, mit dem Rauch von Erwins Zigaretten. Vielleicht, wahrscheinlich die Umgebung, die sanften Hügel der Rhön mit ihren bunten Hecken und Gehölzen, mit ihren mäandernden Bächen, die Windmühlen weit hinten am Horizont.
Paul spurtete den Feldweg hinunter, am Froschteich vorbei, aus dem bei günstigem Windstand im Sommer das vielstimmige Gequake und Gequarre bis zu seinem Haus drang. Er schaute zum Horizont. Nur langsam lichtete sich der verhangene Himmel. Vom Gehölz vor der kleinen Anhöhe rechter Hand wehte der Duft von blühenden Bäumen und Sträuchern herüber, von Schwarzdorn und Wildkirschen. Als er auf die Landstraße einbog, stieg eine Lerche vor ihm auf. Hinter Groß-Roda jagten zwei Krähen eine viel größere, beleidigt schreiende Gabelweihe. In Waldburg bremste er gerade noch rechtzeitig vor einer riesigen, goldbraunen Kröte, die sich hinkend über die Straße schleppte. Und nach der schönen, steilen, langgezogenen Anfahrt Richtung Rottbergen zog das Glücksgefühl auf, dessentwegen es ihn täglich aufs Rad trieb. Irgendwie war hier Heimat, hier, auf den Anhöhen und in den Tälern der hessischen Rhön.
»Guck nicht so blöd«, rief er dem Bussard zu, der auf einem Zaunpfahl an der Straße hockte und ihm mit starrem Blick entgegensah. Dann duckte er sich über den Lenker und ließ sich die steile Abfahrt hinunterfallen. Frieden. Wenigstens für heute.
Als er nach einer Stunde ins Dorf zurückgeradelt kam, stand der Lieferwagen von Jochen auf der Dorfstraße, fast direkt vor seinem Haus. Jochen kam zweimal die Woche mit Wurst und Käse, mit Brot und Sahne, mit Obst und Gemüse vorbei – für die Älteren im Dorf, denen der Weg zu seinem Tante-Emma-Laden in Groß-Roda zu weit war oder die nicht zu dem Supermarkt auf der grünen Wiese hinter Ottersbrunn fahren wollten. Die alte Martha mit ihrer weißen Mähne und den roten Bäckchen stand in der Schlange vor dem Verkaufswagen, die Kinder von den Beckers nebenan, Kevin und Carmen, hatten schrillfarbene Eislutscher in der Hand. Willi ließ sich von Jochen gerade ein Päckchen Tabak und die Bildzeitung reichen, Marianne redete auf Gottfried ein, und als Paul vor seinem Gartentor bremste, kam mit Gekläff Tröllers Terrier herangerast.
»Wirst du wohl?« Paul hob drohend den Zeigefinger. Er stellte das Rad ans Gartentor und gesellte sich zur Dorfversammlung auf der Straße. Jochen verkaufte das beste Brot weit und breit.
Alfred, der dünne, aufgeschossene Glatzkopf mit den tief eingegrabenen Falten zwischen Nase und Kinn, grüßte nicht, guckte ihn von der Seite an und brummelte Unverständliches. Bremer ignorierte ihn. Der alte Zausel war noch unerträglicher geworden, seit seine Frau kurz nach Neujahr gestorben war. »Ihr geht's da besser jetzt«, hatte Marianne nach ihrem Tod gesagt und wohl den Himmel gemeint, in den die Rosi gekommen sein mußte, wenn es nach dem Ausmaß ihres irdischen Leidens ginge.
Alfred war »die Hand ausgerutscht«, wie man im Dorf zurückhaltend formulierte – immer, wenn er einen zuviel getrunken hatte. Und das war immer öfter der Fall. Das ganze Dorf hörte und sah es, und zweimal waren Marie, die Frau von Gottfried, Ortsvorsteher Wilhelm und Marianne zum Dreiseitenhof der beiden gelaufen und hatten an die Haustür gehämmert und »Aufhören!« gerufen. Aber immer hatte Rosi am nächsten Tag »Er meint es nicht so« gemurmelt. Auch noch, als man ihr die Nase im Krankenhaus hatte richten müssen. Selbst noch, als der Ehemann ihr mit dem Schürhaken das linke Handgelenk gebrochen hatte. Natürlich nicht das rechte, das wäre ja unpraktisch gewesen. Rosi mußte schließlich noch arbeiten können.
Niemand mochte Alfred. Und dennoch gehörte er dazu, ebenso wie Martha, die Heilige und Irre des Dorfes, die den ganzen Tag über durch die Gegend lief oder radelte, immer in einer mehr oder weniger weißen Kittelschürze mit Rüschen dran, vom Schweinestall der Tröllers zum Backhaus, vom Zigarettenautomaten zum Friedhof, vom Friedhof wieder zu ihrer Wohnung in dem heruntergekommenen Hof am Ortseingang. Immer an Bremers Haus vorbei.
»Guten Tag, Herr Paul!« sang die alte Martha, schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und schickte ein breites Lachen direkt hinterher.
»Na, schon zurück?« Gottfried tätschelte den Kopf von Franz, seinem jungen Jagdhund, der zu ihm aufschaute.
Gottfried, dachte Bremer manchmal, hatte ihn adoptiert. Jedenfalls führte er sich wie eine gluckende Henne auf. Er wußte, wann Paul morgens aufstand und wie viele leere Weinflaschen er wöchentlich zum Glascontainer vor dem Dorfgemeinschaftshaus schaffte. Seine städtischen Freunde bewunderten Bremer dafür, daß er soviel Kontrolle so gelassen über sich ergehen ließ. Aber er genoß das. Für ihn war das Fürsorge.
»Gibt's was Neues?« fragte er Willi. Der schüttelte mit dem Kopf und kratzte sich hinter dem Ohr. »Vielleicht ist was in der Post.«
Fünf Minuten später bog die Post mit Tempo um die Ecke, in einem gelben Polo und in Gestalt von Ernst, dem Briefträger, der sein Auto vor dem Zigarettenautomaten zum Stehen brachte und mit einer Miene, die noch klassisches deutsches Amtsverständnis ausdrückte, ausstieg.
»Habt ihr wieder nichts zu tun?« Ernst blickte in die Runde. »Steht ihr wieder nur dumm rum und schwätzt euch das letzte bißchen Verstand aus dem Hirn?«
Des Postboten Humor war gefürchtet. Niemand verzog auch nur den Mund – nur Alfred lachte.
»Na wenigstens habe ich euch alle auf einem Haufen erwischt. Der Quelle-Katalog – Martha.« Ernst warf der alten Frau, die erschrocken die Hände hochriß, das schwere Päckchen zu. Gottfried fing den Katalog auf. Sein bitterböser Blick entging dem Postboten.
»Wieder die Rechnung nicht bezahlt, was?« Ernst hielt Marianne einen Briefumschlag hin, den sie wortlos entgegennahm.
»Wassn das? Pornokassetten?« Er wog das Päckchen abschätzend auf dem Handteller, bis Willi es ihm wegschnappte. »Irgendwann kriegst du dermaßen eine rein …« Ernst kannte das schon als leere Drohung und reichte ihm einen grauen Behördenumschlag gleich hinterher.
»Und von welcher Dorfjungfrau hast du dir einen Vaterschaftsprozeß anhängen lassen?« Der Briefträger wedelte mit einem edlen weißen Briefumschlag. Paul war gemeint, der plötzlich lachen mußte, ein unverzeihliches Versehen, wie ihm der strafende Blick von Marianne zu verstehen gab. Schuldbewußt guckte er zurück.
Ernst legte das Schriftstück mit spitzen Fingern auf einen Stapel anderer Briefe und Zeitungen, die aufgrund ihrer städtischen, ja multikulturellen Herkunft schon immer sein Mißtrauen erweckt hatten, und händigte Bremer den Papierhaufen mit heruntergezogenen Mundwinkeln aus. Der gediegen aussehende Brief, sah Paul zu seiner Verwunderung, kam aus Wingarten. Von der ersten Rechtsanwalts- und Notarskanzlei am Platz.
Als Willi eine Minute später wie ein Stier aufbrüllte, war Ernst schon in sein Auto gestiegen und verließ mit Fluchtgeschwindigkeit das Dorf. Für Details hatte er sich noch nie interessiert.
»Ich schieß sie ab! Ich mach sie alle!« Willi hielt den amtlich wirkenden Brief in der Hand und schäumte vor Wut.
»Wen?« Marianne versuchte, ihrem Mann über die Schulter zu gucken, der mit der linken Hand erregt auf das graue Papier einschlug.
»Was ist los?« fragte Gottfried.
»Um Himmels willen!« rief die alte Martha. Halb Klein‑Roda scharte sich um Willi, dessen Gesicht immer röter wurde.
»Sie wollen sie keulen!« Willi war heiser vor Empörung.
Die Highlander, dachte Paul. Es ist soweit. Die Nachbarn rückten näher an Willi heran, der noch immer mit dem grauen Blatt Papier wedelte – als ob sie ihn beschützen wollten.
»Ist das schon ausgemacht?« Ortsvorsteher Wilhelm sah es als Lebensaufgabe an, dem Hang der bäuerlichen Bevölkerung zu Selbstjustiz Schranken zu setzen. »Kann man noch Rechtsmittel einlegen?«
»Die sollen mir bloß kommen!« knurrte Willi. »Die knall ich ab!«
»Soll ich mit Pfetter reden?« Der junge Rechtsanwalt aus Ottersbrunn nahm jeden Auftrag an. Das mußte er auch, denn es gab nicht viele: Auf dem Land hielt man Anwälte für völlig entbehrlich.
»Das bringt doch nichts«, antwortete Willi.
»Der kostet doch nur.« Marianne hatte den Arm um ihren Mann gelegt.
»Sie haben doch keinem was getan!« Der alten Martha standen die Tränen in den Augen. Auch sie hatte Paul schon oft bei den kleinen zotteligen Rindern gesehen.
»So isses!« brummelte Erwin und spuckte in weitem Bogen aus.
Alle waren betreten. Sogar Kevin und Carmen machten ausnahmsweise mal den Eindruck, als ob sie zu Mitgefühl fähig wären.
»Ich mache einfach das Gatter auf und laß sie laufen!« sagte Willi. »Dann können die Hosenscheißer vom Veterinärsamt meine Tiere im Wald suchen gehen!«
»Das hält nicht lange.« Wilhelm guckte zweifelnd.
Und auch Gottfried schüttelte den Kopf. »Widerstand«, sagte er. »Wir müssen Öffentlichkeit herstellen.«
Flugblätter verteilen, Demonstrationen organisieren, Mahnwachen abhalten, ergänzte Paul im Stillen und ertappte sich bei einem leisen Grinsen. Gottfried sah zuviel fern. Es war höchst zweifelhaft, ob die Widerstandsformen der Stadt fürs Land taugten. Seine Nachbarn aber, stellte er mit ungläubigem Staunen fest, murmelten zustimmend.
»Also«, faßte Ortsvorsteher Wilhelm zusammen: »Pfetter stellt einen Eilantrag. Das ist das erste. Willi setzt sich mit allen betroffenen Züchtern in Kreis und Land in Verbindung. Wir brauchen Solidarität. Und drittens« – er hob die Augenbrauen und sah Paul Bremer ins Gesicht, der sich plötzlich irgendwie genierte im Kreise der Dorfgemeinschaft, mit seinen kurzen Fahrradhosen und dem schwarzen Windbreaker und den Fahrradhandschuhen an den Händen – »drittens wird Paul den Kontakt zur Presse herstellen.«
»Wir werden nicht kampflos aufgeben!« Gottfried schlug sich mit der rechten Faust schwungvoll in die linke Hand. Ortsvorsteher Wilhelm, klein, dürr, unscheinbar und penibel, nickte Paul zu.
Daß er einen direkten und besonders dicken Draht zu allen Zeitungsredaktionen und Fernsehstudios des Landes hätte, war eine Legende, die entstanden war, nachdem sein erstes Buch nicht nur in der lokalen Presse, sondern auch in jenem Münchner Nachrichtenmagazin freundlich gewürdigt worden war, das man in der Rhön dem Produkt aus Hamburg vorzog. Und als Gast bei zwei Talkshows hatte man ihn auch gesehen. Paul hatte es aufgegeben, den Irrtum zu korrigieren.
»Okay«, sagte er und tat weltläufiger, als er sich fühlte. »Ich denke, man kann da was machen.« Mit der Routine eines alten Werbeprofis spielte sein Hirn schon mal die knalligsten Schlagzeilen durch.
»Unsere Argumente sind die folgenden«, sagte er. »Erstens: Die Politiker versuchen, ausgerechnet an den ökologisch wirtschaftenden Bauern ein Exempel zu statuieren, nur um das Publikum zu beruhigen und der mächtigen Rindfleischlobby nicht in die Quere zu kommen.« David gegen Goliath – Journalisten liebten solche Storys.
»Genau!« Willi hatte offenbar völlig vergessen, daß er nicht nur neuerdings ein Vertreter der Ökobauern war, sondern seine 32 Mastschweine auf ziemlich herkömmliche Weise durch ihr kurzes Leben quälte.
»Zweitens würde mit den Highlandern eine wichtige Genreserve für die Rinderzucht beseitigt.« Paul hatte das heute morgen in der Zeitung gelesen. »Und ein neuer landwirtschaftlicher Zweig, die extensive Rinderhaltung, würde nachhaltig ausgemerzt.« Martha applaudierte laut, obwohl er hätte wetten können, daß sie kein Wort verstanden hatte.
»Und drittens: Es geht nicht um ein Einzelschicksal.« Ihm entging nicht das selige Lächeln auf Willis Gesicht. »Sondern um das Überleben einer Kultur, einer Lebensphilosophie, einer Lebensform der Zukunft.«
Marianne nickte. »Genau«, sagte sie.
»Ein ganzes Dorf im Widerstand – die Geschichte werden sie uns aus der Hand fressen«, behauptete Paul mit einer Überzeugung, die er sich selbst nicht ganz abnahm. Es würde sehr schwer sein, die kleine, bunte Herde von Bauer Willi Kratz aus Klein-Roda gegen die Stimmung im Lande zu verteidigen. Die Angst vor Rinderwahnsinn war im Zweifelsfall größer.
Aber das »Dorf im Widerstand« – seine Nachbarn – klatschte begeistert Zustimmung. Hoffentlich geht das alles gut, dachte er und schob das Fahrrad durchs Gartentor. Im Vorübergehen registrierte er, daß das Geißblatt am Zaun Blattläuse hatte, brachte das Rad in den Schuppen, schloß die Haustür auf, warf den Stapel Post auf den Küchentisch und ging nach oben ins Bad duschen.
Den Brief aus Wingarten hob er auf bis zuletzt, nachdem er einen Espresso gekocht, die restliche Post durchgesehen und die Zeitung zur Seite gelegt hatte. Auch als er den Brief schließlich in der Hand hielt, den schweren weißen Umschlag mit der altertümlichen Handschrift und dem eingravierten Absender, zögerte er noch. Die Erinnerung an damals überfiel ihn mit einem ziehenden Schmerz in der Herzgegend. Er hatte so lange nicht mehr an Wingarten gedacht, daß ihn seine Reaktion überraschte. Was tat so weh? Die verlorene Jugend? Oder ihre Schrecken, weshalb man eigentlich froh sein mußte, daß sie vergangen war?
Schließlich öffnete er das Kuvert so ungeschickt, daß er es fast zerfetzt hätte. »Was ist denn los, Mann?« murmelte er und zog den Briefbogen aus dem zerrissenen Umschlag. Schweres, wohlanständiges Kanzleipapier. Vorsichtige, umständliche Juristensprache. Der Absender war die Kanzlei Dinges, Lamberti und Zapp – Grabenstr. 35. Wingarten am Rhein.
Er las den Brief zweimal. Man erlaubte sich die höfliche Anfrage, ob sein Weg ihn bald einmal nach Wingarten führe. In diesem Fall bitte man um einen Besuch. Sollte er sich einverstanden erklären, seien zwei Weinberge auf seinen Namen ins Grundbuch einzutragen. »Bischofsberg«, 1,6 Hektar groß. Und »Rosenpfad«, ganze 0,8 Hektar.
Schöne, prächtige Steilhanglagen, dachte Bremer. Wunderbare, große Rieslinge. Er griff zur Espressotasse und hatte plötzlich den Duft und den Geschmack von Wein in Nase und Mund. Er kannte diese Weinberge, er kannte, glaubte er plötzlich, noch immer jeden Zentimeter der steilen Hänge am Berg über dem Fluß, jeden Rebstock, zu jeder Jahreszeit. Er sah die Nebel aus dem Wasser des Rheins aufsteigen, abends, wenn es schon kühl wurde, und morgens, wenn die Sonne noch nicht kräftig genug war, um die feuchte Luft zu erwärmen. Er sah die Farbe des Schieferbodens vor sich, helles Ocker, wenn es trocken war, kräftiges Rostrot, wenn es geregnet hatte. Er erinnerte sich genau, wie sich der Matsch anfühlte, zu dem der Boden in regenreichen Herbstmonaten wurde, er war schließlich oft genug ausgerutscht und auf den Knien gelandet bei der Weinlese. Er hatte in der Nase, wie die Trauben rochen, die frischen, gesunden und die schon leicht angefaulten.
Er hörte, wie die Lesearbeiter leise miteinander sprachen, wie die Legelträger keuchend und schwankend den Berg hinaufstapften und ihre auf den Rücken geschnallten Gefäße in die großen Holzbütten auf den Lesewagen entleerten. Er spürte den Geschmack von Weck, Worscht und Bubbes auf der Zunge, die Mittagsmahlzeit, die Evchen während der Lese pünktlich um zwölf auf den Berg schleppte. Er erinnerte sich an klamme, eiskalte Hände, mit denen er hoch auf dem Wagen die gelesenen Trauben nachsortierte: die einwandfreien links, die weniger guten in den großen Bottich rechts. Er hörte all die anderen Winzer geräuschvoll ihre Traktoren anwerfen und mit den vollen Wagen zu Tal fahren. Und er sah den alten Wallenstein vor sich, wie er mit feierlicher Miene die Öchslegrade der einzelnen Lesefuhren verkündete. »Rosenpfad« war seine Spitzenlage gewesen.
Bremer griff zum Telefon und wählte die Nummer, die ihm sein Gedächtnis nannte, ohne daß er groß nachdenken mußte. Die Stimme, die sich nach mehrmaligem Läuten meldete, war ihm vertraut, auch wenn sie brüchig klang, ein bißchen dünn, ein bißchen langsam.
»Was machst du für einen Quatsch, du alter Dickkopf?« fragte Paul, dem die Rührung fast die eigene Stimme verschlagen hätte.
Der alte Mann lachte. »Immerhin rufst du mich endlich mal wieder an!«
Bremer spürte, wie sein Gesicht heiß wurde vor Scham. Er hatte sich viel zu lange nicht mehr um seinen Großonkel Frieder Wallenstein gekümmert. Hatte immer mal angerufen, das schon. Und geschrieben, zu Weihnachten oder zum neuen Jahr. Wie man das eben so machte. Aber er war, seit er aufs Land gezogen war, nicht mehr nach Wingarten gefahren. Man hatte sich aus den Augen verloren.
»Es tut mir leid«, sagte er.
Der alte Mann lachte wieder. »Das ist Zeitverschwendung.« Listig fügte er hinzu: »Aber wo du schon anrufst: Wann kommst du?«
»Ist das Haus noch nicht über dir zusammengefallen?« fragte Paul. »Was macht Evchen? Lebt Zigeuner noch?«
Das alte, verwinkelte Wallensteinsche Haus in Wingarten hatte knarzende Dielen und knackende Balken gehabt, zwei große Räume im Erdgeschoß und viele enge Kammern im ersten Stock. Es roch nach Bohnerwachs, nach Staub und nach Wein und im Frühjahr nach den Blüten des Pflaumenbaums vor dem Zimmer, in dem Paul sich eingerichtet hatte. Es gab eine Remise hinter dem Haus, in der, wenn die Sonne schien, das alte Gebälk ächzte und stöhnte; in der eine Kutsche aus dem vorigen Jahrhundert stand und eine ausrangierte Kelter. Dort duftete es nach Heu und Sägemehl. Das war Wallensteins Werkstatt, in der er sägte, hobelte und schnitzte.
Mit Zigeuner II, dem schwarzweißen Mischlingsrüden, den Wallenstein nach seinem Vorgänger getauft hatte, war Paul durchs Haus getobt, durch die Remise, durch den Garten, in die Weinberge hoch und wieder runter zum Rhein. Viele Sommer und viele Winter. Damals, nachdem seine Mutter gestorben war und sein Vater ihn nicht hatte bei sich behalten wollen. Er merkte, wie ihm ein saurer Geschmack in den Mund stieg. Es tat immer noch weh, nach all den Jahren. Er hatte es vergessen wollen. Und den alten Mann gleich mit dazu. Was ungerecht war – denn ihm verdankte er, daß die schlimmsten Wunden heilen konnten.
»Was macht dein Keller?« Unter dem alten Haus hatte sich ein dunkler, feuchter und immer etwas säuerlich riechender Keller erstreckt, ein Ort der Wunder, in dem es aus großen Fässern geheimnisvoll blubberte und quakte und in dessen spinnwebenverhangenen Nischen matt schimmernde Flaschen lagerten.
»Der vorletzte Jahrgang war hervorragend.« Wallensteins Stimme klang plötzlich enthusiastisch. »Keine großen Mengen. Aber was für eine Substanz! Der letzte – na ja. Wenn uns die Trockenschäden an den Steilhängen erspart geblieben wären …« Das letzte Jahr hatte mies angefangen und, mit zwei Sonnenmonaten, grandios geendet. Für die normalerweise begünstigten Steilhanglagen konnte das gefährlich werden.
Bremer schloß die Augen. Während der alte Mann erzählte, schossen ihm die Bilder durch den Kopf. Wallenstein im Februar im Wingert, Temperatur: schneidend kalt, wie er leicht vornübergebeugt am steilen Hang stand und mit rotgefrorenen, knotigen Fingern seine Rebstöcke auf einen Trieb zurückschnitt, den er dann im runden Bogen an den Draht band, der zwischen den Reihen gespannt war. Wallenstein beim Unkrautjäten und Bodenlockern im Sommer. Wallenstein in den Tagen vor der Lese, in denen er unruhig durch die Weinberge wanderte, immer wieder nach dem Wetter guckte und mit dem Refraktometer die Öchslegrade seiner Trauben ermittelte. Und Wallenstein im Keller, in seinem Weinkeller, mit dem Meßzylinder in der einen und der Senkwaage in der anderen Hand, beim Bestimmen des Mostgewichts des jungen Weins. »Die Arbeit im Wingert ist Gottesdienst«, pflegte der Winzer zu sagen. Und: »Wer säuft, sündigt. Wer trinkt, betet.«
Frieder Wallenstein mußte mittlerweile an die Achtzig sein, durchfuhr es Paul, als er merkte, wie der Mann, mit dem er telefonierte, langsamer wurde und nach Worten suchte.
»Geht es dir gut?« Plötzlich war er besorgt.
Der alte Herr hüstelte. »Wie man's nimmt. Die alten Knochen werden nicht jünger. Und« – fügte er nach einer kleinen Pause hinzu – »der Wein schmeckt auch nicht mehr wie früher.«
»Das ist bei Gott kein gutes Zeichen«, sagte Paul.
»Bei Gott nicht.« Wallenstein lachte auf.
Von seinem Großonkel hatte Paul Bremer das Weintrinken gelernt. Im Alter von vierzehn Jahren – »gerade richtig«, hatte Onkel Frieder damals gesagt, »um mit den guten Dingen des Lebens zu beginnen«. Seither hatte sich jeden Tag in den dunklen Monaten des Jahres – und nicht sehr viel seltener zu anderen Jahreszeiten – um fünf Uhr nachmittags das gleiche Ritual abgespielt.
»Mal gucken, was er heute sagt«, hatte Wallenstein verkündet, wenn die Uhr im Wohnzimmer fünf geschlagen hatte, und Paul mit einem Kopfnicken zur Vitrine hin daran erinnert, daß es zu seinen Aufgaben zählte, zwei Gläser aus dem Schrank zu holen, noch einmal mit dem Geschirrtuch abzuwischen, auf ein Tablett zu stellen und mitzunehmen. Wallenstein griff sich den Kellerschlüssel, die Schachtel mit den Streichhölzern und, wenn nötig, frische Kerzen. Dann ging er voraus in den Flur, an der Küche vorbei bis zur graugestrichenen, grob gezimmerten Kellertür, dann eine steile, schmale Treppe hinunter zum Keller, dem alten Kreuzgewölbe, Winzers Keller seit Ohms Zeiten.
Der Alte atmete jedesmal tief ein, wenn er auch die schwere Tür unten mit dem großen Schlüssel aufgeschlossen und weit aufgesperrt hatte. »Riechst du das, Paul?« fragte er – jedesmal. Es roch nach Wein, nach Wein in den Wänden, nach Wein im kiesbestreuten Boden, nach dem Wein in den Fässern, es war Wein in der Luft. Paul hatte diesen scharfen, sauren Geruch bald lieben gelernt – es mußte so riechen in einem ordentlichen Weinkeller, zumal bei einem Winzer, der den ersten Schluck aus dem Faß den Göttern opferte. Er hatte mal geschätzt, wie viele Liter in fünf Jahrzehnten wohl zusammengekommen waren, wenn man diesen täglichen Tribut zusammenrechnete. Es war eine solche Menge, daß es die Götter einfach gnädig stimmen mußte.
Wallenstein zündete als erstes die Kerzen an, die in zwei Kandelabern am Kopfende eines langen Ganges standen, in dem die behäbigen Halbstückfässer hockten. Dann schritt er die Parade ab: streichelte das Faß mit dem trockenen Riesling, hob die Brille von der Nase, um zu gucken, was er über den Reifeprozeß der Spätlese mit Kreide auf der Vorderseite des Fasses notiert hatte, und murmelte dem kleinen Fäßchen Beerenauslese Koseworte zu. Paul hatte das zuerst verlegen gemacht, dann fand er es ein bißchen komisch. Später hatte er das Ritual genossen.
Nach der Begrüßung seiner Lieblingsfässer hob Wallenstein den dünnen roten Schlauch vom Haken an der Wand über dem Wasserhahn und zog den Gärspund oben aus dem Faß mit dem Hauswein. »Immer von unten nach oben trinken, Paul!« hatte er dem Jungen eingeschärft. »Wer den besseren vor dem einfachen Wein trinkt, weiß den nicht mehr zu schätzen. Und das wäre schade: Auch der einfache Wein hat seine Zeit – und seine Gelegenheit.«
Dann führte er den Schlauch in das Spundloch ein, saugte einmal kurz und kräftig an und preßte den Schlauch mit zwei Fingern zu. Dieser, der erste Schluck, den der Winzer durch den Mund wandern ließ, von der rechten zur linken Wange, und mit gespitzten Lippen kräftig durchkaute, landete auf dem Boden vor dem Faß. Dann winkte er mit der Hand, in der er den Schlauch hielt, Paul heran, der ihm die zwei Gläser hinhielt. Wallenstein ließ drei Fingerbreit Wein hineinlaufen – in seines, in Pauls Glas nur zwei.
»Vielleicht schmeckt mir der Wein ja in deiner Gegenwart wieder«, sagte die Stimme am Telefon.
Bremer lachte. »Überredet.« Und plötzlich spürte er, daß er sich nach dem alten Wallenstein sehnte. Und nach dem duftenden, kühlen Weinkeller. Und daß er endlich wieder den dummen, blöden, wunderbaren Spruch hören wollte: »Mal gucken, was er heute sagt.«
Mit diesem Satz hatten bei ihrer Kellerbegehung beide das Glas gehoben, der alte Mann und der Junge, einander gegenüber, die linke Hand auf den Rücken gelegt, das Glas in der rechten Hand, und es dann gegen das Licht gehalten, das die blaßgoldene Farbe des Rieslings schimmern ließ. Mit dem abwesenden Blick, der Konzentration verriet, hielten beide ihre Nasen ins Glas, schwenkten den Wein, rochen wieder daran und setzten dann, immer zugleich, das Glas an: erst Schlürfen, dann Kauen und schließlich Schlucken.
Es war wie ein Tanz, die tägliche Weinprobe mit Großonkel Wallenstein, ein Menuett, eine strenge Zeremonie. So hatte Paul gelernt, wie ein Wein sich langsam verändert, wenn er von Traubenmost zu Trinkreife übergeht. Im Weinberg und im Keller hatte er begriffen, was ein großer und was ein schlechter Jahrgang ist. Was eine gute von einer nicht ganz so guten Lage unterscheidet. Und wie ein großer alter Riesling schmecken kann, wenn er nach zwanzig Jahren auch den letzten Rest aggressiver Säure abgebaut hat und ein reiches Bukett mit einem sanften Botrytiston aus dem Glas hervorsteigt, jener Edelfäule, für die der Rheingauer Riesling weltberühmt ist.
Ein Anfall von tiefer Zuneigung zu dem alten Mann überkam Paul – zugleich schämte er sich, daß er ihn so lange vernachlässigt hatte.
»Wollen wir wieder in den Keller gehen«, fragte er leise, »und gucken, was er sagt?«
Frieder Wallenstein klang ebenso gerührt. »Komm, Paul«, sagte er mit unmerklich zitternder Stimme, »ich brauch dich.«
Einige Stunden später, genauer gesagt um Punkt 17 Uhr, beschloß Bremer, eine seiner besten Flaschen auf den alten Herrn zu öffnen »mal gucken, was er sagt!« murmelte er, als er erst den Kapselschneider und dann den Korkenzieher ansetzte. Mit leicht geneigtem Kopf stand er schließlich vor der Haustür, hielt das Glas in der Hand, wie er es gelernt hatte – mit Daumen und Zeigefinger am Boden –, steckte seine Nase hinein, schlürfte, kaute, ließ den Wein die Kehle herunterrinnen und sagte nach dem zweiten Schluck: »Halt durch, alter Knabe. Ich komme.«