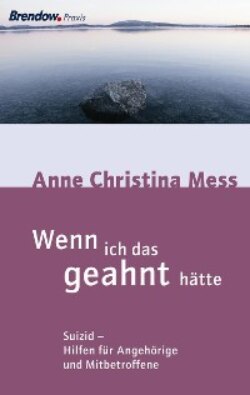Читать книгу Wenn ich das geahnt hätte - Anne Christina Mess - Страница 18
Soziologische Theorien
ОглавлениеAuch innerhalb der soziologischen Theorien war es ein Franzose, den man als Vorreiter in der Ursachenforschung bezeichnen kann. Der Soziologe Emile Durkheim publizierte sein Werk »Le Suicide« als epochales Werk innerhalb der Epidemiologie des Selbstmords bereits 1897. Vor nunmehr über hundert Jahren sammelte er als Erster die Todesursachen-Statistiken verschiedener Länder. Er legte für die Hypothesen seiner soziologischen Theorien die unterschiedliche Verteilung der Todesursachen und damit auch der Selbstmorde zugrunde. Zusammenfassend soll es im Hinblick auf die Praxisorientiertheit dieses Buchs genügen, Durkheims Einteilung der Suizide zu benennen: Er vermutete, dass es aufgrund der nicht geglückten Anpassung des Individuums an die jeweilige Gesellschaft zu Selbstmord kommen kann. Er meinte ferner, dass die Individuation eines Menschen weder zu schwach noch zu stark sein darf, damit die Anpassung des Individuums an die Gesellschaft gelingt. So könne es dann zu altruistischen Suiziden einerseits oder aber egoistischen Selbstmorden andererseits kommen. Seine Einteilung umfasst zudem die fatalistischen Suizide, die aufgrund zu enger Normen begünstigt würden, und die anomischen Selbstmorde als Folge zu weiter oder unbestimmter Normen. (Kritiker dieser hier nur kurz angeschnittenen Theorien weisen allerdings zahlreiche Gegenbeispiele nach.)
Die Überlegung Durkheims, dass auch soziale Faktoren bei der Entstehung der Suizidalität eine Rolle spielen, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. In diesem Zusammenhang werden auch heute noch soziale und soziologische Faktoren erforscht wie: Völker oder Staaten, rassische, religiöse oder örtliche Gegebenheiten usw. Last but not least ist auch die Familie als kleinste soziologische und soziale Einheit ein wichtiges Mosaiksteinchen im Gesamtgefüge der Erklärungsansätze für Suizid. Es ist hierbei z. B. keinesfalls unerheblich, ob ein Mensch in einer gewalttätigen Familie aufwächst oder einen konstruktiven Umgang mit Aggressionen lernt.
Zu den soziologischen Theorien gehört auch die Imitationshypothese, die unter leicht variierenden Namen von verschiedenen Forschern untersucht wurde:
Kreitman et al. (1969) sowie Welz (1979) stellten fest, dass Suizidversuche gehäuft im Freundes- und Bekanntenkreis betroffener Familien sowie in bestimmten Straßenzügen zu finden seien, und prägten den Begriff der Imitationshypothese. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Schmidtke und Häfner (1986). Welz (1979) vertritt die Ansteckungshypothese und Philips (1974) formuliert die Suggestionshypothese. Allen drei Hypothesen ist gemeinsam, dass das suizidale Verhalten eines Modells (Vorbilds) nachgeahmt wird. Das imitierende Individuum bringt dabei bestimmte Voraussetzungen mit: seine (präsuizidale) Persönlichkeit, unzureichende Problemlösefertigkeiten in Lebenskrisen sowie länger andauernde soziale Belastungen und eine hohe Suggestibilität, also eine starke soziale Beeinflussbarkeit. Es sind folglich bestimmte Persönlichkeitsanteile und Verhaltensweisen, die ein Mensch mitbringen muss, um sich von einem Vorbild zur Nachahmung des Selbstmords anstecken zu lassen.
Beispiele für dieses Lernen am Modell, d. h. am Vorbild, finden sich nach der Veröffentlichung von Goethes Werk »Die Leiden des jungen Werther« und nach der Ausstrahlung der TV-Sendung »Tod eines Schülers« in acht Folgen im Jahre 1981. In beiden Fällen folgte eine Suizidwelle unter der jeweiligen Bevölkerung. Forschungen in Bezug auf die Fernsehserie kamen zu interessanten Ergebnissen:
Die Suizidrate stieg insbesondere bei den Menschen an, die dem Hauptdarsteller, der sich in suizidaler Absicht vor einen Zug geworfen hatte, am stärksten ähnelten. Es gab somit eine vorübergehende Zunahme der Suizide bei männlichen Jugendlichen im Alter von 15 – 19 Jahren, und auch die Wahl der Selbstmordmethode während und nach dem Sendezeitraum wurde deutlich stärker zugunsten des Springens vor einen Zug gefällt. Es liegt nahe anzunehmen, dass der durch die Fernsehsendung ausgelöste Suizidanstieg niedriger ausgefallen wäre, wenn sie andere Auswege für den Schüler aufgezeigt hätte und der Suizid mehr abschreckende Elemente enthalten hätte.5
Ehe Sie weiterlesen, lade ich Sie ein, innezuhalten und wahrzunehmen, was Sie beim Lesen der letzten Textpassagen empfunden haben.
Wahrnehmungsübung: Umgang der Medien mit Suizid
Was denken und fühlen Sie, nachdem Sie die Passagen über die Nachahmung von Selbstmorden gelesen haben? (Fühlen Sie sich hilflos, ärgern Sie sich, auf wen sind Sie evtl. wütend, bekommen Sie Angst?)
Möchten Sie etwas tun im Zusammenhang mit dem Umgang der Medien mit dem Thema Suizid? Falls ja, was und wann und evtl. mit wem zusammen?
(Sie finden dieses Arbeitsblatt Nr. 3 auch im Internet unter www.acmess.de.)