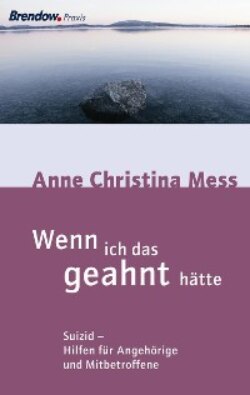Читать книгу Wenn ich das geahnt hätte - Anne Christina Mess - Страница 7
ОглавлениеKAPITEL 1
Was löst ein »gelungener« Suizid bei Hinterbliebenen und Helfern aus?
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) geht davon aus, dass jeder Suizidtote 5 bis 7 Angehörige hinterlässt. Dies sind Menschen, die – zumeist unerwartet – vor der Aufgabe stehen, eine schmerzliche Lücke in ihrem realen Leben, aber auch oder insbesondere in ihrem Seelenleben schließen zu müssen. Jährlich sind allein in Deutschland etwa 60 000 bis 80 000 hinterbliebene Menschen direkt von dieser Todesart betroffen. Unberücksichtigt bleiben dabei größere Personengruppen wie Mitarbeiter von Firmeninhabern, die sich aus finanzieller Not heraus vor einen Zug werfen und damit ihre Belegschaft hinterlassen. Aber auch Vereinsfreunde, Nachbarn und andere Gruppen mit mehr Distanz zum Verstorbenen werden durch seinen Suizid von Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit und Trauer getroffen.
Bei dieser (geschätzten) Zahl von 60 000 bis 80 000 Menschen, die jährlich von Suizid betroffen werden, ist zu berücksichtigen, dass sich diese Zahl nur auf ein Jahr bezieht. Nicht-Betroffene gehen meist davon aus, dass die Trauer nach einem Suizid in ähnlichen Bahnen verläuft wie bei anderen Todesarten. Auch von Suizidtrauernden wird erwartet, dass nach dem Ablauf des ersten Trauerjahres eine Veränderung eintritt und die Normalität des Alltags sich wieder einstellt. Aber Trauer nach Suizid kann auch ein Jahr nach dem Tod ähnlich heftig erlebt werden wie direkt in den Tagen nach dem Suizid. Die tatsächlich vergangene Zeit muss dabei kein Maßstab sein.
Der Schmerz und die Trauer um einen durch Selbsttötung verlorenen nahestehenden Menschen kann sogar über viele Jahre hinweg ein lebensbestimmendes Thema bleiben. Die starke Einschränkung der eigenen Lebensqualität durch den Verlust dauert bei manchen Hinterbliebenen bis zum eigenen Tod an.
Jeder Todesfall ist mit Kummer und Trauer für die Hinterbliebenen verbunden. Allerdings hat die Art des Todes einen wesentlichen Einfluss auf die Trauer und die Lebensgestaltung der Menschen, die ohne den Verstorbenen weiterleben müssen. Bei Tod durch Suizid drängen sich den Hinterbliebenen Fragen und Gefühle auf, die bei anderen Todesarten gar nicht oder nur abgeschwächt vorhanden sind. Sie erschweren die Trauer manchmal unsagbar. Je nachdem, wie ein Hinterbliebener mit diesen inneren Dialogen umgeht, versucht er, sie für sich zu verarbeiten, oder aber sucht sich Hilfe bei der Bewältigung. Im Gespräch mit Trauernden finden sich typische Gedanken, Selbstzweifel, Schuldgefühle usw. Sie können bei den einzelnen Suizidtrauernden in individueller Ausprägung und in unterschiedlichem zeitlichen Abstand vom Tod auftreten. Häufige Inhalte der inneren Dialoge sind Schuldgefühle: Eine Mutter könnte sich sagen: »Ich muss eine schlechte Mutter gewesen sein.« Auch Versagensgedanken finden sich oft bei Hinterbliebenen von Suizidtoten: »Ich konnte es nicht verhindern, ich habe es nicht bemerkt.« Ein Suizid kann bei einem nahestehenden Menschen einen Einbruch des Selbstwertgefühles herbeiführen: »Ich bin es nicht wert, dass mein Mann meinetwegen weiterlebt.« Im Rückblick über das bisherige Leben kann dies nun infrage gestellt werden: »Hat er mich und die Kinder überhaupt wirklich geliebt?« Manche Suizidtrauernde schlagen sich mit Scham und Verleugnung herum: »Niemand darf erfahren, dass meine berühmte Frau sich das Leben genommen hat.« Zu ganz normalen Reaktionen bei Menschen, die einen Suizid zu verarbeiten haben, gehören Wut oder Ärger auf den Verstorbenen: »Wie konnte er mir das antun?!« Leider verlieren manche Menschen in der Folge eines Suizids eines ihnen sehr nahestehenden Menschen ihren inneren Halt im Leben und fragen sich: »Wie soll ich damit weiterleben«, um sich später selbst zu suizidieren.
Weitere Erschwernisse in der Trauerarbeit sind oft die Reaktionen des Umfeldes von Hinterbliebenen. Der Tod durch Suizid ist auch im Zeitalter der Postmoderne vielerorts noch ein gesellschaftliches Tabu. Es wird entweder nicht darüber gesprochen oder aber man weiß nichts dazu zu sagen. Möglicherweise hat dieses Tabu seine Wurzeln auch in der jahrhundertelangen Tradition, Selbsttötung als Todsünde zu verurteilen. Diese Verurteilung geht zunächst einmal hinweg über die tiefe Verzweiflung eines Menschen, der sich das Leben nimmt, und beeinflusst im nächsten Schritt manchmal noch die distanzierte Haltung gegenüber den Trauernden. Etwas polarisierend zum Zwecke der Verdeutlichung lässt sich sagen, dass Trauernde einen Mitleidsvorschuss haben und demgegenüber Suizidtrauernde einen Schuldvorschuss.
Durch diese gesellschaftliche Tabuisierung und durch mangelnde Information kommt es oft zu Unsicherheit im Umgang mit den Hinterbliebenen und zur Vermeidung des Themas. Suizidtrauernde sehen sich häufig von einer »Mauer des Schweigens« umgeben, was ihnen ihr Trauertal unnötig erschwert.