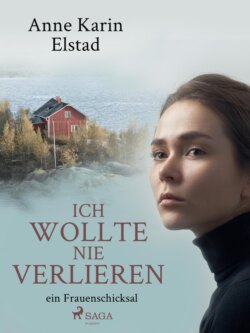Читать книгу Ich wollte nie verlieren - ein Frauenschicksal - Anne Karin Elstad - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Wochen vergehen rasend schnell, Wochen mit vielen Überstunden, Fahrten nach Oslo, Korrektur der Aufgaben, sie hat keine Zeit, an die eigenen Sorgen zu denken. Ab und zu fällt ihr wieder ein, daß sie bald ihre Menstruation bekommen müßte, aber die Wochen vergehen, und sie beginnt zu hoffen, daß es vielleicht endgültig überstanden ist. Aber dann, mehr als sieben Wochen nach der Menstruation, stellt sie sich wieder ein. Da ist das drückende Gefühl, als wäre der Körper aufgebläht, die Depression, die Abgespanntheit, aber jetzt tröstet sie sich damit, daß sie die Tabletten hat. Von nun an wird nicht mehr der unberechenbare Körper über sie bestimmen. Jetzt ist sie es selber – unterstützt von den Tabletten –, die über ihren Körper herrschen wird.
Endlich ist es soweit. Maria sitzt am Küchentisch beim Abendbrot. Anders ist fortgegangen, Fredrik nimmt an einem Seminar teil, im Haus ist es still. Vor ihr auf dem Tisch liegt die Tablettenschachtel. Gespannt, fast mit dem Gefühl, eine rituelle Handlung zu vollziehen, nimmt sie die runde Scheibe mit den Pillen aus der Packung. Betrachtet sie, lange. Elf weiße und zehn braune Tabletten, jede liegt für sich in ihrem kleinen Hohlraum. Sie nehmen sich winzig und harmlos aus. Ihre Hände zittern wohl sogar ein wenig, als sie den gummierten Merkzettel mit den Wochentagen auf die Rückseite klebt. Beginn: Montag. Aufmerksam liest sie die Gebrauchsanweisung. Die weißen Pillen soll sie zuerst nehmen, danach die braunen, eine pro Tag zur selben Zeit. Anschließend sieben Tage Unterbrechung, während dieser Zeit soll sie eine »menstruationsähnliche Blutung« bekommen, und dann folgen erneut einundzwanzig Tage mit Tabletten. Das erscheint fast zu einfach.
Von Nebenwirkungen ist nichts erwähnt. Nur ein genereller Hinweis: »Falls sich innerhalb der sieben tablettenfreien Tage keine Blutung einstellt, müssen Sie Ihren Arzt aufsuchen. Sollten Sie spezielle Beschwerden bekommen, ist unbedingt Ihr Arzt zu konsultieren.« Welche Beschwerden, davon steht nichts da.
Noch zögert sie etwas. Es ist gehupft wie gesprungen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt sich Maria. Jetzt wird alles gut werden, keine Beschwerden mehr, und sie schluckt die erste Pille. Dann legt sie die Scheibe in den Kräuterkorb auf dem Tisch, so daß sie nicht vergißt, die Pillen regelmäßig zu nehmen.
Danach markiert sie das Datum in ihrem Terminkalender mit einem großen Kreis und notiert: »Mit den Pillen begonnen!« Es ist Montag, der 10. November 1986.
In dieser Zeit hat Maria ein Gefühl, als befände sie sich auf einem Karussell, das immer schneller rast und von dem sie nicht abspringen kann. Erneut eine Fahrt nach Oslo, weitere Aufgaben, die korrigiert werden müssen, auf ihrem Schreibtisch im Büro türmen sich die Akten zu endlosen Stößen – in der Mehrzahl dringende Fälle, die von Mal zu Mal ausgesetzt werden müssen.
Eines Tages ruft Åse Holte an. Ihr Sohn sei wieder zu Hause. Sie verabreden, daß Åse mit ihrem Jungen heute nach der Arbeit zu Maria kommt. Das ist eine Angelegenheit, die man nicht aufschieben kann, deshalb muß sie Überstunden machen, auch heute wieder.
Am Ende des Tages ist Maria todmüde, während sie auf die beiden wartet. Mit jedem Tag, der vergeht, spürt sie, daß sie mehr und mehr ihre körperlichen Reserven aufbraucht. Denkt, daß es nicht mehr lange so weitergehen könne. Für einen Moment kommt ihr der Gedanke, daß sie sich krankmelden müßte, sie verwirft ihn aber gleich wieder. Bei der Unterbesetzung, die sie ohnehin schon haben, würde das eine zusätzliche Belastung für die übrigen Kollegen bedeuten. Solange sie sich noch auf den Beinen halten kann, ist das mit ihrem Gewissen nicht zu vereinbaren. Außerdem würde es auch nicht viel nützen, lediglich dazu führen, daß sich der Aktenstoß auf ihrem Schreibtisch noch höher türmt. Doppelte Arbeit, wenn sie wieder zurück ist. So etwas ins Auge fassen, hilft nichts.
Åse Holte sieht abgespannt aus. Sie ist noch magerer als früher, das Gesicht spitz und voller Sorgenfalten. Während Maria das registriert, ist sie von der Veränderung des Jungen zutiefst erschüttert. Seit seine Mutter sie das letzte Mal aufgesucht hatte, war er die ganze Zeit verschwunden gewesen. Es ist deutlich zu sehen, daß er auf Tour war. Mitleid erfaßt sie. Über die Wangenknochen in seinem Gesicht spannt sich die Haut trocken und kreideweiß, fast durchsichtig. An den Schläfen zeichnet sich ein blaues Netz von Adern so deutlich ab, daß es aussieht, als lägen sie auf der Haut. Die langen, verwilderten Haare kräuseln sich schweißnaß über der Stirn.
Kein einziges Mal sieht er sie an. Folgsam, fast apathisch unterschreibt er die notwendigen Papiere. Als sie sagt, daß er jetzt vielleicht versuchen solle, zu Hause zu bleiben, um sich in den folgenden Wochen, während er auf einen Platz in einer Gruppe warten müsse, auszuruhen und zu erholen, nickt er nur. Das gibt ihr den Mut weiterzugehen. Sie schlägt vor, einen Arzttermin für ihn zu bestellen. Vielleicht sollten sie es mit Methadon versuchen. Der Wutanfall, den sie darauf erwartet hätte, bleibt aus. Er nickt nur, stumm.
Für einen Augenblick hat sie das Gefühl, daß hier etwas vollkommen falsch läuft. Sie sieht doch die Unruhe in diesem schmächtigen Körper, den Blick, der im Zimmer umherirrt. Erleichterung aber gewinnt die Oberhand. Mit Methadon haben sie es unter ärztlicher Aufsicht schon früher einmal versucht, ohne sonderlichen Erfolg. Die letzten Jahre hat er es abgelehnt, wütend protestiert, wenn sie darauf zu sprechen kam. Jetzt sieht es aus, als hätte seine Mutter recht. Er ist tatsächlich für eine Behandlung motiviert.
Maria bemerkt die ersten Anzeichen von Migräne. Vor ihren Augen beginnen helle Streifen zu tanzen. Sie spürt, daß sie intensiver mit ihnen sprechen müßte, aufmunternder, aber sie schafft es nicht, kann nicht mehr. Sie schaut auf die Uhr. Das registriert Åse Holte sofort und erhebt sich.
Als sie gegangen sind, sucht Maria in ihrer Tasche nach Kopfschmerztabletten. Verdammt, sie hat sie zu Hause liegengelassen. Schnell notiert sie sich auf einem Zettel, daß sie morgen früh für Stein einen Arzt anrufen will, legt ihn oben auf den Aktenstoß. Ihre Furcht vor Ärzten ist wie weggeblasen, sobald es sich um andere handelt. Wenn es um ihre Kinder ging, als sie klein waren, wenn es sich um Klienten handelt oder andere, die Hilfe suchen, dann hat sie keine Angst. Dann kann sie wie eine Löwin kämpfen, um das durchzusetzen, was sie sich vorgenommen hat. Geht es dagegen um ihre eigene Person, wird sie zum Hasenfuß.
Sie legt sich auf die Couch, schließt die Augen. Nur um abzuwarten, bis es vorüber ist. In ihrem Zustand kann sie nicht Auto fahren.
Sie müßte zu Hause anrufen, überlegt sie, Bescheid sagen, daß es später wird, aber sie schafft es nicht. Fredrik ist ja an ihre ständigen Überstunden gewöhnt, sie hofft, daß er sich um das Abendbrot kümmern wird.
Sie denkt an den Jungen, Stein Holte. Wie vorhin überkommt sie dasselbe frostige Gefühl von Unheil, das sie jedoch verdrängt. Es ist ein Unglück mit diesen armen Kindern, mit ihnen allen.
Nach einer halben Stunde ist das Flimmern vor ihren Augen verschwunden. Als sie sich erhebt, ist ihr übel und schwindlig, sie geht zum Waschbecken und benetzt ihr Gesicht mit kaltem Wasser. Sie wagt nicht, sich im Spiegel zu betrachten.
Als sie im Auto sitzt, fühlt sie sich wieder einigermaßen beieinander. Erleichtert stellt sie fest, daß von Kopfschmerzen, die sich gewöhnlich nach einem solchen Anfall einstellen, nichts zu spüren ist. Kopfschmerzen nicht, aber ein leichtes Sausen in den Ohren. Nein, kein Ohrensausen, sondern ein tiefes Dröhnen im Kopf. Streß, denkt sie, ein typisches Streßsymtom.
Migräne hat sie ansonsten nur in Verbindung mit ihrer Menstruation und ab und zu auch, wenn sie extrem gestreßt ist.
Während sie nach Hause fährt, regnet es. Das Regenwetter scheint kein Ende zu nehmen, den ganzen Herbst über Regen, Regen. Auch ein Grund, depressiv zu werden. Im nächsten Jahr, denkt sie, wird sie kurztreten. Dann ist sie mit Fredrik nur noch allein zu Hause. Alle Verpflichtungen außerhalb der Arbeit wird sie ausschlagen. Völlig klar ist, daß das Leben, das sie jetzt führt, an ihnen beiden zehrt. Sie müssen Zeit haben, um etwas zu unternehmen, zusammen.
Etwas gemeinsam tun, daran hatte sie in einem Moment gedacht, als sie voller Optimismus und Elan war, da hatten sie sich über die Zimmer der Kinder hergemacht, um sie zum Weihnachtsfest neu zu tapezieren. Wahnsinn, natürlich – so kaputt wie sie war! Fredrik hatte protestiert, gemeint, das hätte Zeit bis nach Weihnachten, sie aber war stur geblieben, hatte darauf bestanden, daß die Zimmer zu Weihnachten fertig sein müßten.
Plötzlich hat sie so große Sehnsucht nach den Kindern, daß ihr schwindlig wird. Hilde ist ausgebildete Ökonomin und arbeitet in Bergen. Berit will Krankenschwester werden, sie besucht die Schwesternschule in Trondheim. Noch immer ist es nicht zu fassen, daß sie erwachsen sind, selbständig, daß sie ihre Kinder in Zukunft nur ein paar Tage in den Ferien sehen soll. Die Jahre sind so furchtbar schnell vergangen. Dennoch, wenn sie an sie denkt, dann nur als an ihre kleinen Mädchen. Sie freut sich sehr auf Weihnachten, wenn die beiden nach Hause kommen.
Die weißen Pillen sind alle, von den braunen hat sie ebenfalls schon etliche eingenommen. Manchmal, mitten in der intensivsten Arbeit, hält sie inne, denkt, daß irgend etwas mit ihrem Körper nicht in Ordnung sei. Er kommt ihr fremd vor, ungewohnt, mehr und mehr hat sie das Gefühl, nicht mehr mit sich selber übereinzustimmen.
Immer häufiger das Flimmern vor den Augen, die Schwindelanfälle. Im Büro muß sie ab und zu eine Pause einlegen, sich auf die Couch legen, bis es vorüber ist. Die Kollegen sehen sie sorgenvoll an, doch sie schiebt alles beiseite.
»Nur Streß«, sagt Maria.
An das Dröhnen, den singenden Ton tief in ihrem Kopf, hat sie sich gewöhnt. Manchmal sitzt sie da und lauscht ihm nach, bis Fredrik schließlich fragt, was los sei.
»Hörst du etwas, Fredrik?«
Denn zuweilen ist sie fast sicher, daß die Geräusche, die sie hört, von außen kommen. Ein andauerndes entferntes Donnergrollen.
Es passiert auch, daß sie von der Arbeit nach Hause gehen und sich hinlegen muß, bis der Schwindelanfall oder die Sehstörungen vorüber sind. Das kommt jetzt fast täglich vor.
Sowohl auf der Arbeit als auch zu Hause ist sie gereizt, regt sich gewaltig auf wegen Kleinigkeiten.
Eines Abends, als sie im letzten Zimmer mit den restlichen Tapetenbahnen beschäftigt sind, verschüttet Fredrik eine Dose Leim über den Fußboden, der mit Zeitungen und Plastikfolie abgedeckt ist. Kein Unglück, nichts, um ein großes Gewese darum zu machen. Wenn früher so etwas passiert wäre, hätte sie über seine Ungeschicklichkeit gelacht. Jetzt macht es sie rasend.
»Herrgott, bist du ein Tolpatsch!« schreit sie. »Du machst mich wahnsinnig!«
Verletzt, wie gelähmt steht er da und schaut sie an.
»Sieh zu, daß du da wegkommst! Verzieh dich, bevor du hier noch mehr Unheil anrichtest!«
Später geht sie zu ihm, umarmt ihn, bittet um Vergebung, daß sie so ungenießbar ist. Er umarmt sie, nur halb versöhnt, noch verletzt.
»Du mußt jetzt die Bremse ziehen«, sagt er müde.
Maria hat freie Tage gut. Sie will sie in der ersten Dezemberwoche nehmen. Der Gedanke daran ist das einzige, was sie bis zum Ende durchhalten läßt.
Sie hat die Woche bis ins Detail verplant. Die ersten Tage wird sie nutzen, um die Zimmer der Kinder wieder in Ordnung zu bringen. Mittwoch fährt sie nach Oslo. Für Donnerstag hat sie ein Treffen mit einem Referenten des Ministeriums vereinbart. Am Freitag trifft sie den Kursleiter und die anderen Lektoren des Lehrganges, um den Stundenplan zu beraten und das Frühjahrssemester zu planen. Samstag hält sie die letzten Vorlesungen vor Weihnachten.
In erster Linie aber wird sie ausspannen, versuchen, sich zu erholen. Samstagabend soll Fredrik nach Oslo kommen. Zusammen mit Lise und einem Freund von ihr wollen sie ausgehen. Gut essen, vielleicht tanzen, das wird guttun, das haben sie sich verdient, sie beide. Am meisten jedoch freut sie sich auf die gemeinsamen Abende mit Lise.