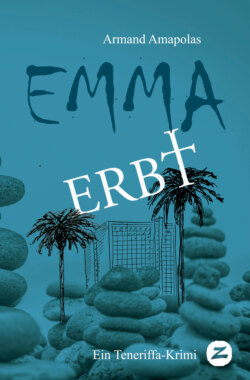Читать книгу Emma erbt - Armand Amapolas - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеDer Kapitän forderte zum Anschnallen auf. Das Flugzeug hatte die Insel in großem Bogen umflogen, war durch die Wolkendecke gestoßen und hielt jetzt auf Teneriffas Südflughafen zu. Heinz Poloniak beobachtete konzentriert das Wellengeschehen unter ihnen und hielt Emma und seine Frau über jede Entdeckung auf dem Laufenden. So gesprächig wie jetzt war er während des ganzen Fluges nicht gewesen.
»Da unten ist ein Segelschiff.«
»Noch eins.«
»Jetzt sieht man schon Häuser. Da ist ein neuer Golfplatz.«
Touché. Kaum griffen die Bremsen, brandete Applaus durch die Maschine. Auch Heinz und Johanna klatschten kräftig mit. Emma nicht. Sie fand das Geklatsche peinlich – und fragte sich im gleichen Augenblick: warum eigentlich?
»Das war sanft«, meinte Johanna: »Hätte ich den Jersey-Leuten gar nicht zugetraut. Ich dachte schon, die würden nur Hilfskräfte aus Osteuropa beschäftigen.« Dabei warf sie einen äußerst kritischen Blick nach vorne, wo die Flugbegleiterinnen saßen – die man von Reihe 34 aus gar nicht sehen konnte. Und die sich vor allem dadurch ausgezeichnet hatten, unterwegs mehrfach die tollen Sandwiches anzupreisen, die man an Bord erstehen konnte, neben Armbanduhren, Parfums und Lotterielosen. Auf die Sandwiches waren die Poloniaks zum Glück nicht angewiesen. Sie hatten belegte Brote und De Beukelaer-Kekse mitgebracht – und sie großzügig mit Emma geteilt.
»Wie kommen Sie denn zum La Palma?« wollte Heinz von Emma wissen, als sie zu dritt am Gepäckband standen und auf ihre Koffer warteten.
»Mit dem Auto. Ein Nachbar, ein Freund meiner Großmutter, hat angeboten, mich abzuholen. Und Sie?«
»Och, wir nehmen den Bus. Titsa. So heißt die Verkehrsgesellschaft hier. Die ist bestens organisiert. Die Direkt-Busse sind superschnell, halten zwischendurch nur am Nordflughafen. Wir haben sogar vom letzten Mal noch Bonos.«
Emma hatte keine Ahnung, was damit gemeint war. Ihr lag schon eine Bemerkung über Bonobos auf der Zunge und deren zügelloses Sexualleben, aber damit hätte sie die netten Poloniaks vielleicht erschreckt.
Heinz deutete Emmas fragendes Stirnzrunzeln als Neugier. »So heißen die Mehrfachtickets hier. Sind viel günstiger als Einzelfahrkarten. Die sollten Sie sich auch zulegen – wenn Ihr freundlicher Nachbar mal keine Lust mehr haben sollte, den Chauffeur zu spielen. Mit den Inselbussen kommen Sie überall hin.«
Die Poloniaks hatten sich längst überschwänglich und bedauernd verabschiedet, als endlich auch Emmas Rucksackkoffer auftauchte – als eines der allerletzten Gepäckstücke. Typisch, dachte sie: sogar die Laufbänder haben sich gegen mich verschworen.
Es hätte sie nicht gewundert, wäre sie jetzt zu allem Überfluss noch aufgefordert worden, ihr Gepäck zu öffnen, für eine Zollinspektion. Aber: nichts dergleichen geschah. Emma fand es so unwirklich wie wundervoll, dass sie keinerlei Kontrollen passieren musste. Kein Zöllner blickte streng. Das war bei ihrem letzten Besuch auf Teneriffa noch ganz anders gewesen, erinnerte sie sich. Auch diesen hellen, modernen Flughafen hatte es damals noch nicht gegeben. Mit Teneriffa verband sie bis jetzt den Anblick von Uniformträgern und strengen Bauten, die nach Diktatur muffelten. Damals lag wohl der Tod Francos noch nicht sehr lange zurück. Außerdem musste man D-Mark gegen Peseten tauschen. Den Wechselkurs hatte sie als kompliziert in Erinnerung. Jedenfalls war er viel verwirrender als das 1:7, wenn man nach Österreich fuhr. Selbst mit italienischen Lire war‘s leichter gewesen. Jetzt gab es weder Lire noch Peseten noch die D-Mark mehr. Teneriffa war Europa. Sie war hier Inländerin. Der Gedanke ließ sie lächeln.
Fast hätte sie den agilen Mann übersehen, der von links auf sie zuschoss und jetzt »Frau Schneider? Emma?« rief.
Hans-Peter Seidenschuh war Oma Ilses Nachbar gewesen. Und ein guter Freund. Und ihr Stellvertreter im Vorstand der Asociación. Kein Telefonat endete, ohne dass Oma Ilse von Herrn Seidenschuh erzählt hätte. In ihren Berichten aus Teneriffa hieß es immer »wir«, und mit »wir« waren sie und Herr Seidenschuh gemeint. Der in diesen Berichten nur anfangs als »Herr Seidenschuh« vorkam oder auch als »mein Nachbar«. Später war immer nur von Pedro die Rede. Offensichtlich hatte sich Herr Seidenschuh entschieden, dass Hans-Peter zu teutonisch klang. Er war Lehrer in Duisburg gewesen, das wusste Emma noch, und dass er aus irgendeinem Grund frühpensioniert war und seit langem ganzjährig auf der Insel lebte. Wegen Kinderallergie, hatte Oma Ilse mal gesagt. Ein Ausgewanderter. Pedro eben. Señor Seidenschuh hatte den Hans-Peter abgelegt.
Gesehen hatte Emma den legendären Pedro noch nie. Sie hatte sich gegen die Vermutung gestemmt, Oma Ilse könne mehr mit Pedro verbinden als kollegiale Nachbarschaft. Die Idee, dass ihre Oma mit einem anderen Mann als Opa Heinrich – und selbst mit dem – also das war Emma zu wenig omahaft – obwohl sie natürlich wusste, wie unsinnig das war. Dass auch Senioren noch Sex haben, wurde einem ja neuerdings in jedem zweiten deutschen Fernsehfilm nahegebracht. Trotzdem wollte Emma den Gedanken nicht an sich herantreten lassen, jedenfalls nicht, wenn ihre Oma Ilse darin eine Rolle spielen sollte.
Ilse Schneider war Jahrgang 1925 und gut über 80, als sie starb.
Der Mann, der jetzt auf Emma strahlend zueilte, sah halb so alt aus. Wie satte vierzig vielleicht, oder wie ein gut konservierter 50er. Einen Frührentner hatte sich Emma anders vorgestellt, aus welchem Grund auch immer. Er war braungebrannt, ohne prollig zu wirken, hatte volles, dunkles, nur dezent an den Schläfen angegrautes Haar. Seine nackten Füße steckten in Wildleder-Slippern. Er trug gutsitzende Jeans und ein sattgelbes Polo-Shirt: die globale Kluft der Junggebliebenen. Hätte da nicht ein Goldkettchen um seinen Hals gebaumelt, Emma hätte Pedro auf Anhieb durchaus sympathisch gefunden. Aber Goldkettchen-Männlein waren ihr zuwider. Warum, das hätte sie nicht zu erklären vermocht. Es war einfach so.
»Pedro«, stellte er sich vor. »Also eigentlich Hans-Peter. Aber ich nehme an, Ilse hat Ihnen mehr von Pedro erzählt als von Hans-Peter.«
»Das ist wahr. Aber ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt.«
»Hoffentlich nicht sympathischer. Ich habe Sie jedenfalls gleich erkannt. Sie sehen genauso aus und bewegen sich genauso, wie Ilse Sie geschildert hat.«
»So? Wie trete ich denn auf? Und wie bewege ich mich?«
»Selbstbewusst. Wie eine junge Frau, die genau weiß, was sie will – aber ohne diese Hoppla-hier-komm-ich-Manier, mit dem Geschäftsfrauen heute die Bühne zu betreten pflegen, ohne nach rechts und links zu blicken, diese Frauen in den bauhausmäßigen Business-Kostümen. Sie, Emma, wirken natürlich und so, als würden Sie sich für Ihre Umgebung interessieren. Kein bisschen Düsseldorf. Ich darf doch Emma zu Ihnen sagen? Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon lange.«
»Klar. Emma. Pedro! Oder ist Ihnen Hans-Peter lieber?«
»Nein, nein, Pedro passt schon. Hans-Peter wäre zu intim.«
Pedro schmunzelte, Emma auch. Vielleicht hatte er das Goldkettchen ja geerbt und trug es nur aus Pietät? Jedenfalls konnte Emma verstehen, warum ihre Oma von Pedro angetan gewesen war. Er schien Witz zu haben.
Wie selbstverständlich hatte Pedro ihren Koffer übernommen. Wie selbstverständlich hatte sie es zugelassen. Gemeinsam hatten sie die Ankunftshalle durch eine Glastür verlassen. Emma atmete tief durch. Der Himmel war jetzt wolkenlos blau. Am Straßenrand stand eine Reihe Palmen, deren Kronen sich sacht im Wind wiegten.
»Was für eine Luft!« entfuhr es Emma: »Und das nach diesem Nieselregen der letzten Tage und dem niederrheinischen Nebel.«
»Tja, und das ist hier fast immer so. Grund Nummer Zwei dafür, dass ich irgendwann keine Lust mehr auf den deutschen Trübsinn hatte.«
»Und was war Grund Nummer Eins?«
»Der Trübsinn selbst. Die ewige Hast, das ständige Jagen nach Mehr, der Neid, der wie Nebel auf den deutschen Seelen liegt. Die Sucht, alles immer korrekt machen zu wollen. Die Paragrafenreiterei.«
»Und das gibt es hier nicht?«
»Nein. Klar, hier sind die Menschen nicht besser oder schlechter als irgendwo sonst, aber sie genießen das Hier und Jetzt. Sie verschwenden weniger Gedanken an morgen. Vielleicht, weil es hier kaum Jahreszeiten gibt. Im Grunde ist ein Tag wie der andere. Womit wir wieder bei Grund Nummer Zwei angekommen wären. Und bei meinem Auto.«
Pedro streckte den rechten Arm aus und drückte auf eine Taste an seinem Autoschlüssel, wie ein Magier, der seinen Zauberstab schwingt. Ein weißer Subaru-SUV reagierte mit dezentem Plopp. Sie hatten keine fünfzig Meter laufen müssen.
»Ein schöner Flughafen. Den gab es, glaube ich, noch nicht, als ich das letzte Mal hier war.«
»Das muss dann im letzten Jahrhundert gewesen sein. Ursprünglich gab es in der Tat nur den alten Nordflughafen, und der sah aus, als hätte ihn Generalissimo Franco persönlich gebaut. Die Gebäude stehen übrigens immer noch, aber daneben ist auch im Norden schon seit ein paar Jahren ein ganz modernes Terminal im Einsatz. Spanien hat einen gewaltigen Sprung in die Moderne hinter sich, und die Tinerfeños waren so klug, vor allem ihre Infrastruktur enorm aufzurüsten. Die Autobahn hat es bei Ihrem letzten Besuch vermutlich auch noch nicht gegeben. Bald soll sie um die ganze Insel führen. Wenn wieder Geld aus Madrid und Brüssel fließt. Zur Zeit ist ja Flaute.«
Pedro wuchtete Emmas Patagonia-Koffer auf die Ladefläche des Subaru und bat Emma einzusteigen. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss, zögerte aber, den Wagen anzulassen, sah Emma an: »Emma und Sie: das klingt mir zu hanseatisch. Wie wäre es, wenn wir uns duzen? Das machen auf der Insel ohnehin fast alle so.«
»Klar, warum nicht.« Emma ergriff Pedros ausgestreckte Hand und drückte sie. Die beiden lächelten sich an.
Die Zubringerstraße zur Autobahn hinauf war zu Emmas Überraschung auf beiden Seiten abwechselungsreich mit Palmen, blühenden Büschen und Kakteen bepflanzt. Pedro nahm die Auffahrt Richtung Santa Cruz. Zehn Minuten später atmete Emma gut hörbar aus:
»Ja, so hab ich die Insel in Erinnerung. Ich dachte schon, ich hätte was in meinem Kopf durcheinander gebracht. All die gepflegten Rabatten vorhin, am Flughafen! Das Grün! Der Süden der Insel, das war in meiner Erinnerung nur Stein und Staub. Oma Ilse hat immer gesagt; der Süden sei Gottes Mülldeponie. Da habe er den Abraum abgelegt, der übrigblieb, als er das Orotavatal im Norden schuf.«
Links und rechts der Autobahn wechselten sich schmutzig-beige Geröllfelder mit wasserlosen Canyons ab, hier und da dekoriert mit schmucklosen, dafür schrillbunten Siedlungen.
»Da, ein Windpark!« Wie aus dem Nichts tauchten Windräder auf, locker zu Gruppen geschart wie Pilze im Wald.
»Hier sehen Windräder ja richtig gut aus«, fand Emma. »Sie dekorieren die Landschaft. Von wegen Verspargelung. Wo sonst nichts wächst, kann man auch nichts ver-irgendwassen! Außerdem scheint es sich zu lohnen.«
Fast alle Räder waren in kräftiger Bewegung.
»Die Insel will energie-autark werden. Neuerdings. Ist ja auch eigentlich naheliegend. Öl und Kohle gibt es hier nicht. Öl wird teuer importiert. Aber die Sonne scheint ganzjährig, und der Wind bläst auch nachts. Aber die meiste Kraft steckt im Meer. Wenn es gelänge, die richtig zu ernten, könnte Teneriffa Energie sogar exportieren. Erst recht, wenn der Vulkan mal wieder ausbräche. Der Teide.«
»Ist das denn möglich?«
»Sicher. Jederzeit. Das letzte Mal liegt nur einen Augenaufschlag zurück, geologisch gesehen. Aber heute sind wir sicher, glaube ich. Der Teide sieht ganz friedlich aus.«
Die nächste halbe Stunde sprachen beide wenig. Emma sah nach rechts aus dem Fenster und behielt das Meer fest im Blick. Sie registrierte jedes Ausfahrt-Schild. Das war immer ihre Gewohnheit gewesen: alles um sie herum genau zu beobachten. Daran erkenne man die geborene Journalistin, hatte Paul Bärkamp zu ihr gesagt, anerkennend. Sie war mächtig stolz darauf gewesen. Bei dem Gedanken an Paul und die Redaktion und ihre steile, aber kurze Karriere war ihr, als steige Säure aus dem Magen in die Speiseröhre. Sie musste schlucken.
Der Verkehr nahm zu. Pedro verließ die Überholspur und ordnete sich ganz rechts ein. Er musste bremsen.
»Hier geht es ab auf die Nordautobahn. Kommt immer ein bisschen plötzlich. Wer die Strecke nicht kennt, verpasst die Ausfahrt gern.«
Es ging stramm bergauf. Als sie ein rußender Laster blockierte, schaltete Pedro in den zweiten Gang zurück.
»Diese Abkürzung an Santa Cruz vorbei gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Wir steigen jetzt ganz schnell auf 600 Meter hoch. Da rechts übrigens ist das Fußballstadion von Santa Cruz.«
Emma begeisterte sich nicht mehr für Fußball, als es im Ruhrgebiet unvermeidbar ist, besonders, wenn man wie sie ihr Leben praktisch im Zwischenraum zwischen Schalke und dem BVB verbracht hat – wenn es da einen Zwischenraum gab –, aber dieses Stadion gefiel ihr. Es war erst gar nicht zu sehen. Es dominierte nicht protzig die Landschaft wie die aufgeblasene Arena bei München oder die auf Schalke. Es duckte sich, elegant geschwungen, in eine Mulde und schien nicht aus Glas, Beton und Plastik zu bestehen, sondern hier gewachsen zu sein.
»Interessante Architektur.«
»Davon gibt es hier neuerdings eine Menge. Klötze wie unser La Palma hätten heute keine Chance auf Baugenehmigung mehr. Überhaupt, das siehst du ja, ist fast jeder freie Raum schon zugebaut.«
In der Tat fuhren sie seit dem Autobahnwechsel permanent durch bebauten Raum. Eine Stadtlandschaft, wildes urbanes Durcheinander.
»Santa Cruz und La Laguna, die Universitätsstadt auf der Höhe, sind praktisch zusammengewachsen. Der letzte Schrei ist eine Straßenbahn, die beide Zentren verbindet. Übrigens, wenn du Lust dazu hast, machen wir einen Stopp am Rand des Orotavatals. Da siehst du auf einen Blick, was sich auf Teneriffa in deiner Abwesenheit getan hat.«
»Gerne. Wenn du Zeit dafür hast. Ich werde von niemandem erwartet.«
»Ich auch nicht, zum Glück.«
Sie hatten den Nordflughafen passiert und den Atlantik jetzt vor sich, auf der Nordseite der Insel. Der Charakter der Landschaft änderte sich zum zweiten Mal radikal. Von Beige und Grau zu Grün. Nach Wüstenei und Großstadt schienen sie jetzt durch einen endlosen Garten zu fahren. Der allerdings auch überall durchsiedelt war. Zersiedelt, wie Emma fand. Allerdings nicht mit Hochhäusern. Hochhäuser waren erst wieder zu sehen, als in der Ferne vor ihnen Puerto de la Cruz auftauchte. Pedro setzte den Blinker und verließ die Autobahn.
»Wir fahren zum Mirador de Humboldt.«
»Der Humboldtblick! Daran kann ich mich erinnern. Da gab‘s ein deutsches Café, wo meine Großeltern gerne hingefahren sind. Mit tollem Blick übers Tal. Und der Apfelkuchen war gut.«
»Das Café gibt‘s glaube ich sogar noch. Vielleicht sogar den Apfelkuchen. Aber der Mirador Humboldt ist neu. Die Architektur wird dir gefallen. Ist ähnlich wie die des Stadions.«
Sie parkten an einer Landstraße dicht vor einem flachen, unscheinbaren, bunkerähnlichen, grauen Bau. Durch ein enges Tor betraten sie eine immer breiter werdende Terrasse. Jenseits eines Mäuerchens erstreckte sich wie eine halbe Schüssel ein weites Tal. Die andere Hälfte der Schüssel schien der Atlantik verschluckt zu haben. Auf dem Mäuerchen saß in lässiger Haltung ein junger Mann, ein Bein ausgestreckt, das andere angewinkelt, und lächelte versonnen. Er saß da offensichtlich immer. Er war aus Bronze.
»Darf ich vorstellen«, Pedro imitierte eine höfische Verbeugung: »Herr von Humboldt – Emma Schneider von der Ruhr.«
Emma legte einen artigen Knicks hin und reichte Herrn von Humboldt ihre Hand zum Kuss. Doch, so wie der junge Kupferkerl aussah, hätte sie sich von ihm durchaus küssen lassen mögen. Vielleicht sogar nicht nur die Hand.
»Ich wusste gar nicht, dass Humboldt so gut ausgesehen hat. Aber klar, er war jung. Wir stellen uns die Klassiker ja immer als alte, weise Männer vor.«
»Also eher so wie mich?«
Emma musterte Pedro mit strenger Miene prüfend.
»Nein, so auch wieder nicht. Dir fehlt es noch an Reife.«
Sie fanden einen freien Tisch ganz dicht an der Balustrade. Unter ihnen schlängelte sich die Autobahn zwischen Bananenplantagen und Siedlungsfetzen dem Talende entgegen. Beim Anblick der Autos musste Emma an Blutkörperchen denken, die rasch und ohne Unterlass in beide Richtungen eilten, die Zivilisation in ihrem Kampf mit der Natur versorgend. In welchem Film hatte sie das noch mal gesehen? Egal. Die Zivilisation schien hier im Tal die Oberhand zu behalten, einstweilen. Aber was wäre, wenn die Blutkörperchen nicht mehr rollten, dachte Emma? Dann wäre bald wieder alles nur grün. Der Roman »Hundert Jahre Einsamkeit« fiel ihr jetzt ein, wo es in einer Stadt nicht mehr aufhören will zu regnen und der Urwald schließlich alles überwuchert, was Menschen ihm abgetrotzt hatten.
Pedro hatte sie beobachtet und offenbar ihre Gedanken gelesen.
»Als Alexander von Humboldt hier war und behauptete, dies sei eine der schönsten Ansichten, die es auf der Erde gebe, muss das Tal wirklich wie ein Garten Eden ausgesehen haben. Die einzigen Häuser darin, das war die Altstadt von La Orotava da unten, die jetzt kaum erkennbar ist, weil so viele Neubauten drumherum stehen.«
Der Kellner servierte zwei Cortados, und Pedro zeigte auf eine Ansammlung weißlicher Bauten, die wie ein heller Kuhfladen im Grün des Tales lag.
»Sonst gab es da unten früher nur einzelne Herrenhäuser in den Plantagen und den Hafen, Puerto eben.« Pedro deutete nach rechts, wo sich in der Tiefe unter ihnen Hotelhochhäuser um eine kleine Bucht herum knubbelten. Jedenfalls sah die Bucht von hier oben winzig aus, wie in einer Märklin-Landschaft. Nur ohne Eisenbahn.
»Puerto war damals, also vor zweihundert Jahren, ein kleiner Hafen mit Kirche und ein paar Häusern, mehr nicht. Und dann muss man sich vor Augen halten, dass Humboldt dieses üppig bewachsene Tal vor dem Hintergrund des kahlen Teide gesehen hat und der Vulkanfelder, durch die er gewandert ist. Humboldt blieb ja nur ein paar Tage hier, ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Südamerika, er hat sich aber nichts entgehen lassen. Und seine Sprüche sind natürlich Gold wert, für die Tourismusindustrie.«
»Im Grunde war er der erste Tourist.«
»Jedenfalls der erste deutsche. Die Engländer waren natürlich auch damals schon hier. Sie beherrschten ja die Meere. Richtig losgegangen ist es aber erst hundert Jahre später. Und vollends ab ging die Post, als die Flugzeuge kamen.«
»Oma hat mal erzählt, auch im La Palma gebe es Engländer.«
»Ja, aber das sind Exoten. Angepasste Exoten, die merkwürdigerweise gerne Rotkohl essen. Das La Palma ist fest in deutscher Hand. Allerdings kommen jetzt die Chinesen und Russen.«
»Im Ernst? Was wollen die denn hier?«
»Keine Ahnung. Rotkohl essen? Nein, Geld anlegen, nehme ich an. Übrigens glaube ich nicht, dass sich deine Oma selbst das Leben genommen hat.«
»Wie bitte?« Emma glaubte, sich verhört zu haben. »Was willst du damit sagen?«
»Ja, ich weiß, das klingt, als würde ich zu oft Tatort gucken. Aber Ilse war erstens nicht krank, zweitens kein bisschen depressiv, im Gegenteil, und drittens hatte sie Angst.«
»Angst? Vor wem denn?«
»Ja, wenn ich das so genau wüsste. Vielleicht müsste es auch nicht heißen: vor wem? Sondern: vor was?«
»Das verstehe ich erst recht nicht.«
»Ich kann es dir auch nicht richtig erklären. Jedenfalls hatte Ilse in den letzten Monaten eine Unruhe an sich, die eigentlich nicht zu ihr gepasst hat. Sie wollte nicht drüber reden, aber ich hatte den Eindruck, sie fühlte sich verfolgt.«
»Wieso um Himmels willen sollte irgend jemand meine Oma Ilse ›verfolgen‹, eine Greisin aus Wanne-Eickel, die außer Fischen und vielleicht meinem verstorbenen Opa Heinrich keiner Seele je etwas angetan hat?«
Pedro zuckte mit den Schultern und blickte in die Ferne.
»Wenn du da hinunter schaust, sieht dieses Tal paradiesisch aus, und das La Palma – dahinten kann man übrigens eine Ecke davon erkennen – wie eine Perle im Paradiesgarten. Aber auch im Paradies, du wirst dich erinnern, hat es Schlangen gegeben.«
»Auf Teneriffa gibt es keine Schlangen. Das habe ich im Reiseführer gelesen.«
»Keine tierischen. Aber warte erst mal ab, bis du deine Mitbewohner im La Palma kennenlernst!«