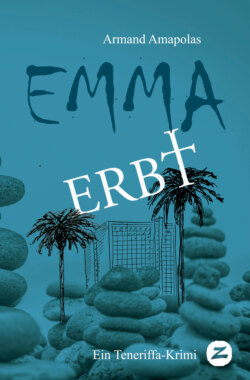Читать книгу Emma erbt - Armand Amapolas - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеEmma blieb wie angenagelt auf der Türschwelle stehen. Es roch nach Oma! Ganz klar. Nach Großeltern und Muff und Feuchtigkeit. Sie schloss die Augen und war wieder Kind.
Sie hörte Oma Ilses sonore Stimme und Opa Heinrichs Brummen, sein: »Ilse, nun lass das Kind doch in Ruhe!« Oma hatte immer Ideen, was Emma tun könnte oder sollte oder eigentlich wollen sollte. Solche Ideen hatte Ilse Schneider übrigens im Umgang mit allen Menschen, die ihr näher kamen. Sie nahm einfach an, jeder müsste, so wie sie, immer in Bewegung sein. Deshalb hatte sich auch niemand in der Familie vorstellen können, wie Oma Ilse auf Teneriffa zurechtkommen würde. Schon ihren Fischladen aufgeben zu müssen – er wurde durch einen griechischen Imbiss ersetzt, inzwischen war ein Pizza-Service drin –, war ihr unendlich schwergefallen. Opa Heinrich war der Pragmatische gewesen. Er hatte seiner Frau und später der ganzen Familie minutiös vorgerechnet, dass der Laden sich seit langem schon nur noch trug, weil sie beide unermüdlich schufteten und weil ihnen das Haus gehörte, in dem der Laden war. Hätten sie Miete zahlen müssen, selbst eine der in der Wanner Innenstadt – diesem Resteteller einer Einkaufszone – üblichen Mini-Mieten, wären sie schon längst pleite gewesen. Jetzt kam stattdessen Pacht ein – »und wir können endlich unser Apartment auf Teneriffa richtig nutzen«. So hatte Opa Heinrich gesprochen, als der Fischladen endgültig aufgegeben war.
Kurze Zeit später hatten Heinrich und Ilse die Hausverwaltung des La Palma voll im Griff. Heinrich wurde Präsident der Eigentümerversammlung, Ilse organisierte das Büro – wie sie früher den Fischladen im Griff gehabt hatte. Immerhin enthielt das La Palma über hundert Apartments und hatte fast ebensoviele Eigentümer. Die wenigsten wohnten dauerhaft hier. Es gab immer was zu tun. Und wenn es nichts zu tun gab, dann zu planen und zu schlichten. Heinrich und Ilse flogen zunehmend seltener nach Deutschland. An Feiertagen telefonierte man, das war‘s.
Bis Heinrich starb, vor fünf Jahren. An Herzinfarkt. Ilse bestand darauf, ihn »zuhause« zu beerdigen. Sie hatte rechtzeitig eine Grabstätte reserviert, auf dem Friedhof an der Wiescherstraße. Für beide. Und den Grabstein ausgesucht. Dunkler Marmor. Für beide. Und darunter lag sie jetzt auch, seit einer Woche, neben ihrem Heinrich. Heimgekehrt im Sarg.
Emma hatte es erstaunt, wie routiniert der Leichentransport abzuwickeln war. Das Herner Bestattungsunternehmen nahm alles in die Hand. Emmas Eltern konnten sich darauf beschränken, Unterschriften zu leisten. Und zu zahlen. Aber Ilse Schneider hatte auch dafür vorgesorgt. Sie hatte ihren Erben ein gut gefülltes Konto hinterlassen. Sie hatte alles testamentarisch geregelt. Wahrscheinlich hatte sie ihrem Sohn und der Schwiegertochter nicht zugetraut, eine Beerdigung zu organisieren, so, wie eine Beerdigung zu sein hatte, nach Oma Ilses fester Überzeugung. Bis hin zum Streuselkuchen und den Mettbrötchen hatte sie alles minutiös geplant und vorbestimmt.
In ihrem Testament stand auch, dass Emma das Apartment auf Teneriffa erben sollte. Emma allein. Ohne Erklärung. Emma vermutete, das sollte Oma Ilses subtile Rache an Sohn und Schwiegertochter sein, Emmas Eltern. Die hatten sich nie für Teneriffa interessiert, waren nur ein, zwei Mal dort gewesen, auf Heinrichs und Ilses heftiges Drängen hin, und sie hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie den Entschluss der Großeltern, quasi auszuwandern, zutiefst missbilligten. »Was wollt ihr denn da? Ihr kennt da niemanden. All eure Freunde und Verwandte leben hier im Ruhrgebiet. Ihr sprecht kein Spanisch. Ihr habt dort nichts zu tun. Das werdet Ihr nicht lange aushalten. Und immer ist das Wetter gleich.«
»Immer gleich perfekt«, hatte Oma Ilse erwidert. Auf den Herner Winter könne sie getrost verzichten, auf den Frühling, den sogenannten Sommer und den Herbst gleich mit. Freunde finde man, wenn man sie suche, überall. Mit Deutsch komme man ganz gut durch auf der Insel. Da gebe es längst auch deutsche Bäcker. Und wem wirklich viel liege am Kontakt zu ihnen, der könne sie ja besuchen kommen… Im La Palma ständen immer Apartments leer, die von ihren Eigentümern gerade nicht genutzt würden. Und übrigens sei das Leben auf der Insel nicht nur besser, sondern auch noch viel billiger als im nebligen Germanenland. Also würden sie dort viel weniger ausgeben können. Das sollte ihre Erben doch freuen!
Emma öffnete ihre Augen und sah sich im Apartment um. Es war eines der größeren im Haus, mit geräumigem Wohnraum, Essplatz vor dem Balkon, kleiner Küche, Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad und WC. Schon von hier aus, von der Eingangstür aus, konnte sie das Meer sehen, jenseits des Balkons. Vor den Fenstern hingen dicke weinrote Vorhänge mit goldenen Troddeln. Aber der Blick durch die gläserne Balkontür war frei.
Emma schloss die Tür hinter sich, durchquerte den Raum und schob die aluminiumleichte Balkontür auf. Sofort stieg ihr das Brausen der Brandung zu Kopf. Wie das Atmen eines riesigen Ungeheuers, dachte sie, und ihr fielen Gespenstergeschichten wieder ein, die Opa Heinrich ihr vorgelesen hatte, wenn sie bei ihm und Ilse in den Ferien war. Auf der Klappcouch im Gästezimmer hatte sie geschlafen – und, bei offenem Fenster, immer das Meer gehört; mal lauter, mal leiser, mal krachend. Wie ein Ungeheuer eben, dachte sie immer, ein Ungeheuer, das mal gute und mal schlechtere Laune hat und mal richtig aufgebracht ist. Das gründlich Luft holt und sie dann ausstößt, mal lauter, mal leiser. Das aber niemals ganz zur Ruhe kommt.
Nicht wie das Mittelmeer. Das war ein Entenpfuhl dagegen, ein blauer Pfuhl, aber ein Pfuhl, dachte Emma. Sie sog voll Genuss tief die frische, zart gesalzene Seeluft ein. Das tat gut. Im Gegenlicht konnte sie sehen, dass über der Brandung ein Nebelschleier hing. Salz legte sich hier auf jede Oberfläche. Die Balkonbrüstung war rau von Korrosion. Emma hatte Oma Ilses Klage im Ohr: »Wenn man hier nicht dauernd streicht und putzt und erneuert, rostet alles weg.« Deshalb auch das Aluminium. Das rostete nicht, setzte mit der Zeit aber einen weißlichen, angerauten Belag an. Über Wohnungseigentümer, die »sich um nichts kümmern und alles vergammeln lassen«, konnte Oma endlos klagen. Ihr neues Leben, ihr Inselleben, hatte sie dem Kampf gegen die Schlamperei gewidmet. Im Namen der Asociación de Propietarios gab sie, Briefe schreibend, Anrufe tätigend, Faxe versendend, Aushänge am Schwarzen Brett im Treppenhaus aushängend, keine Ruhe, bis säumige Nebenkostenzahler zähneknirschend ihren Anteil zum Neuanstrich, zu Reparaturen und Renovierungen beigetragen – oder hausordnungswidrig an Balkonen befestigte Wäscheleinen beseitigt – hatten. »Wie sieht das aus? Sind wir hier etwa in Neapel?« pflegte Oma Ilse zu wettern, einhelliger Zustimmung sicher.
Genauso rigoros ging sie gegen Eigentümer vor, die glaubten, ihr Apartment dauerhaft untervermieten zu können, womöglich an kinderreiche Einheimische. Das war laut Satzung verboten, wie jede kommerzielle Weitervermietung. Oma Ilse wusste die entsprechenden Paragrafen auswendig. Und zitierte sie mit zunehmender Häufigkeit. Denn irgendeine Sauerei lag immer vor, aus Ilses Sicht. Das hatte Emma – und ihren Eltern sowieso –, aber auch vielen alten Freunden und Bekannten, das Telefonieren mit Ilse Schneider zuletzt mehr und mehr verleidet.
Emma seufzte und drehte sich um. Das also war jetzt alles ihres. Sie war jetzt, ohne ihren Willen, Immobilienbesitzerin, zum ersten Mal in ihrem Leben. Freute sie sich? Sie wusste es nicht. Doch, Eigentum war ihr durchaus wichtig. Es war ihr zum Beispiel wichtig, gute Koffer und Taschen zu besitzen, nicht irgendwelche Billigbehältnisse von Kodi. Jedes der wenigen Möbelstücke in ihrer kleinen Bochumer Wohnung hatte sie sorgfältig ausgewählt. Haben oder Sein? So ein Quatsch. Ohne Haben kein lohnendes Sein, so sah sie es. Aber man musste den Überblick behalten beim Sein. Zuviel Besitz machte blind für Details.
Nichts von den Möbeln, die jetzt hier vor ihr standen, hätte sie gekauft, würden ihr ganz persönliches Sein aufhellen können, das sah sie sofort. Weder die Schrankwand im Nussbaumlook, noch die hellgrauen, ziemlich neuen Polstermöbel, noch der Glastisch auf verschlungenem Schmiedeeisengestrüpp. Noch die Bilder an den Wänden. Nichts davon passte zu ihr. Nichts davon wollte sie um sich haben. Schon gar nicht die dunkelroten Vorhänge mit den goldenen Troddeln. Sie kam sich vor, als würde sie sich in einem Oma-Ilse-Museum bewegen. Emma riss, einer plötzlichen Eingebung folgend, alle Vorhänge auf. Mit einem Mal war die Wohnung dem Dämmerlicht entrissen; lichtdurchströmt, sonnendurchflutet. Dennoch: Das hier war nicht ihr Zuhause – und würde es nie werden, auch kein Zweit-Zuhause. Emma beschloss, so schnell wie möglich den tinerfenischen Immobilienmarkt zu checken. Sie fühlte sich schlagartig besser. Ein Entschluss war gefasst.
Mit einem Mal konnte sie die Wohnung mit ganz anderen Augen betrachten. Befreit. Nichts von dem, was hier stand, konnte ihr jetzt noch zu nahe kommen.
Doch, ein Möbelstück schon: die Bettcouch im Gästezimmer. Sie suchte nach dem Klappmechanismus – und schwupp, stand ein Bett vor ihr. Das Bett, in dem sie imaginäre Gespräche mit dem blauen Teddy-Walross geführt hatte, das ihre Großeltern ihr bei ihrem allerersten Besuch auf der Insel gekauft hatten – und das sie seither immer »erwartet« hatte, wenn sie wiederkam. Wo war er? Wo war Albert, das Walross geblieben? Auf der Couch lag er nicht. Klar, warum auch? Wann genau war sie das letzte Mal hier gewesen? Vor zwanzig Jahren? Fünfzehn war sie damals gewesen, und Teneriffa war ihr nach zwei Tagen auf die Nerven gegangen. Omas Ideen, wie sie ihren Tag verbringen könnte, noch mehr. Nur das Walross – warum sie es auf Albert getauft hatte, fiel ihr nicht mehr ein – Albert hatte sie verstanden. Ein wenig, glaubte sie, Opa Heinrich auch. Auch bei ihm musste man sich mit sprechenden Blicken begnügen; nicht nur, solange Oma in Hörweite war. Es war komisch: Oma Ilses Geist schwebte über allem, was in Opa Heinrichs Nähe war, ob sie anwesend war oder auch nicht.
Dabei konnte man nicht sagen, dass er, wie man das so nennt, unter Ilses Pantoffel stand. Er war ein gestandener, angesehener Geschäftsmann gewesen und wusste auch so aufzutreten. Wenn er Entscheidungen traf, dann galten sie. Das hatte auch Oma Ilse immer akzeptiert. »Das muss Heinrich entscheiden«, war einer ihrer Standardsprüche. Den sie vor allem dann einsetzte, wenn sie sich im Gespräch nicht sofort durchzusetzen wusste – oder selber unentschieden war.
Emma öffnete alle Schränke, ging die ganze Wohnung durch. Erstaunlich, wie viel man auf so engem Raum unterbringen konnte! Stellplatz, der genutzt werden konnte, den hatten ihre Großeltern genutzt. Wände, die behängt werden konnten, hatten sie behängt. Drei gerahmte Fotos fand sie, auf denen sie selbst zu sehen war. Emma als Kleinkind, auf Heinrichs Arm, Ilse stand besorgt lächelnd daneben. Als Fünfzehnjährige, auf einem Badehandtuch, am schwarzen Strand von Teneriffa, mit cooler Sonnenbrille, im roten Bikini. Das dritte hatte sie Oma ungerahmt per Post geschickt, als sie ihren Bachelor bekommen hatte. Darauf war sie mit einer dieser Kappen auf dem Kopf zu sehen, die bei amerikanischen College-Abschlussfeiern in die Luft geworfen werden. Emma gefiel der verschmitzternste Gesichtsausdruck, mit dem sie in Jörgs Kamera geblickt hatte, damals.
Ach, Jörg! Der saß jetzt sicher mit seiner neuen Liebe in seinem frisch gekauften Reiheneigenheim und rechnete durch, ob noch eine Terrassenerweiterung drin sein könnte. Aber gute Fotos konnte er machen.
Albert fand sie im Schlafzimmer, auf der Kommode. Er lag dort so, dass Oma Ilse ihn offenbar immer von ihrem Bett aus hatte sehen können. Emma verspürte einen Stich in der Herzgegend. Über der Kommode und Albert hingen das Kinderbild von ihr und zwei Hochzeitsfotos, eines ihrer Eltern – Mutter in einem leichten Sommerkleid, Vater trug Jeans und eine braune Cordjacke –, das andere zeigte Heinrich und Ilse, er in Schwarz, sie in Weiß, ernst alle beide, eingerahmt von zwei ebenso ernst dreinblickenden Trauzeugen. Wer war das eigentlich? Emma erkannte sie nicht.
Dann hingen da noch zwei weitere Bilder, in neueren, hellhölzernen Rahmen. Auf dem einen war eine heitere Gruppe rüstiger Wanderer zu sehen, auf einer Art Lichtung im Wald. Emma erkannte ihre Oma. Sie stand in der Mitte. Und gleich neben ihr Pedro, Hans-Peter Seidenschuh. Die anderen Gesichter sagten ihr nichts.
Was hatte dieser Pedro vorhin gesagt: Oma Ilse habe sich nicht selbst getötet? Was wollte er damit sagen? Sie war viel zu verdutzt gewesen, darauf weiter einzugehen. Wahrscheinlich war diesem Inselcasanova die viele Sonne zu Kopf gestiegen. Überhaupt: hatte er mit ihr geflirtet? Der alte Sack? Wie alt mochte der sein? 50, 55? Alt genug jedenfalls, ihr Vater zu sein. Nun gut: er hielt auf sich. Gesunder Teint, gut gepflegt, ein bisschen beleibt, aber nicht fett; ›beefy‹ hätte es bei Tom Wolfe wohl geheißen, aber Emma stand nicht auf magere Männer, und auf Muskelpakete mit angehängtem Kleinhirn schon gar nicht. Sie mochte Männer, denen man ansah, dass sie etwas von gutem Leben verstanden. Und Humor bewiesen. Den immerhin schien dieser Pedro zu haben. Wenn er nicht dieses Goldkettchen trüge!
Das fünfte Bild zeigte Oma Ilse mit einem Golfschläger, weit ausholend, in dieser golfertypischen, unnatürlich-verdrehten, lächerlichen Haltung mit leicht gespreizten Beinen und eingeknicktem Oberkörper. Oma voll auf den kleinen weißen Ball am Boden konzentriert. Neben ihr stand eine lederne Golftasche in der Gegend, aus der metallene Schlagflächen lugten wie zu kurz geschnittene Blumen aus einer überdimensionierten Vase. Oma, schlank, wie sie immer gewesen war, fast hager jetzt, in beiger Freizeithose und heller Bluse. Mit stark getönter, großer Sonnenbrille. Ihr graues, hochgestecktes Haar aufgewühlt vom Wind. Im Hintergrund hob sich der Atlantik tiefblau vom satten Grün des Golfplatzes ab.
Golf? Emma hatte keine Ahnung gehabt, dass Oma Ilse Golf spielte. Oma und Golf: diese Kombination schien ihr so unpassend wie Schalke und Gänsestopfleber. Zwei Bildzutaten, grundverschiedenen Welten entrissen. Andererseits, fiel ihr ein, gab es in der Arena auf Schalke VIP-Logen, in denen Champagner serviert wird. Und, wer weiß, vielleicht auch Gänsestopfleber. Sie war einmal in eine dieser Logen eingeladen gewesen, als Redakteurin. Bis dahin hatte sie Fußball, was das Kulinarische betraf, immer nur mit Bratwurst und Bier aus Plastikbechern in Verbindung gebracht. Times they are a-changin‘, hatte Bob Dylan gesungen, noch so ein Idol ihrer Eltern. Komisch, dachte sie, bei allem, was ihre Eltern anders dachten und machten als sie – und das war eine Menge: ihr Musikgeschmack war ähnlich. Was für sie die Counting Crows, waren für ihre Eltern Procol Harum gewesen. Musik, die ihre Großeltern gut gefunden hatten, stammte hingegen aus einer ganz anderen Welt.
Sie legte Albert, wie sie es früher immer getan hatte, in ihre Armbeuge, während sie die Fotos betrachtete. Dabei fiel ihr Blick auf eine längliche Schachtel aus tiefdunklem kanarischen Kiefernholz, auf dem das Stofftier gelegen hatte wie auf einem Podest, vom nackten Holz der Schachtel abgehoben durch ein helles, goldbesticktes Leinentüchlein. Ilse hatte Albert gleichsam dort aufgebahrt, fand Emma, und sie war gerührt. Soviel Sentimentalität hatte sie ihrer nüchternen Großmutter gar nicht zugetraut.
Oma Ilse war keine Schmuserin. Wenn sie jemanden in den Arm nahm, wirkte das, als prüfe eine Postbeamtin ein Paket auf Versandfestigkeit. Trost spenden sollende Worte klangen aus ihrem Mund meist so: »Stell dich nicht so an! Das wird schon wieder!« Gegen Fieber halfen kalte Wadenwickel, jeder Krankheit wusste Oma Ilse mit einem Tee zu begegnen. Jeder körperlichen Krankheit. Andere akzeptierte sie nicht: »Stell dich nicht so an..!«
Emma öffnete die Schachtel. Sie steckte voller Karten und Briefe. Emma nahm alles mit auf den Balkon, klappte einen der an die Wand gelehnten Gartenstühle auf und setzte sich. Nein, bevor sie zu lesen begann, musste gelüftet werden! Sie stand noch einmal auf, ging in die Wohnung und riss alle Fenster so weit wie möglich auf.
Obenauf lag eine Ansichtskarte, die sie, Emma, ihrer Oma aus Rom geschickt hatte, während ihres letzten gemeinsamen Urlaubs mit Jörg. Die Piazza Navona. Mit Kugelschreiber hatte Emma ein kleines Kreuz neben den Vier-Flüsse-Brunnen gemalt. Auf die Rückseite hatte sie neben ein weiteres Kreuzchen geschrieben: »Hier schlecken wir gerade das beste granitá di caffé del mundo! Und denken an Dich«. Na ja, das war ein bisschen gelogen gewesen. Was man so auf Postkarten schreibt! Das Kaffee-Eis hatten sie am Pantheon gegessen, und an Oma Ilse hatten sie erst am vorletzten Tag gedacht, als es um die Frage ging: Müssen wir nicht noch irgendjemandem einen Kartengruß schicken?
Die Schachtel schien alle Ansichtskarten zu enthalten, die Emma ihren Großeltern je geschickt hatte. Allzu viele waren es nicht, stellte Emma mit schlechtem Gewissen fest. Ganz unten in der Truhe lagen Briefe von Heinrich an Ilse. Kein einziger Brief ihres Vaters! Völlig aus dem Rahmen fiel ein Umschlag, der nichts Persönliches an sich hatte. Ein Geschäftsbrief, der fast zuoberst lag, gleich unter Emmas letzter Ansichtskarte.
Der Brief war neueren Datums. Adressiert an Ilse Schneider, Apartamento 1111, Edificio La Palma, Calle La Palma, Puerto de La Cruz. Als Absender firmierte eine Stella Real Estate. Mit einem Büro in La Paz.
Der Umschlag war aufgeschlitzt. Er enthielt einen einzigen Briefbogen, der sich anfühlte, als sei er schon oft herausgeholt und wieder hineingesteckt worden. Unter einem etwas barock wirkenden Briefkopf – Das S in Stella schien den Rest des Schriftzugs wie mit Tentakeln umarmen zu wollen – enthielt es – ein Kaufangebot:
Sehr geehrte Frau Schneider,
im Auftrag und im sehr ernsthaften Interesse eines potenten Käufers darf ich Ihnen ein Angebot unterbreiten, von dem ich hoffe, das es Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zustimmung finden wird.
Dieser Käufer, der einstweilen anonym bleiben will, dessen Bonität jedoch, wie wir überprüft haben, über jeden Zweifel erhaben ist, möchte Ihr Apartment im Edificio La Palma käuflich erwerben. Er ist bereit, einen Preis zu zahlen, der deutlich über dem Marktpreis liegt. Was sein Angebot zusätzlich interessant machen dürfte, ist: Er wäre bereit, den Kaufpreis vollständig in bar zu entrichten, oder ihn auch, vollständig oder teilweise, auf ein Konto Ihrer Wahl in einem Land Ihrer Wahl zu überweisen. Die Stella Real Estate würde die Gewährleistung einer vertrauensvollen und allen gesetzlichen spanischen Auflagen genügenden Abwicklung garantieren.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie mich an, gern auch außerhalb unserer Geschäftszeiten!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Sr. Jochen Hollerbeck, Geschäftsführer
›Das‹ mit einem S! Und: die ›Gewährleistung garantieren‹! Emma konnte kein Schriftstück lesen, ohne in Versuchung zu geraten, es zu redigieren. Eine berufsbedingte Marotte. Die Fehlersuche war ihre erste Reaktion. Die zweite: Hurra! Das kommt ja wie gerufen! Schnell sah sie noch einmal nach dem Datum: der Brief war vor gut drei Monaten geschrieben worden. Ob das Angebot noch stand? Hatte ihre Oma dem Makler, denn das war dieser »Señor« Hollerbeck ja wohl, geantwortet? Darauf enthielt der Inhalt der Schachtel leider keinerlei Hinweis.
Aber das musste doch leicht herauszufinden sein. Ob Omas Telefon noch funktionierte? Ja, tatsächlich. Ein kleines rotes Licht, neben dem »mensajes« stand, blinkte. Und das Freizeichen ertönte, sobald Emma den Hörer aufgenommen hatte. Sie wählte die Nummer an, die auf dem Briefbogen stand.
Nach dem fünften Klingelton wollte Emma schon wieder auflegen, da meldete sich eine Frauenstimme: »Hola!« Emma zögerte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sich jemand auf Spanisch melden könnte. Wie idiotisch von ihr! Wo war sie denn hier? Im Münsterland? Sie kramte in ihren rudimentären Spanischkenntnissen und stotterte:
»Buenos días! Yo, äh, ich suche, el Señor Hollerbeck. Esta aquí?«
»Sie können ruhig deutsch sprechen! Ich bin Frau Hollerbeck. Mein Mann ist geschäftlich unterwegs. Wie war noch gleich Ihr Name? Vielleicht kann ich meinem Mann etwas ausrichten?«
»Oh, Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Schneider. Emma C. Schneider. Ich habe das Apartment meiner Großmutter geerbt, hier auf der Insel, und ein Kaufangebot gefunden, für dieses Apartment. Und ich wollte nur nachhören, ob das Angebot noch gilt.«
»Mein Mann wollte Ihr Apartment, also das Apartment Ihrer verstorbenen Großmutter kaufen: habe ich das richtig verstanden?« Frau Hollerbeck schien verdutzt zu sein.
»Ja, genau. Also nicht er direkt, sondern er hat einen Brief im Namen eines, wie es hier steht, ›potenten Käufers›‹ geschrieben.«
Die Frau am anderen Ende der Leitung war still. Jemand klopfte an die Tür.
Emma hielt eine Hand über das Mikrofon im Telefonhörer und rief laut Richtung Tür: »Un momento! Ich komme gleich.« Dann sprach sie wieder ins Telefon:
»Also, wenn Ihnen mein Anruf ungelegen kommt: ich kann mich gern später noch einmal melden.«
»Ja, tun Sie das! Und ich werde meinem Mann ausrichten, dass Sie angerufen haben. Frau Schneider, sagten Sie?«
»Ja, Emma C. Schneider. Der Brief ging an Ilse Schneider, meine Großmutter. Im Apartmenthaus La Palma in Puerto de la Cruz.«
»Das sage ich ihm. Auf Wiederhören!«
»Auf Wiederhören. Hasta mañana!«
Wie peinlich! Wieso musste sie »hasta mañana« sagen und so tun, als könne sie Spanisch? Was hieß »hasta mañana« eigentlich genau? Hieß das nicht bis gleich oder so? Die Frau Hollerbeck musste sie für eine blöde, eitle junge Kuh halten.
Es klopfte erneut, etwas dezenter als vorhin.
Vor der Tür standen Heinz und Johanna Poloniak und strahlten Emma an. »Wir haben Sie vorhin ins Haus gehen sehen und dachten: vielleicht haben Sie auch Hunger? Wir wollen in ein Fisch-Restaurant ganz in der Nähe, das uns warm empfohlen worden ist, von unserer Vermieterin, Frau Hülsenbusch – kennen Sie Frau Hülsenbusch? Apartment 806, gleich neben unserem, 805. Sie kennt alle Lokale, alle Geschäfte oder wenn Sie mal einen Handwerker brauchen… Sie warnt davor, die Handwerker zu nehmen, die von der Hausverwaltung angeheuert sind. Sie wusste auch, wo wir Sie finden würden.«
Heinz Poloniak unterbrach: »Was meine Frau sagen will, also, was wir beide Sie fragen wollen, ist: wir würden Sie gern zum Abendessen einladen. Wo wir Sie doch vier Stunden lang mit unseren Erzählungen im Flugzeug gelangweilt haben! Als kleine Wiedergutmachung.«
Frau Poloniak warf ihrem Mann einen kritischen Blick zu.
»Nein, nein«, reagierte Emma schnell: »Sie haben mich kein bisschen gelangweilt. Sie haben mir den langen Flug verkürzt. Und außerdem haben Sie sich meine Jammergeschichten angehört. Eigentlich müsste ich Sie einladen.«
»Das können Sie dann ja beim nächsten Mal tun. Jetzt gehen wir zu Carmen, und Sie sind unser Gast. Carmen soll wunderbare Gambas machen, und auch die Seezunge wurde uns sehr empfohlen«, riss Frau Poloniak die Konversation wieder an sich.
»Ok, aber ich habe noch nichts ausgepackt. Ich muss mich umziehen und frisch machen. In einer halben Stunde, wäre das ok?«
Die beiden strahlten sie an. »Gerne, in einer halben Stunde unten vor dem Haus an der Bank unter dem Gummibaum. Es sind nur zehn Minuten zu Fuß zum Lokal. Wenn Sie nichts dagegen haben, schließt Frau Hülsenbusch sich auch noch an.«
Wie hätte Emma jetzt noch etwas dagegen haben können?